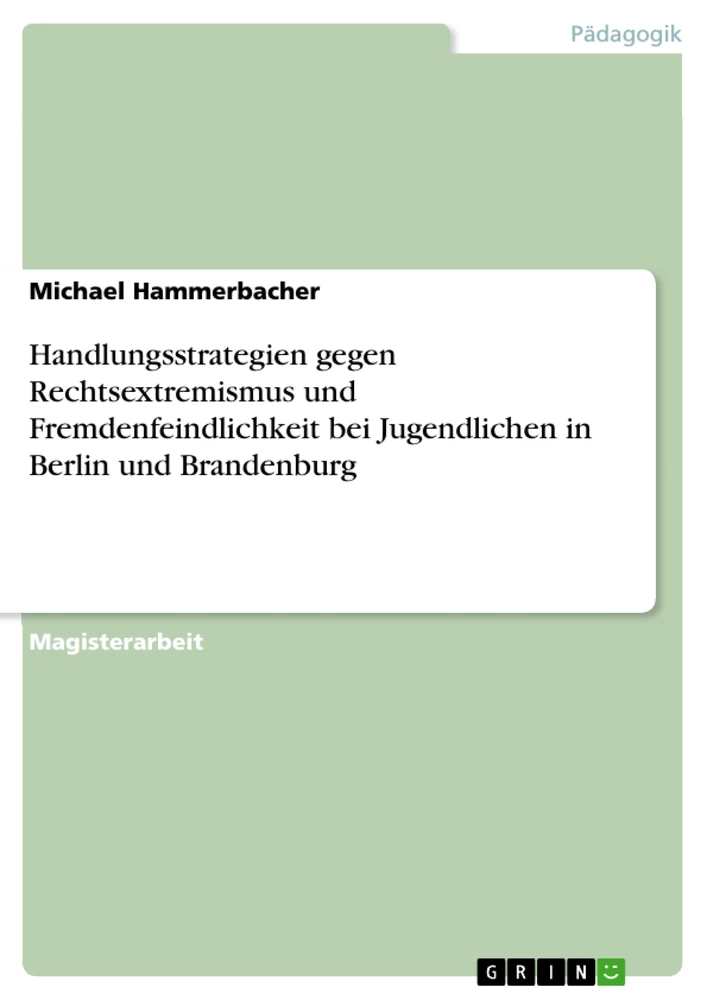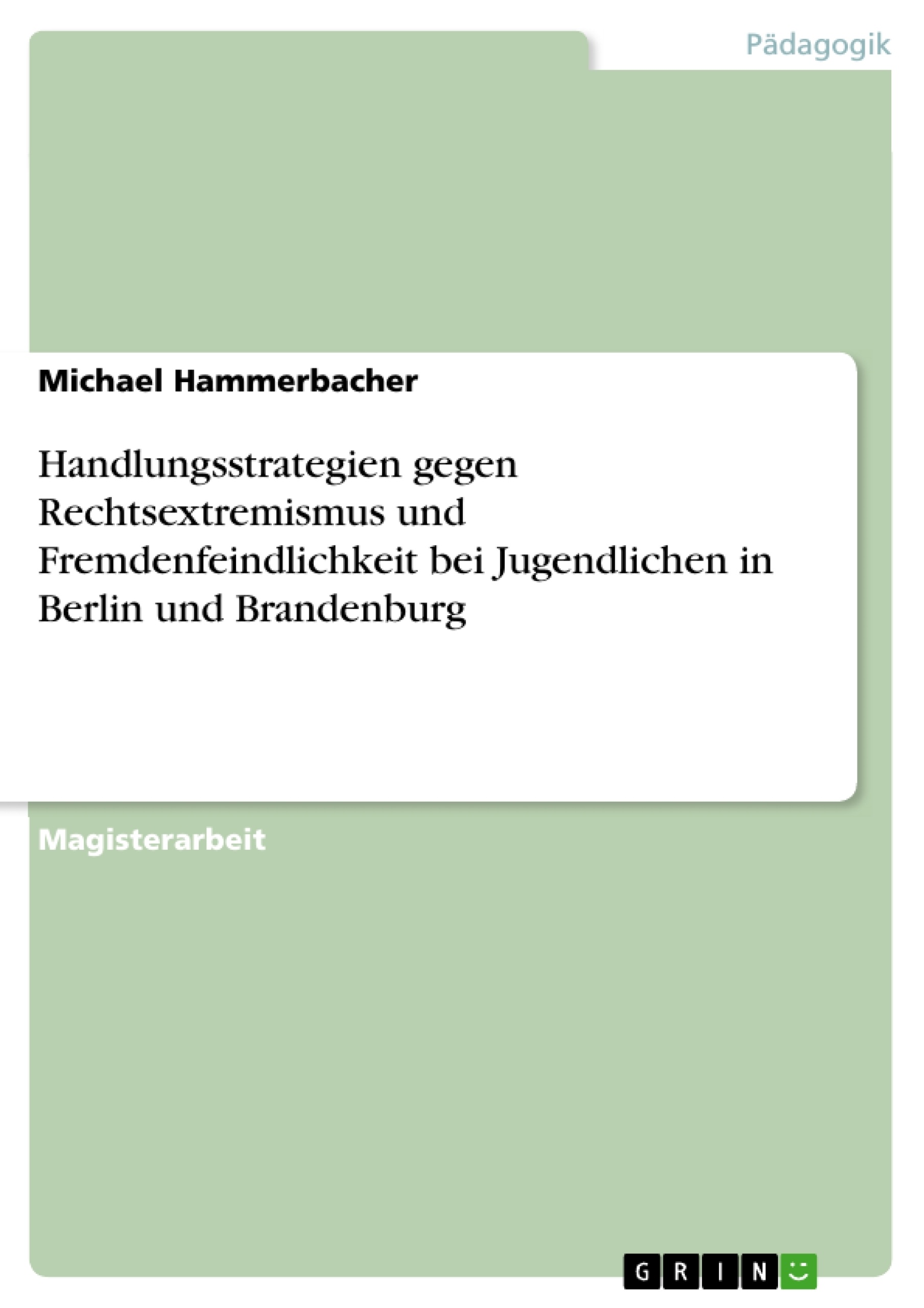Die Fragestellung der Arbeit ist heute immer noch hoch aktuell. Zur Systematisierung der Handlungsstrategien gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit bei Jugendlichen bediene ich mich einer historischen und vergleichenden Methode. Zwei relevante Zeitabschnitte mit jeweils unterschiedlichen pädagogischen und theoretischen Ansätzen sind zu untersuchen:
1. Erstens die ,,antifaschistische Pädagogik" vom Ende der siebziger Jahre bis zum Ende der achtziger Jahre. Herausragende Beispiele hierfür sind u.a. die Gedenkstättenpädagogik und antifaschistische Stadtrundfahrten.
2. Diese löste ein Jahrzehnt der Dominanz der ,,akzeptierenden Jugendarbeit mit Jugendlichen in rechten Jugendcliquen" ab, mit dem theoretischen Überbau der ,,Bielefelder Schule" um Wilhelm Heitmeyer, die eine ,,Individualisierungs- und Modernisierungsthese" als Grund für rechtsextremistische und fremdenfeindliche Einstellungen bei Jugendlichen vertritt.
Zur Zeit befinden wir uns erneut in einem Paradigmenwechsel in der Sozialwissenschaft und der Pädagogik. Projekte, die die Entwicklung der ,,Zivilgesellschaft" in den Kommunen fördern sollen und eine Theorie für eine Erziehung zur demokratischen Werten und kultureller Vielfalt lösen die ,,akzeptierende Jugendarbeit mit Jugendlichen in rechten Jugendcliquen" ab.
Die Fragestellungen, unter denen die Handlungsstrategien gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit bei Jugendlichen untersucht werden, gliedern sich wie folgt:
1. Welche Erklärung für die jeweils gegenwärtige gesellschaftliche Situation dominierte in der Sozialwissenschaft und in der Öffentlichkeit, die natürlich auch das gesellschaftliche Umfeld und die Strategie der Rechtsextremisten berücksichtigen muss.
2. Welche Akteure handelten mit welcher Methode für welche Zielgruppe gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus?
3. Welche Kritik wurde an der Handlungsstrategie geübt und was führte zu ihrer Ablösung?
Am Ende meiner Arbeit setze ich mich dann damit auseinander, welche Schlussfolgerungen sich aus dieser historischen und vergleichenden Perspektive für eine heutige Handlungsstrategie ziehen lassen und folge meiner These, dass in den dargestellten gesellschaftlichen Situationsanalysen wichtige Faktoren ausgeblendet wurden, deren Berücksichtigung aber für eine adäquate Bekämpfung von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit bei Jugendlichen in Berlin und Brandenburg notwendig sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsklärung
- 2.1. Ausländerfeindlichkeit
- 2.2. Fremdenfeindlichkeit, Xenophobie und Ethnozentrismus
- 2.3. Rassismus
- 2.4. Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus
- 3. Von 1970 bis 1989: Antifaschistische Pädagogik in den alten Bundesländern
- 3.1. Gesellschaftliche Situation in den siebziger und achtziger Jahren
- 3.2. Empirische Untersuchungen in den achtziger Jahren
- 3.3. Theoretische Erklärungsversuche in den achtziger Jahren
- 3.4. Die antifaschistische Handlungsstrategie
- 3.5. Die Umsetzung der antifaschistischen Pädagogik
- 3.6. Die Kritik an der antifaschistischen Pädagogik
- 4. Nach 1989: Die „akzeptierende Jugendarbeit mit Jugendlichen in rechten Jugendcliquen“
- 4.1. Gesellschaftliche Situation von 1989 bis 1993
- 4.2. Empirische Studien von 1989 bis 1993 aus Berlin/Brandenburg
- 4.3. Theoretische Erklärungsansätze für Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit bei Jugendlichen von 1987 bis 1993
- 4.3.1. Die Modernisierungs- und Individualisierungsthese
- 4.3.2. Die These der sozialen Deprivation
- 4.3.3. Die These der Dominanzkultur
- 4.4. Zielgruppe und theoretische Herleitung der Handlungsstrategie
- 4.4.1. Jörg Krauẞlach
- 4.4.2. Benno Hafeneger
- 4.4.3. Franz Josef Krafeld
- 4.5. Die pädagogische Umsetzung: Das Konzept der „akzeptierenden Jugendarbeit mit Jugendlichen in rechten Jugendcliquen“
- 4.6. Die Übertragung auf die neuen Bundesländer 1992 bis 1997
- 4.7. Die Kritik an der „akzeptierenden Jugendarbeit mit Jugendlichen in rechten Jugendcliquen“
- 4.7.1. Die Kritik an der Theorie
- 4.7.2. Die Mängel in der praktischen Umsetzung
- 4.7.3. Die Folgen für das lokale soziokulturelle Klima
- 4.7.4. Abschied vom Konzept der „akzeptierenden Jugendarbeit mit Jugendlichen in rechten Jugendcliquen\"?
- 5. Seit 1997: Zivilgesellschaftliche Handlungskonzepte gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit
- 5.1. Gesellschaftliche Situation nach 1993
- 5.2. Empirische Studien von 1997 bis 2000 aus Berlin und Brandenburg
- 5.3. Theoretische Erklärungsansätze für Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit auch bei Jugendlichen
- 5.3.1. Notwendigkeit einer Einbeziehung der DDR-Geschichte
- 5.3.1.1. Entwicklung des Rechtsextremismus in der DDR
- 5.3.1.2. Stärke und Mobilisierungsfelder der Rechtsextremen in der DDR 1989
- 5.3.1.3. Rechtsextremismus in den neuen Ländern als soziale Bewegung
- 5.3.2. Historische Ursachen
- 5.3.3. Erklärungsansätze aus der Sicht der Autoritarismusforschung
- 5.3.1. Notwendigkeit einer Einbeziehung der DDR-Geschichte
- 5.4. Theoretische Herleitung des zivilgesellschaftlichen Handlungskonzepts
- 5.5. Das zivilgesellschaftliche Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit
- 5.6. Träger der Maßnahmen und die Umsetzung des Konzepts
- 5.7. Die Kritik am zivilgesellschaftlichen Handlungskonzept
- 5.7.1. Die Kritik an der Theorie
- 5.7.2. Die Kritik an der Eingrenzung auf die neuen Bundesländer
- 5.7.3. Die Kritik am Handlungskonzept „Tolerantes Brandenburg”
- 5.7.4. Bewertung und Ausblick
- 6. Abschließender Vergleich und Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung von Handlungsstrategien gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit bei Jugendlichen in Berlin und Brandenburg. Sie analysiert die gesellschaftlichen, politischen und pädagogischen Entwicklungen in den letzten drei Jahrzehnten und beleuchtet unterschiedliche Handlungskonzepte und deren Kritik.
- Entwicklung des Rechtsextremismus in der DDR und den neuen Bundesländern
- Theoretische Ansätze zur Erklärung von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit
- Entwicklung und Kritik verschiedener pädagogischer Handlungskonzepte
- Analyse der Wirksamkeit und Grenzen zivilgesellschaftlicher Maßnahmen
- Bewertung aktueller Herausforderungen und Perspektiven für die Bekämpfung von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Motivation und den Hintergrund der Arbeit dar. Sie beleuchtet die Problematik von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in Berlin und Brandenburg und setzt den Themenbereich in den Kontext aktueller gesellschaftlicher Debatten.
Kapitel 2 befasst sich mit der begrifflichen Klärung von Begriffen wie Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit, Xenophobie, Ethnozentrismus und Rassismus. Es liefert eine Grundlage für die weitere Analyse von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit.
Kapitel 3 beschreibt die Entwicklung der antifaschistischen Pädagogik in den alten Bundesländern von 1970 bis 1989. Es beleuchtet die gesellschaftliche Situation, empirische Untersuchungen, theoretische Ansätze und die praktische Umsetzung der Handlungsstrategie.
Kapitel 4 analysiert das Konzept der „akzeptierenden Jugendarbeit mit Jugendlichen in rechten Jugendcliquen“ im Kontext der Entwicklungen nach 1989. Es betrachtet die gesellschaftliche Situation, empirische Studien, theoretische Erklärungsansätze und die Kritik an diesem Konzept.
Kapitel 5 fokussiert auf zivilgesellschaftliche Handlungskonzepte gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit seit 1997. Es untersucht die gesellschaftliche Situation, empirische Studien, theoretische Ansätze und die praktische Umsetzung des Konzepts.
Schlüsselwörter
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Jugendarbeit, Pädagogik, Handlungskonzepte, Zivilgesellschaft, Berlin, Brandenburg, DDR, Autoritarismus, Modernisierung, Individualisierung, Soziale Deprivation, Dominanzkultur, Empirische Studien, Kritik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist „akzeptierende Jugendarbeit“?
Ein pädagogisches Konzept, das versucht, über Beziehungsarbeit Zugang zu Jugendlichen in rechten Cliquen zu finden, ohne deren Gesinnung sofort zu verurteilen.
Warum wird die akzeptierende Jugendarbeit heute kritisiert?
Kritiker bemängeln, dass sie zur Stabilisierung rechter Strukturen führen kann und die negativen Folgen für das lokale soziokulturelle Klima unterschätzt wurden.
Gab es Rechtsextremismus in der DDR?
Ja, die Arbeit zeigt auf, dass es bereits in der DDR rechtsextreme Tendenzen und Mobilisierungsfelder gab, die nach 1989 sichtbar wurden.
Was besagt die Modernisierungs- und Individualisierungsthese?
Nach Wilhelm Heitmeyer führen soziale Unsicherheit und Orientierungslosigkeit durch Modernisierungsprozesse dazu, dass Jugendliche rechtsextreme Ideologien als Kompensation wählen.
Was ist das Ziel zivilgesellschaftlicher Handlungskonzepte?
Sie fördern demokratische Werte und kulturelle Vielfalt in Kommunen (z. B. "Tolerantes Brandenburg"), um dem Rechtsextremismus auf breiter gesellschaftlicher Basis zu begegnen.
- Citation du texte
- MA Michael Hammerbacher (Auteur), 2001, Handlungsstrategien gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit bei Jugendlichen in Berlin und Brandenburg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47