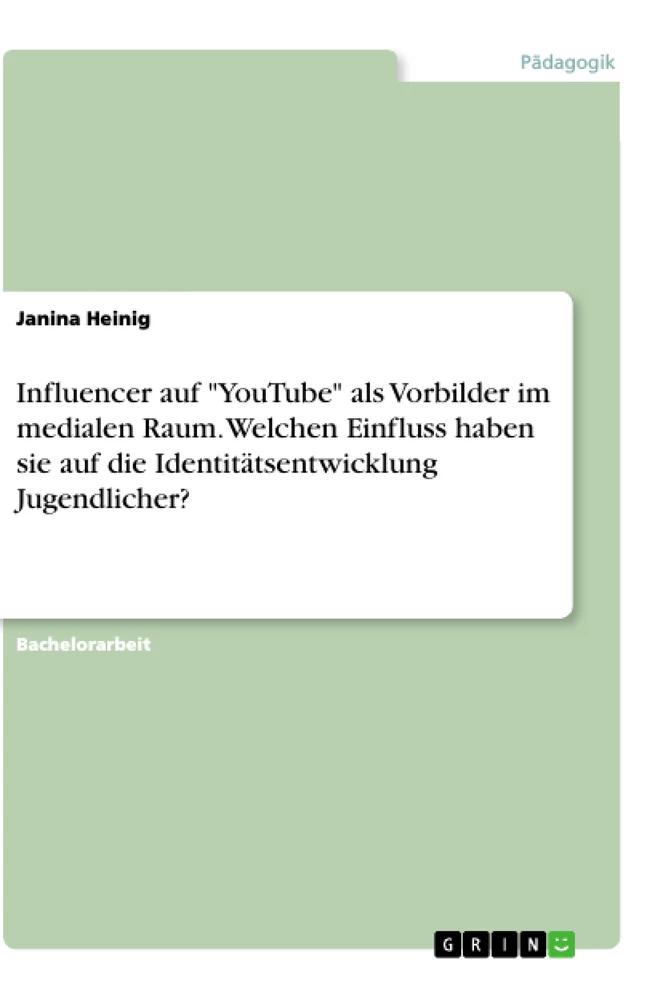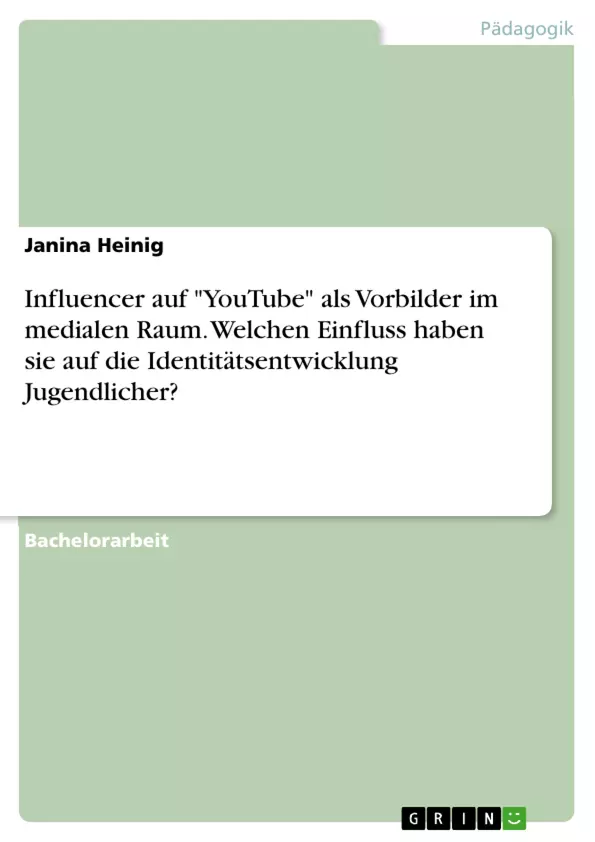Diese Arbeit geht den Fragestellungen nach, warum gerade bei der Plattform "YouTube" in Bezug auf die YouTuber/YouTuberinnen als mediale Vorbilder ein wachsender Erfolg zu verzeichnen ist, welchen Einfluss diese auf die Identitätsentwicklung Jugendlicher haben und welche Chancen und Herausforderungen sich daraus für die Soziale Arbeit ergeben. Neben einer theoretischen Rahmung werden eigene Forschungsergebnisse dargelegt und hieraus Empfehlungen für die Praxis der Sozialen Arbeit abgeleitet. Dabei wird sich vornehmlich auf Adoleszente bezogen, da diese vor allem die Zielgruppe für YouTube Videos darstellen und sich diese Phase in Bezug auf die Identitätsentwicklung als besonders prägend erweist.
Die Ergebnisse einer Umfrage der Defy Media ergaben, dass 13- bis 24- Jährige im Durchschnitt wöchentlich 11,3 Stunden Videos online im Internet schauen, wohingegen der Konsum von Fernsehsendungen 9,3 Stunden pro Woche einnimmt. Aufgrund dieser Ergebnisse ist es nicht verwunderlich, dass der Videoplattform "YouTube" immer mehr Stars entspringen, welche sich vermehrt zu medialen Vorbildern entwickeln.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Identitätsentwicklung
- 2.1. Identitätsentwicklung nach Erikson (1950, 1968)
- 2.2. Die Patchworkidentität nach Keupp (1999, 2009)
- 2.3. Die Relevanz von Peergroups während der Identitätsentwicklung
- 2.4. Geschlechtsidentität
- 2.5. Vorbilder
- 3. Vorbilder
- 3.1. Die soziale Lerntheorie nach Bandura (1977)
- 3.2. Die Relevanz von Vorbildern während der Identitätsentwicklung
- 4. Massenmedien
- 4.1. Der Einfluss von Medien auf die Identitätsentwicklung
- 4.2. Die Bedeutung medialer Vorbilder während der Identitätsentwicklung
- 4.3. Potentielle Gefahren der Medien
- 4.3.1. Vermittlung einer verzerrten Realität
- 4.3.2. Cybermobbing
- 4.3.3. Werbung und Beeinflussung
- 5. Die Plattform „YouTube“
- 5.1. Die Wirkungsweise von YouTube
- 5.2. Die Bedeutung von YouTube während der Identitätsentwicklung
- 5.3. Potentielle Gefahren auf YouTube
- 5.3.1. YouTube als Markt
- 5.3.2. Sexismus und Cybermobbing auf YouTube
- 6. Erhebung
- 6.1. Hypothesen und Methodik
- 6.2. Stichprobe
- 6.3. Ergebnisse
- 6.3.1. Allgemeine Mediennutzung
- 6.3.2. Nutzung von YouTube
- 6.3.3. Vorbilder auf YouTube
- 6.3.4. Zusammenfassung der Ergebnisse
- 6.4. Diskussion und Einordnung der Ergebnisse
- 7. Bedeutung für die Soziale Arbeit
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Einfluss von YouTube-Influencern auf die Identitätsentwicklung von Jugendlichen in der Adoleszenz. Ziel ist es, die Bedeutung dieser medialen Vorbilder zu beleuchten und die Chancen und Herausforderungen für die Soziale Arbeit aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert, warum YouTube in diesem Kontext eine besondere Rolle spielt.
- Identitätsentwicklung in der Adoleszenz
- Der Einfluss medialer Vorbilder
- Die Rolle von YouTube als Plattform
- Potentielle Gefahren medialer Vorbilder
- Implikationen für die Soziale Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und begründet die Relevanz der Untersuchung des Einflusses von YouTube-Influencern auf die Identitätsentwicklung von Jugendlichen aufgrund der hohen Mediennutzung in dieser Altersgruppe. Sie stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss dieser Influencer und den daraus resultierenden Chancen und Herausforderungen für die Soziale Arbeit. Die Arbeit fokussiert sich auf die Adoleszenz als prägende Phase der Identitätsentwicklung.
2. Identitätsentwicklung: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Theorien der Identitätsentwicklung, darunter die Ansätze von Erikson, Keupp und Marcia. Es diskutiert den Einfluss von Peergroups und die Entwicklung der Geschlechtsidentität im Kontext der Adoleszenz und betont die Bedeutung der selbstbestimmten Konstruktion der Identität in einer individualisierten Gesellschaft.
3. Vorbilder: Das Kapitel erklärt die soziale Lerntheorie nach Bandura und erläutert die Bedeutung von Vorbildern für die Identitätsentwicklung. Es wird herausgearbeitet, wie Jugendliche durch Beobachtung und Nachahmung von Vorbildern ihre Identität formen und entwickeln.
4. Massenmedien: Hier wird der generelle Einfluss von Massenmedien auf die Identitätsentwicklung von Jugendlichen analysiert. Die Arbeit untersucht die Rolle medialer Vorbilder und adressiert potenzielle Gefahren wie die Vermittlung einer verzerrten Realität, Cybermobbing und manipulative Werbung.
5. Die Plattform „YouTube“: Dieses Kapitel fokussiert auf die Plattform YouTube, ihre Wirkungsweise und ihre Bedeutung für die Identitätsentwicklung von Jugendlichen. Es analysiert YouTube-Influencer als mediale Vorbilder und beschreibt potentielle Gefahren, wie z.B. die Kommerzialisierung und das Vorkommen von Sexismus und Cybermobbing auf der Plattform.
6. Erhebung: Das Kapitel beschreibt die durchgeführte empirische Untersuchung, die Methodik, die Stichprobe und die gewonnenen Ergebnisse zur Mediennutzung, YouTube-Nutzung und der Bedeutung von Vorbildern auf YouTube bei Jugendlichen. Die Ergebnisse geben Aufschluss über das Nutzungsverhalten und die Relevanz von Vorbildern auf dieser Plattform.
7. Bedeutung für die Soziale Arbeit: Dieses Kapitel zeigt auf, welche Herausforderungen und Chancen sich durch die medialen Vorbilder auf YouTube für die Soziale Arbeit ergeben. Es wird diskutiert, wie die Soziale Arbeit die Jugendlichen in diesem Kontext unterstützen kann.
Schlüsselwörter
Identitätsentwicklung, Adoleszenz, Mediennutzung, YouTube, Influencer, Vorbilder, Soziale Lerntheorie, Massenmedien, Geschlechtsidentität, Peergroups, Soziale Arbeit, Cybermobbing.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Einfluss von YouTube-Influencern auf die Identitätsentwicklung Jugendlicher
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von YouTube-Influencern auf die Identitätsentwicklung Jugendlicher in der Adoleszenz. Sie beleuchtet die Bedeutung dieser medialen Vorbilder und analysiert die Chancen und Herausforderungen für die Soziale Arbeit.
Welche Theorien der Identitätsentwicklung werden behandelt?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Theorien der Identitätsentwicklung, darunter die Ansätze von Erikson, Keupp und Marcia. Es wird der Einfluss von Peergroups und die Entwicklung der Geschlechtsidentität diskutiert.
Welche Rolle spielt die soziale Lerntheorie?
Die soziale Lerntheorie nach Bandura wird verwendet, um die Bedeutung von Vorbildern für die Identitätsentwicklung zu erklären. Es wird gezeigt, wie Jugendliche durch Beobachtung und Nachahmung ihre Identität formen.
Wie wird der Einfluss von Massenmedien behandelt?
Die Arbeit analysiert den generellen Einfluss von Massenmedien auf die Identitätsentwicklung und die Rolle medialer Vorbilder. Potentielle Gefahren wie verzerrte Realität, Cybermobbing und manipulative Werbung werden angesprochen.
Welche Bedeutung hat YouTube in dieser Arbeit?
YouTube wird als zentrale Plattform analysiert, mit Fokus auf seine Wirkungsweise und Bedeutung für die Identitätsentwicklung. YouTube-Influencer werden als mediale Vorbilder untersucht, inklusive potentieller Gefahren wie Kommerzialisierung, Sexismus und Cybermobbing.
Welche Methodik wurde in der empirischen Untersuchung verwendet?
Die Arbeit beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung, die Stichprobe und die Ergebnisse zur Mediennutzung, YouTube-Nutzung und der Bedeutung von Vorbildern auf YouTube bei Jugendlichen.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse geben Aufschluss über das Nutzungsverhalten und die Relevanz von Vorbildern auf YouTube. Sie werden im Detail in Kapitel 6 (Erhebung) dargestellt.
Welche Implikationen ergeben sich für die Soziale Arbeit?
Die Arbeit zeigt auf, welche Herausforderungen und Chancen sich durch die medialen Vorbilder auf YouTube für die Soziale Arbeit ergeben und wie die Soziale Arbeit Jugendliche in diesem Kontext unterstützen kann.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Identitätsentwicklung, Adoleszenz, Mediennutzung, YouTube, Influencer, Vorbilder, Soziale Lerntheorie, Massenmedien, Geschlechtsidentität, Peergroups, Soziale Arbeit, Cybermobbing.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Identitätsentwicklung, Vorbilder, Massenmedien, Die Plattform „YouTube“, Erhebung, Bedeutung für die Soziale Arbeit und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detaillierter beschrieben.
Wo finde ich die detaillierten Kapitelzusammenfassungen?
Die detaillierten Kapitelzusammenfassungen finden Sie im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel" der Arbeit.
- Quote paper
- Janina Heinig (Author), 2017, Influencer auf "YouTube" als Vorbilder im medialen Raum. Welchen Einfluss haben sie auf die Identitätsentwicklung Jugendlicher?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/470055