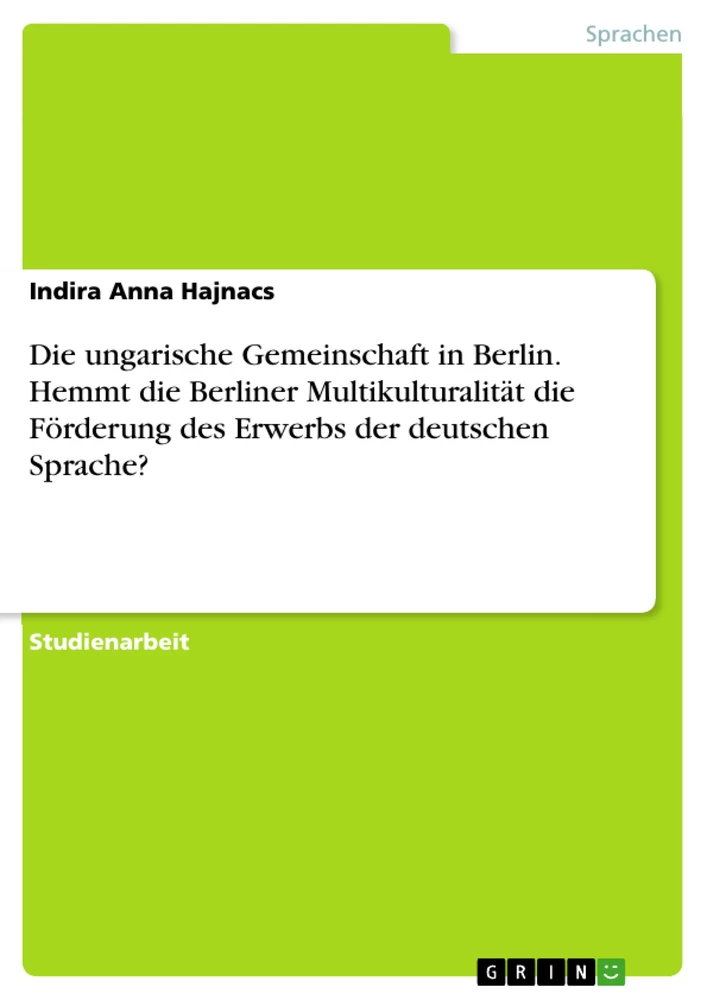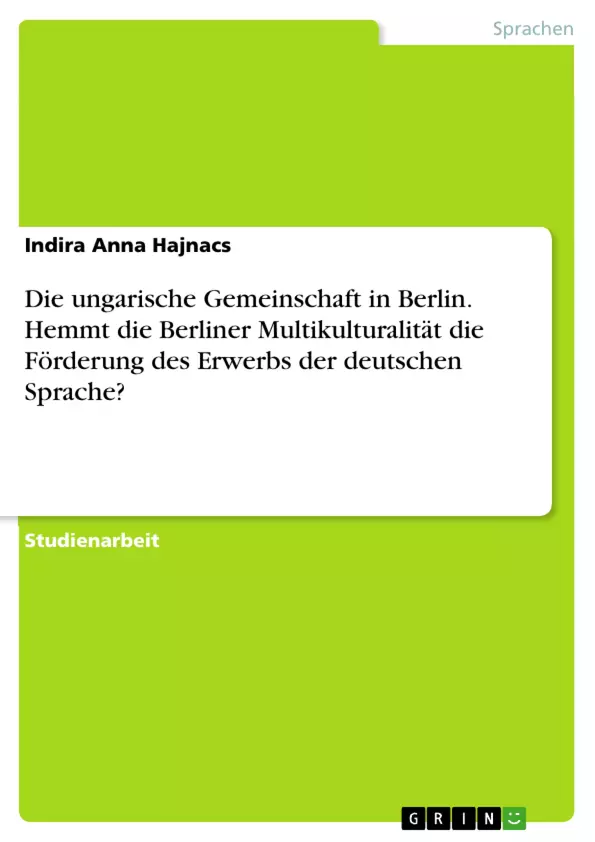Der Ausgangspunkt der Arbeit ist die Hypothese, dass das Berliner Milieu mit seiner speziellen multikulturellen Lage den Erwerb der deutschen Sprache für die ungarischen Auswanderer nicht fördert. Das Ziel dieser Arbeit ist, die allgemeine sprachliche Situation der ungarischen Gemeinschaft in Berlin kennenzulernen. Die Arbeit wird zu dem bisher wenig erforschten Thema der ungarischen städtischen Migration soziolinguistische Informationen liefern. Der selbst gesammelte Korpus wird authentisches Material zur Sprachfähigkeit der untersuchten Gruppe bieten. Die Zusammenhänge der Sprachbiografien und der Sprachkenntnisse werden durch die Daten der Fragebogenerhebung beleuchtet. Die Prozesse des Fremdsprachenerwerbs mit besonderem Schwerpunkt auf den gesteuerten und ungesteuerten Spracherwerb werden anhand von Beispielen in der untersuchten Gemeinschaft veranschaulicht.
In den letzten Jahren haben tausende Ungarn ihren Wohnsitz in ihrem Heimatland aufgegeben und sind in westeuropäische Städte gezogen. Berlin ist als beliebte Zielstadt stark von der Migration betroffen; vor allem nutzen ungarische Akademiker und junge Erwachsene die Möglichkeiten der europäischen Mobilität. Was wissen wir von ihrer Situation? Welche Sprache benutzen die Ungarn dort am meisten? Ist die deutsche Sprache die am meisten Genutzte unter Ihnen? Wurden sie vom ungarischen Bildungssystem auf die Benutzung der Fremdsprache vorbereitet.
Die Migrationslinguistik und Sprachkontaktforschung beschäftigt sich mit solchen Problematiken des Zweitspracherwerbs; aber speziell über die Sprachbenutzung der in Berlin lebenden ungarischen Sprachgemeinschaft sind sehr wenige Angaben zu finden. Auch die genaue Zahl der betroffenen Forschungsgruppe ist schwer einzuschätzen. Die ersten öffentlichen Daten über die Zahl der in Berlin-Brandenburg lebenden Ungarn stammen aus dem Jahr 2017.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung und Beschreibung der Gewährpersonen
- Methodenbeschreibung, Analyseschritte
- Die ungarische Gemeinschaft in Berlin
- Auswertung der empirischen Befunde
- Vorstellung der Ergebnisse des persönlichen Interviews
- Vorstellung der Ergebnisse der Online-Fragebogenerhebung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die sprachliche Situation der ungarischen Gemeinschaft in Berlin. Ziel ist es, soziolinguistische Informationen zu dieser bisher wenig erforschten Gruppe zu liefern und die Zusammenhänge zwischen Sprachbiografien, Sprachkenntnissen und den Prozessen des Fremdsprachenerwerbs zu beleuchten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Besonderheiten im Sprachkontakt zwischen Ungarisch und Deutsch.
- Sprachliche Situation ungarischer Migranten in Berlin
- Prozesse des Deutsch-Sprachenerwerbs (gesteuert und ungesteuert)
- Sprachkontakt zwischen Ungarisch und Deutsch
- Sprachbiografien und Sprachkenntnisse der untersuchten Gruppe
- Vergleich mit anderen Migrantengruppen (z.B. türkische Gemeinschaft)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Auswanderung vieler Ungarn nach Westeuropa, insbesondere nach Berlin, und die daraus resultierende Forschungsfrage nach der sprachlichen Situation dieser Gemeinschaft. Die Hypothese besagt, dass das Berliner Milieu den Erwerb der deutschen Sprache für ungarische Migranten nicht fördert. Die Arbeit betont den Mangel an Forschung zu diesem hochaktuellen Thema.
Zielsetzung und Beschreibung der Gewährpersonen: Dieses Kapitel erläutert die Motivation der Autorin, die aus persönlicher Erfahrung in Berlin resultiert. Es definiert die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, die sprachliche Situation der ungarischen Gemeinschaft in Berlin zu untersuchen und soziolinguistische Informationen zu liefern. Die Methodik wird kurz skizziert, mit Verweis auf die verwendete Literatur der Sprachkontaktforschung und Migrationslinguistik. Die Gewährspersonen werden als 75 Informationslieferanten aus der ungarischen Sprachgemeinschaft in Berlin beschrieben.
Die ungarische Gemeinschaft in Berlin: Dieses Kapitel beschreibt die ungarische Gemeinschaft in Berlin als mehrsprachige Gesellschaft, die täglich mit Deutsch und Ungarisch in Kontakt steht, jedoch nicht als offizielle Minderheit registriert ist. Es werden die Herausforderungen des Deutschlernens für ungarische Migranten beleuchtet und die Frage gestellt, ob sie eine eigene Sprachinsel bilden oder nach Integration streben. Die Autorin klassifiziert die Gemeinschaft als "allochtone Minderheit" im Sinne von Riehl (2009).
Schlüsselwörter
Ungarische Gemeinschaft Berlin, Sprachliche Situation, Migrationslinguistik, Sprachkontaktforschung, Deutsch als Zweitsprache, Sprachenerwerb, Sprachbiografien, Mehrsprachigkeit, Sprachinsel, Integration, empirische Untersuchung, soziolinguistische Analyse.
Häufig gestellte Fragen zur soziolinguistischen Untersuchung der ungarischen Gemeinschaft in Berlin
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die sprachliche Situation der ungarischen Gemeinschaft in Berlin. Sie beleuchtet die Zusammenhänge zwischen Sprachbiografien, Sprachkenntnissen und den Prozessen des Fremdsprachenerwerbs (Deutsch als Zweitsprache) bei ungarischen Migranten in Berlin. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse des Sprachkontakts zwischen Ungarisch und Deutsch.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage ist, wie die sprachliche Situation der ungarischen Gemeinschaft in Berlin aussieht. Die Arbeit untersucht, wie der Deutsch-Sprachenerwerb dieser Gruppe verläuft (gesteuert und ungesteuert), ob und wie ein Sprachkontakt zwischen Ungarisch und Deutsch stattfindet und welche Rolle Sprachbiografien und Sprachkenntnisse spielen. Es wird auch ein Vergleich mit anderen Migrantengruppen angedeutet (z.B. türkische Gemeinschaft).
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit basiert auf empirischen Daten. Es wurden persönliche Interviews und eine Online-Fragebogenerhebung durchgeführt. Die genaue Methodik wird im Kapitel "Methodenbeschreibung, Analyseschritte" detailliert beschrieben. Die Anzahl der Informationslieferanten (Gewährpersonen) wird mit 75 angegeben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Zielsetzung und Beschreibung der Gewährpersonen, Methodenbeschreibung, Analyseschritte, Die ungarische Gemeinschaft in Berlin, Auswertung der empirischen Befunde (mit Unterkapiteln zu persönlichen Interviews und Online-Fragebögen) und Fazit.
Welche Ergebnisse werden vorgestellt?
Die Auswertung der empirischen Befunde (persönliche Interviews und Online-Fragebögen) wird im entsprechenden Kapitel präsentiert. Die Ergebnisse liefern soziolinguistische Informationen über die ungarische Gemeinschaft in Berlin.
Welche Hypothese wird aufgestellt?
Die Hypothese besagt, dass das Berliner Milieu den Erwerb der deutschen Sprache für ungarische Migranten nicht fördert.
Wer sind die Gewährpersonen?
Die Gewährpersonen sind 75 Informationslieferanten aus der ungarischen Sprachgemeinschaft in Berlin.
Wie wird die ungarische Gemeinschaft in Berlin charakterisiert?
Die ungarische Gemeinschaft in Berlin wird als mehrsprachige Gesellschaft beschrieben, die täglich mit Deutsch und Ungarisch in Kontakt steht, aber nicht als offizielle Minderheit registriert ist. Die Autorin klassifiziert sie als "allochtone Minderheit".
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ungarische Gemeinschaft Berlin, Sprachliche Situation, Migrationslinguistik, Sprachkontaktforschung, Deutsch als Zweitsprache, Sprachenerwerb, Sprachbiografien, Mehrsprachigkeit, Sprachinsel, Integration, empirische Untersuchung, soziolinguistische Analyse.
Welche Literatur wird verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Literatur der Sprachkontaktforschung und Migrationslinguistik (z.B. Riehl 2009 wird erwähnt).
- Arbeit zitieren
- Indira Anna Hajnacs (Autor:in), 2019, Die ungarische Gemeinschaft in Berlin. Hemmt die Berliner Multikulturalität die Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/470605