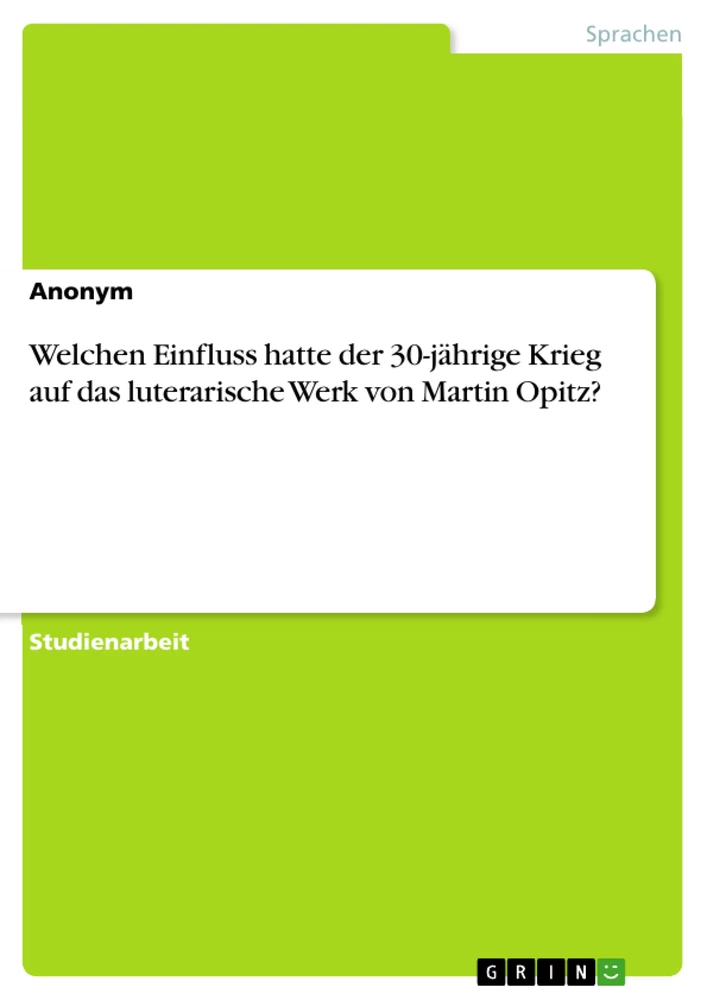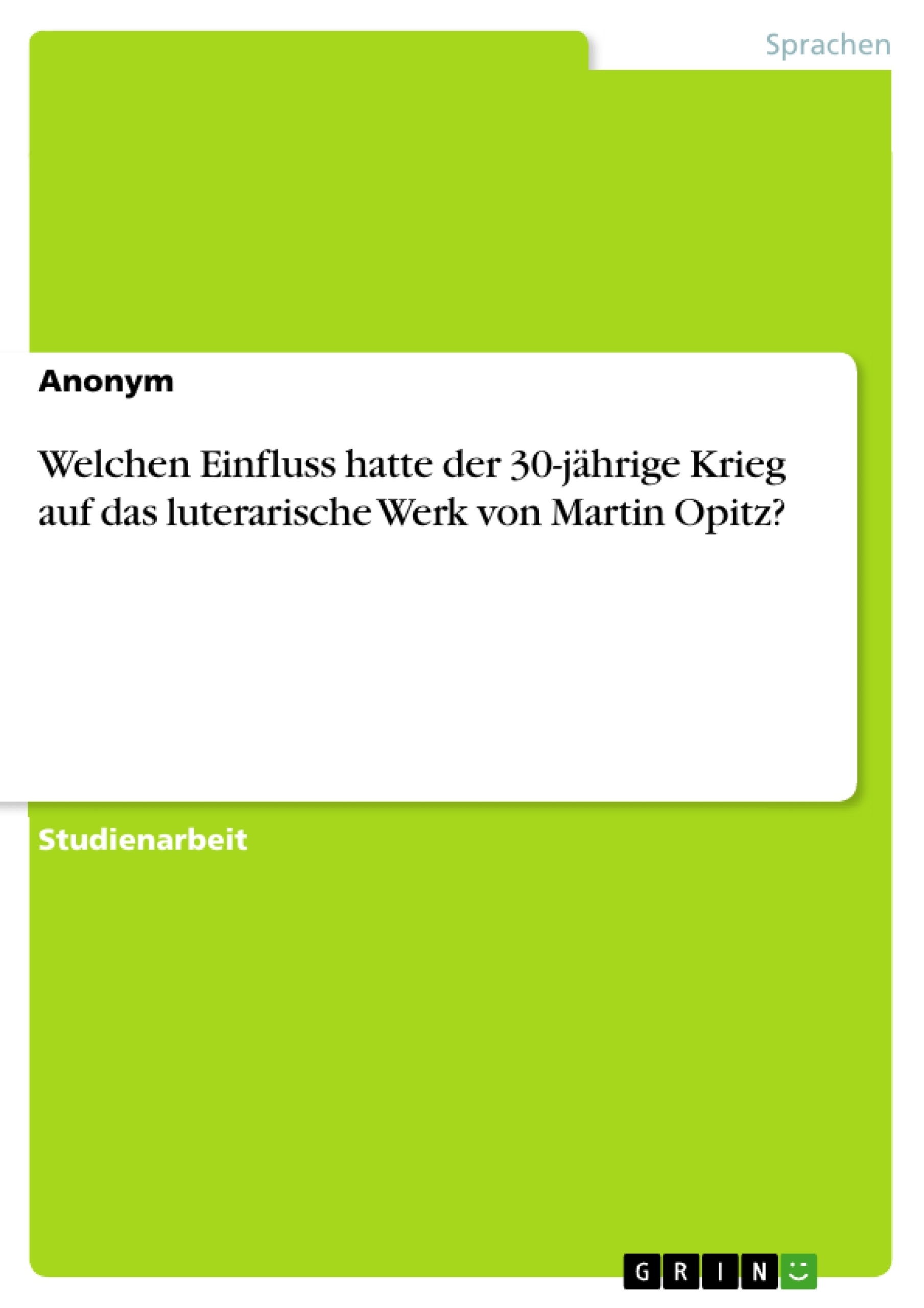Der 30-jährige Krieg war eines der prägendsten Geschehnisse in der Epoche des Barock. Zeitzeugen, wie die Schriftsteller Martin Opitz oder Andreas Gryphius, thematisierten jene Erlebnisse in Ihren Werken und kreierten ein Bild von Gewalt und Zerstörung. Bis in das 20. Jahrhundert befassten sich Schriftsteller und Literaten, wie beispielsweise auch Berthold Brecht in "Mutter Courage und Ihre Kinder", mit dem großen Krieg in Deutschland. Der mächtige Einfluss dieses historischen Ereignisses hinterlässt die Frage, wieso dieser Krieg die Menschen bis heute fasziniert und selbst die Gegenwartsliteratur noch immer inspiriert. Welche literarischen Relikte entsprechen der Realität und welche sind Fiktion oder überspitzt formulierte Worte von traumatisierten Zeitzeugen?
Diese Fragen sollen beantwortet werden, indem der Einfluss des 30-jährigen Krieges am luterarischen Werk von Martin Opitz untersucht wird. Die Diskussion erfolgt anhand seines Textes "Trostgedichte" in "Widerwärtigkeit des Krieges". Da der Autor nicht nur Zeitzeuge war, sondern zudem auch selbst sein Leben lang auf der Flucht vor Vertreibung und Gewalt war, skizziert er in seiner Lyrik ein anschauliches und zugleich grausames Bild der Lebensumstände jener Epoche. Es wird eine kritische Nachforschung angestellt, inwieweit sich realistische Einflüsse in Opitz Trostgedicht widerfinden und welche Haltung die Kritiker der Gegenwart zu jenem geschichtsträchtigen Ereignis einnehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Einfluss des Dreißigjährigen Krieges auf die Lyrik von Martin Opitz
- Der 30 Jährige Krieg - Historischer Überblick
- Martin Opitz und der Krieg – Poet oder Stratege?
- Trostgedichte in Widerwärtigkeit des Krieges – Überblick
- Zusammenfassung & Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Dreißigjährigen Krieges auf die Lyrik von Martin Opitz, insbesondere auf seine „Trostgedichte in Widerwärtigkeit des Krieges“. Die Zielsetzung besteht darin, den historischen Kontext des Krieges zu beleuchten, Opitz' Rolle als Zeitzeuge und Schriftsteller zu analysieren und den Realitätsgehalt seiner Gedichte zu untersuchen. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit Opitz' Werk die Realität des Krieges widerspiegelt und wie die Gegenwartsliteratur dieses historische Ereignis rezipiert.
- Der Dreißigjährige Krieg als historischer und literarischer Kontext
- Martin Opitz' persönliche Erfahrungen und seine literarische Reaktion auf den Krieg
- Analyse der "Trostgedichte in Widerwärtigkeit des Krieges" im Hinblick auf Realismus und Fiktion
- Die Rezeption des Dreißigjährigen Krieges in der Gegenwartsliteratur
- Opitz' Positionierung als Poet und möglicher politischer Stratege im Kontext des Krieges.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den nachhaltigen Einfluss des Dreißigjährigen Krieges auf die Literatur, von der Barockzeit bis zur Gegenwart. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verhältnis von Realität und Fiktion in der Darstellung des Krieges und kündigt die Analyse von Opitz' „Trostgedichten“ an, um diese Frage zu untersuchen. Die Einleitung betont Opitz' besondere Rolle als Zeitzeuge, dessen Leben und Werk eng mit den Ereignissen des Krieges verwoben sind.
Der Einfluss des Dreißigjährigen Krieges auf die Lyrik von Martin Opitz: Dieses Kapitel analysiert umfassend den Einfluss des Dreißigjährigen Krieges auf Martin Opitz' Werk. Es beginnt mit einem historischen Überblick über den Krieg, seine Ursachen (religiöse Konflikte und politische Machtkämpfe) und seinen Verlauf, von den Anfängen im böhmischen Aufstand bis zum Westfälischen Frieden. Anschließend wird Opitz' Leben und Werk im Kontext des Krieges untersucht. Es wird beleuchtet, wie Opitz' eigene Erfahrungen mit Flucht und Vertreibung seine Lyrik prägten, und die Frage aufgeworfen, inwieweit er als „Stratege“ fungierte, indem er seine Stellung am Hof nutzte, um dem Krieg zu entkommen. Die Analyse von Opitz’ "Trostgedichten" betrachtet die darin enthaltenen Schilderungen der Kriegswirklichkeit und deren Übereinstimmung mit historischen Quellen.
Schlüsselwörter
Dreißigjähriger Krieg, Barockliteratur, Martin Opitz, Trostgedichte, Realismus, Fiktion, Zeitzeugenschaft, Kriegserfahrung, Literatur und Geschichte, politische Strategien, humanistische Ideale.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Der Einfluss des Dreißigjährigen Krieges auf die Lyrik von Martin Opitz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht den Einfluss des Dreißigjährigen Krieges auf die Lyrik von Martin Opitz, insbesondere auf seine "Trostgedichte in Widerwärtigkeit des Krieges". Der Fokus liegt auf der Analyse des Verhältnisses von Realität und Fiktion in Opitz' Darstellung des Krieges und seiner Rolle als Zeitzeuge.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Dreißigjährigen Krieg als historischen und literarischen Kontext, Martin Opitz' persönliche Erfahrungen und seine literarische Reaktion auf den Krieg, eine detaillierte Analyse der "Trostgedichte" im Hinblick auf Realismus und Fiktion, die Rezeption des Krieges in der Gegenwartsliteratur und Opitz' mögliche Rolle als politischer Stratege.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zum Einfluss des Dreißigjährigen Krieges auf Opitz' Lyrik und eine Zusammenfassung. Das Hauptkapitel umfasst einen historischen Überblick über den Dreißigjährigen Krieg, eine Analyse von Opitz' Leben und Werk im Kontext des Krieges und eine detaillierte Untersuchung seiner "Trostgedichte".
Welche Aspekte des Dreißigjährigen Krieges werden beleuchtet?
Die Arbeit beleuchtet die Ursachen des Krieges (religiöse Konflikte und politische Machtkämpfe), seinen Verlauf, von den Anfängen bis zum Westfälischen Frieden, und die Auswirkungen auf die Bevölkerung, insbesondere auf Opitz selbst.
Wie wird die Rolle Martin Opitz' betrachtet?
Opitz' Rolle wird sowohl als Zeitzeuge und Dichter, der seine Kriegserfahrungen literarisch verarbeitet, als auch als möglicher politischer Stratege, der seine Stellung am Hof nutzte, untersucht. Die Arbeit analysiert, wie seine persönlichen Erfahrungen mit Flucht und Vertreibung seine Lyrik prägten.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist, inwieweit Opitz' Werk die Realität des Dreißigjährigen Krieges widerspiegelt und wie die Gegenwartsliteratur dieses historische Ereignis rezipiert. Dies wird insbesondere anhand der Analyse der "Trostgedichte" untersucht.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet literaturwissenschaftliche Methoden, um Opitz' "Trostgedichte" zu analysieren. Sie vergleicht die darin enthaltenen Schilderungen der Kriegswirklichkeit mit historischen Quellen, um das Verhältnis von Realismus und Fiktion zu ermitteln. Die Arbeit bezieht auch die Rezeption des Dreißigjährigen Krieges in der Gegenwartsliteratur mit ein.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Dreißigjähriger Krieg, Barockliteratur, Martin Opitz, Trostgedichte, Realismus, Fiktion, Zeitzeugenschaft, Kriegserfahrung, Literatur und Geschichte, politische Strategien, humanistische Ideale.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Welchen Einfluss hatte der 30-jährige Krieg auf das luterarische Werk von Martin Opitz?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/470636