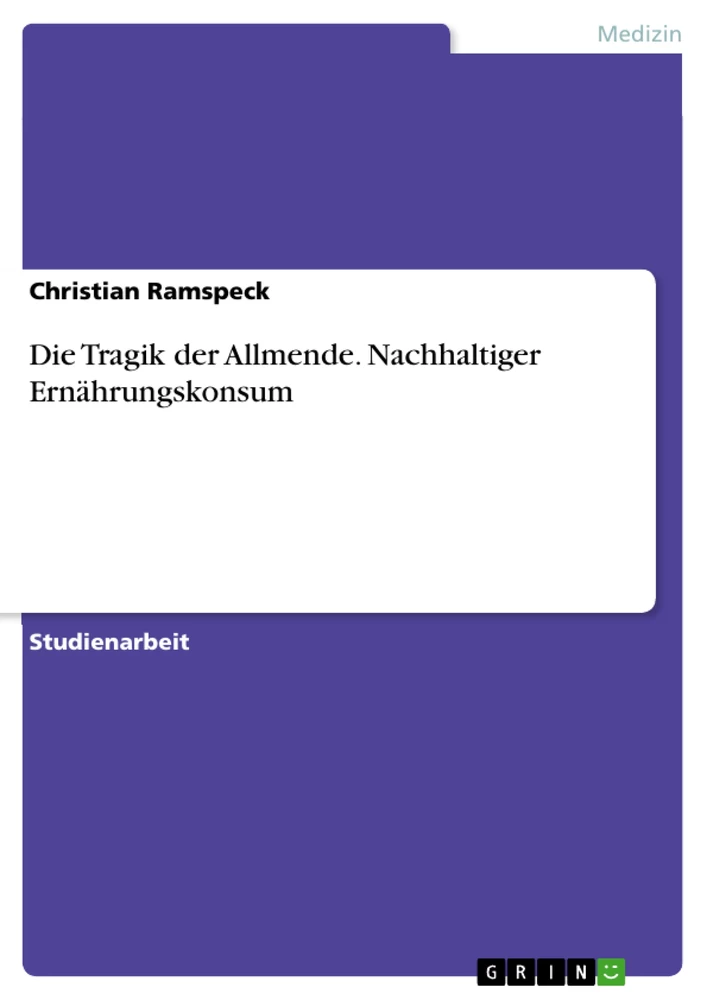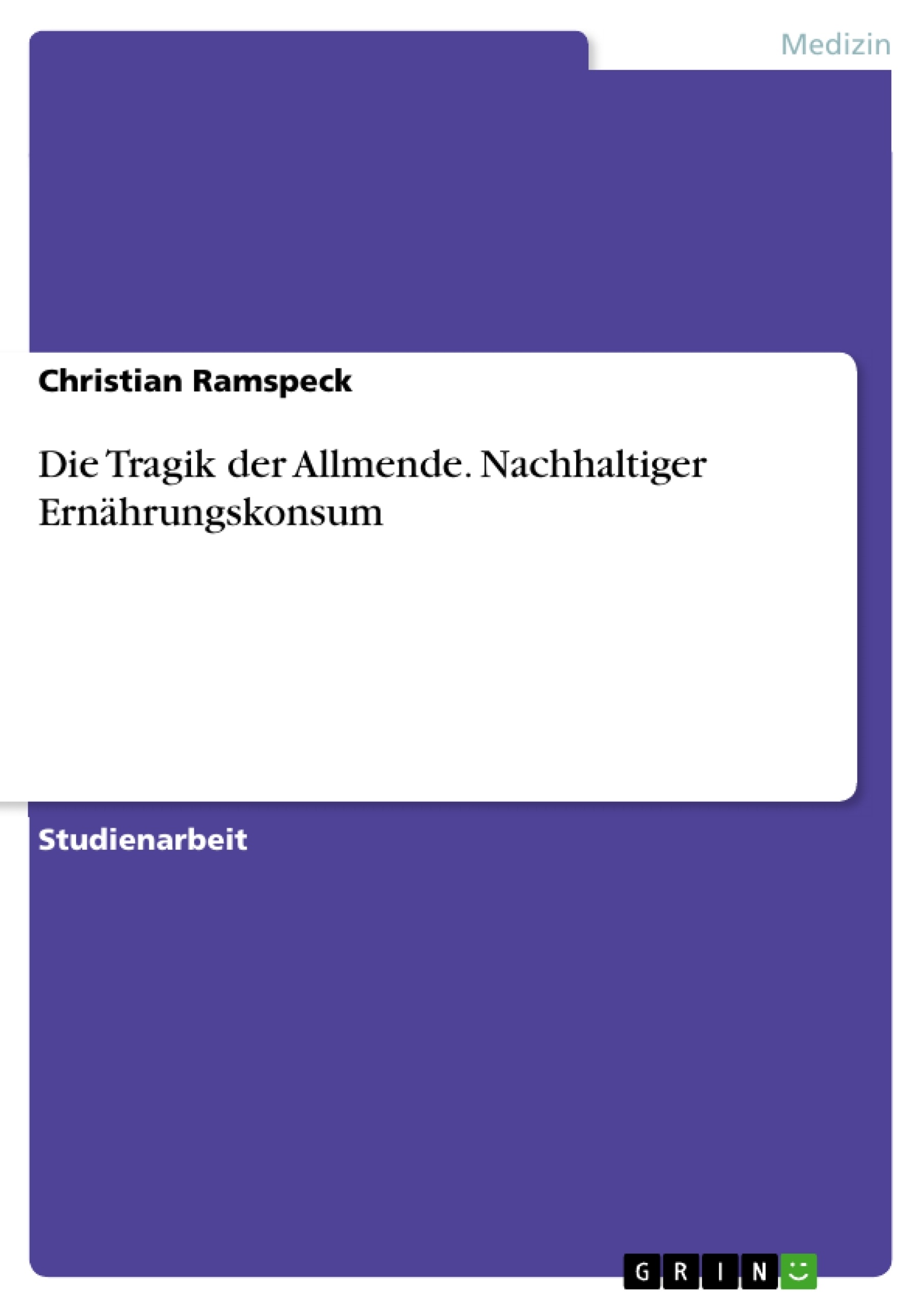Was heißt Nachhaltigkeit? Und wie lässt sich dies in Bezug auf den Konsum verdeutlichen?
In dieser Arbeit wird ein nachhaltiger Ernährungskonsum am Beispiel der Tragik der Allmende analysiert. Dabei wird mich folgende vergleichend-deskriptive Forschungsfrage leiten: Wie lässt sich die Bedeutung eines nachhaltigen Ernährungskonsums am Beispiel der Tragik der Allmende beschreiben?
Im Folgenden werde ich dem Konzept der Nachhaltigkeit normativ zu Grunde gehen, indem ich den Begriff und dessen Bedeutung definiere und anschließend auf die Rolle der Sustainable Development Goals (SDGs) eingehe.
Anschließend werden die Merkmale einer nachhaltigen Ernährung analysiert, um danach die Relevanz eines nachhaltigen Ernährungskonsums anhand der Theorie der Tragik der Allmende zu konkretisieren.
Der Begriff der Nachhaltigkeit wird immer häufiger verwendet, sowohl in der Wissenschaft, in der Politik, als auch im Alltag. Nicht nur Konsumenten und Verbraucher beschäftigen sich mit einer nachhaltigen Entwicklung bzw. mit einem nachhaltigen Konsum, auch immer mehr Unternehmen versuchen dieses Konzept für sich zu proklamieren.
In der Tat sehen sich Zivilgesellschaften mit der grundsätzlichen Problematik konfrontiert, mit begrenzten Ressourcen zu haushalten und dabei nicht mehr zu konsumieren, als erwirtschaftet werden kann. Gleichzeitig spielt die demographische Komponente mit: Laut sämtlichen Prognosen wird die Weltbevölkerung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten steigen, wenn auch asymmetrisch.
So scheint es, dass die Bevölkerungsanzahl beispielsweise im Kontinent Europa zurückgehen, aber diese im asiatischen oder indischen Raum steigen wird. Im Bereich der nachhaltigen Entwicklung stellt der nachhaltige Konsum somit ein entscheidendes Element dar, um die Zukunftsfähigkeit des Lebens aller Menschen nicht zu gefährden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Nachhaltigkeit im Ernährungskonsum am Beispiel der Tragik der Allmende
- Nachhaltigkeit als normatives Konzept
- Bedeutung und Definition von Nachhaltigkeit
- Funktion der Sustainable Development Goals
- Nachhaltige Ernährung
- Die Relevanz der Nachhaltigkeit im Ernährungskonsum am Beispiel der Tragik der Allmende
- Nachhaltigkeit als normatives Konzept
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert nachhaltigen Ernährungskonsum im Kontext der Tragik der Allmende. Das Hauptziel besteht darin, die Bedeutung nachhaltigen Ernährungskonsums anhand dieses Beispiels zu beschreiben. Die Arbeit geht dabei einer vergleichend-deskriptiven Forschungsfrage nach.
- Definition und Bedeutung von Nachhaltigkeit
- Rolle der Sustainable Development Goals (SDGs)
- Merkmale nachhaltiger Ernährung
- Tragik der Allmende als Bezugspunkt für nachhaltigen Konsum
- Anwendung des Nachhaltigkeitskonzepts auf den Ernährungskonsum
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des nachhaltigen Konsums ein und hebt die wachsende Bedeutung des Begriffs in Wissenschaft, Politik und Alltag hervor. Sie verdeutlicht die Herausforderung des Wirtschaftens mit begrenzten Ressourcen im Angesicht steigender Bevölkerungszahlen und formuliert die zentrale Forschungsfrage: Wie lässt sich die Bedeutung eines nachhaltigen Ernährungskonsums am Beispiel der Tragik der Allmende beschreiben? Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und kündigt die normative Auseinandersetzung mit dem Nachhaltigkeitsbegriff an.
Nachhaltigkeit im Ernährungskonsum am Beispiel der Tragik der Allmende: Dieses Kapitel beginnt mit einer Definition von Nachhaltigkeit, differenziert zwischen „nachhaltiger Entwicklung“ und „Nachhaltigkeit“ und beleuchtet den historischen Ursprung des Begriffs. Es analysiert die Bedeutung und Definition von Nachhaltigkeit, verweist auf die Rolle der 17 SDGs und untersucht die Merkmale nachhaltiger Ernährung. Der zentrale Teil des Kapitels widmet sich der Konkretisierung der Relevanz nachhaltigen Ernährungskonsums anhand der Theorie der Tragik der Allmende. Die historische Entwicklung des Nachhaltigkeitsbegriffs von der Forstwirtschaft über den Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ bis zur Brundtland-Kommission wird detailliert dargestellt. Die drei Grundprinzipien der nachhaltigen Entwicklung – globale Perspektive, untrennbare Verknüpfung von Umwelt- und Entwicklungsaspekten sowie Gerechtigkeit – werden erläutert. Die Arbeit verweist auf wichtige Meilensteine wie die UN-Konferenz in Rio de Janeiro und den Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg. Schließlich werden die drei grundlegenden Prämissen für die Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung – Generationengerechtigkeit, Verantwortung für die Gegenwart und Verteilungsgerechtigkeit – prägnant zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Nachhaltigkeit, Ernährungskonsum, Tragik der Allmende, Sustainable Development Goals (SDGs), Generationengerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, Ressourcenknappheit, nachhaltige Entwicklung, Konsumverhalten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Nachhaltiger Ernährungskonsum im Kontext der Tragik der Allmende
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert nachhaltigen Ernährungskonsum im Kontext der Tragik der Allmende. Das Hauptziel ist die Beschreibung der Bedeutung nachhaltigen Ernährungskonsums anhand dieses Beispiels mittels einer vergleichend-deskriptiven Forschungsfrage.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Bedeutung von Nachhaltigkeit, die Rolle der Sustainable Development Goals (SDGs), Merkmale nachhaltiger Ernährung, die Tragik der Allmende als Bezugspunkt für nachhaltigen Konsum und die Anwendung des Nachhaltigkeitskonzepts auf den Ernährungskonsum.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel („Nachhaltigkeit im Ernährungskonsum am Beispiel der Tragik der Allmende“) und ein Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und formuliert die zentrale Forschungsfrage. Das Hauptkapitel definiert Nachhaltigkeit, beleuchtet die SDGs, untersucht Merkmale nachhaltiger Ernährung und analysiert die Tragik der Allmende im Kontext nachhaltigen Ernährungskonsums. Die historische Entwicklung des Nachhaltigkeitsbegriffs wird detailliert dargestellt.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in die Thematik des nachhaltigen Konsums ein, hebt dessen wachsende Bedeutung hervor, verdeutlicht die Herausforderung des Wirtschaftens mit begrenzten Ressourcen und formuliert die zentrale Forschungsfrage. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und kündigt die normative Auseinandersetzung mit dem Nachhaltigkeitsbegriff an.
Was beinhaltet das Kapitel „Nachhaltigkeit im Ernährungskonsum am Beispiel der Tragik der Allmende“?
Dieses Kapitel definiert Nachhaltigkeit, differenziert zwischen „nachhaltiger Entwicklung“ und „Nachhaltigkeit“, beleuchtet den historischen Ursprung des Begriffs und analysiert die Bedeutung und Definition von Nachhaltigkeit. Es verweist auf die Rolle der 17 SDGs, untersucht Merkmale nachhaltiger Ernährung und konkretisiert die Relevanz nachhaltigen Ernährungskonsums anhand der Theorie der Tragik der Allmende. Die historische Entwicklung des Nachhaltigkeitsbegriffs wird detailliert dargestellt, inklusive der drei Grundprinzipien nachhaltiger Entwicklung und wichtiger Meilensteine wie der UN-Konferenz in Rio und dem Weltgipfel in Johannesburg.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Nachhaltigkeit, Ernährungskonsum, Tragik der Allmende, Sustainable Development Goals (SDGs), Generationengerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, Ressourcenknappheit, nachhaltige Entwicklung, Konsumverhalten.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie lässt sich die Bedeutung eines nachhaltigen Ernährungskonsums am Beispiel der Tragik der Allmende beschreiben?
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichend-deskriptive Forschungsmethode.
- Quote paper
- Christian Ramspeck (Author), 2018, Die Tragik der Allmende. Nachhaltiger Ernährungskonsum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/470780