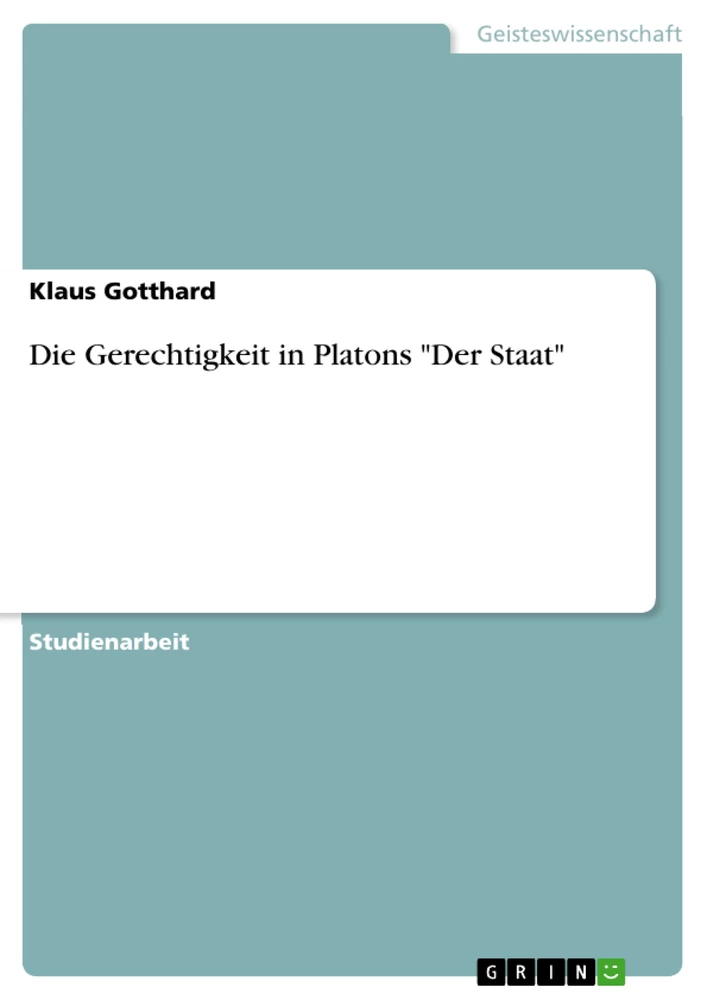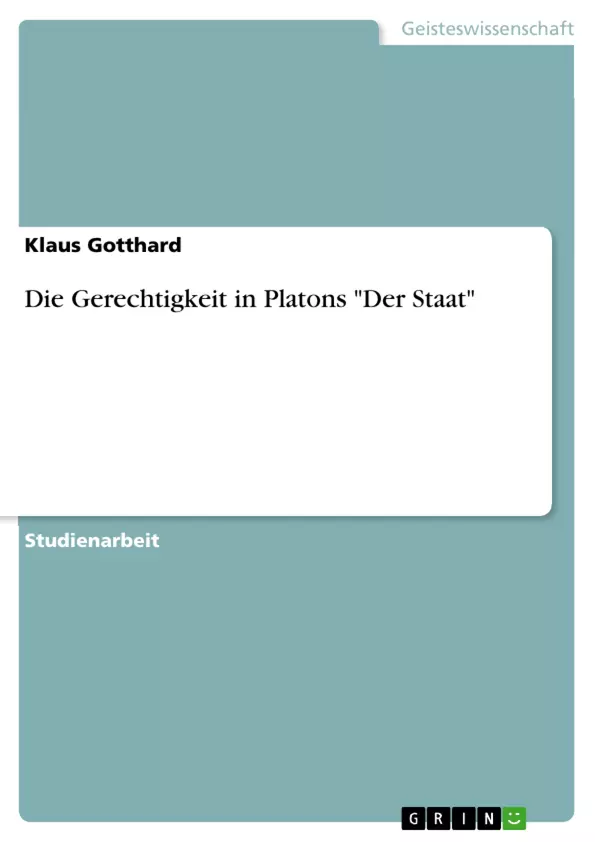In dieser Arbeit werden die Thesen und Argumente des ersten Buches von Platons "Der Staat" dargestellt und kritisch analysiert. Im Fokus stehen dabei die Thesen von Thrasymachos zur Frage nach Gerechtigkeit und Platons Erwiderungen, die durch den im Buch auftretenden Protagonisten Sokrates geäußert werden.
Strukturell werden in dieser Arbeit jeweils einzelne Passagen aus dem ersten Buch inhaltlich dargestellt und direkt im Anschluss gestützt durch Sekundärliteratur kritisch analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Skizzierung der vorher stattfindenden Diskussion um Gerechtigkeit............
- Thrasymachos' Ausgangsthese.
- Gerechtigkeit ist der Vorteil des Stärkeren.
- Rekonstruktion von Thrasymachos' Ausgangsthese........
- Analyse von Thrasymachos' Ausgangsthese.
- Sokrates' erster Einwand
- Rekonstruktion von Sokrates' erstem Einwand
- Analyse von Sokrates' erstem Einwand.
- Thrasymachos' erster Gegeneinwand
- Rekonstruktion von Thrasymachos' erstem Gegeneinwand..
- Analyse von Thrasymachos' erstem Gegeneinwand
- Sokrates' zweiter Einwand gegen Thrasymachos' Ausgangsthese
- Rekonstruktion von Sokrates' zweitem Einwand
- Analyse von Sokrates' zweitem Einwand.
- Thrasymachos Gerechtigkeitskritik.
- Rekonstruktion von Thrasymachos' Gerechtigkeitskritik
- Analyse von Thrasymachos' Gerechtigkeitskritik.
- Sokrates Einwände gegen Thrasymachos' Gerechtigkeitskritik..
- Das Pleonexie-Argument
- Rekonstruktion des Pleonexie-Arguments.
- Analyse des Pleonexie-Arguments
- Das Kooperationsargument......
- Rekonstruktion des Kooperationsarguments.....
- Analyse des Kooperationsarguments
- Das Ergon-Argument.
- Rekonstruktion des Ergon-Arguments..
- Analyse des Ergon-Arguments..
- Das Pleonexie-Argument
- Fazit..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den Thesen und Argumenten des ersten Buches von Platons "Der Staat" und analysiert diese kritisch. Im Zentrum stehen die Thesen von Thrasymachos zur Gerechtigkeit und Platons Erwiderungen, die durch den fiktiven Protagonisten Sokrates geäußert werden. Die Arbeit analysiert verschiedene Argumentationslinien und verdeutlicht die Komplexität der Debatte um Gerechtigkeit in Platons "Der Staat".- Die Definition von Gerechtigkeit und ihre Bedeutung für die Gesellschaft
- Die Frage nach der Macht und ihren Auswirkungen auf die Auslegung von Gerechtigkeitsvorstellungen
- Die Rolle von Argumentation und Gegenargumentation in der philosophischen Auseinandersetzung
- Die Rekonstruktion und Analyse von Platons philosophischen Ansätzen
- Die Verbindung von Theorie und Praxis im Kontext der politischen Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Kontext und die Ziele der Hausarbeit vor und skizziert kurz die Argumentationsstruktur des ersten Buches von Platons "Der Staat".
- Kapitel 2 beschreibt die Einleitung der Debatte um Gerechtigkeit durch Kephalos und Polemarchos und deren Kritik durch Sokrates.
- Kapitel 3 analysiert die Ausgangsthese von Thrasymachos, die besagt, dass Gerechtigkeit der Vorteil des Stärkeren ist.
- Kapitel 4 untersucht Sokrates' ersten Einwand gegen Thrasymachos' These und die darauf folgende Entgegnung von Thrasymachos.
- Kapitel 5 betrachtet Sokrates' zweite Kritik an Thrasymachos' Gerechtigkeitsverständnis und analysiert die Argumente des Pleonexie-, Kooperations- und Ergon-Arguments.
Schlüsselwörter
Platon, "Der Staat", Gerechtigkeit, Thrasymachos, Sokrates, Philosophie, Politik, Macht, Argumentation, Gegenargumentation, Rekonstruktion, Analyse, Pleonexie-Argument, Kooperationsargument, Ergon-Argument.
Excerpt out of 14 pages
- scroll top
- Quote paper
- Klaus Gotthard (Author), 2016, Die Gerechtigkeit in Platons "Der Staat", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/470956
Look inside the ebook