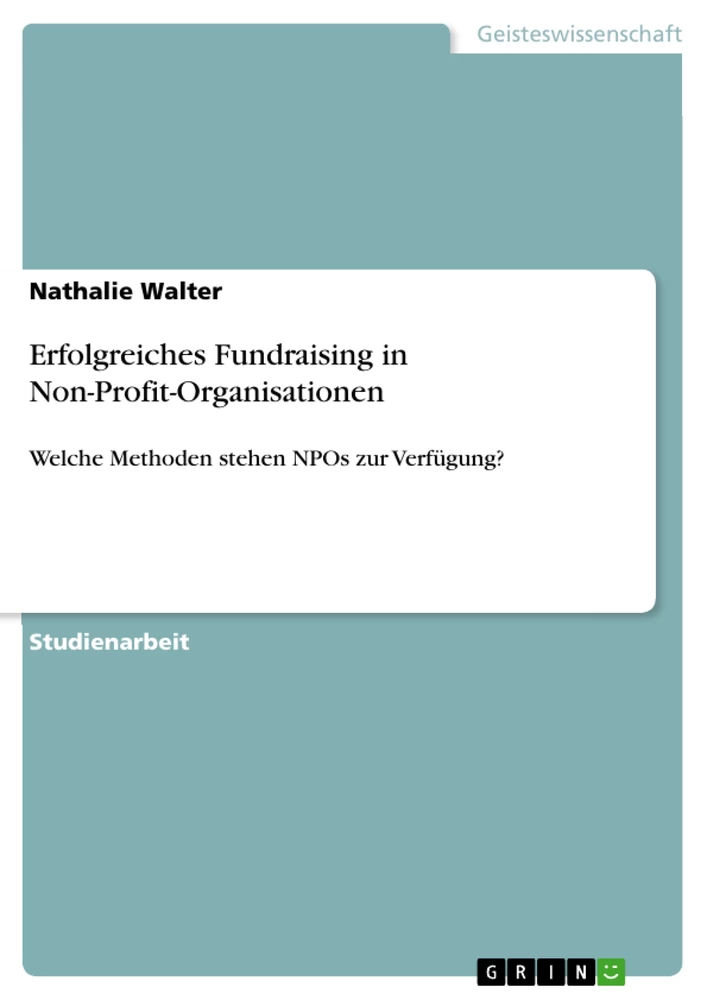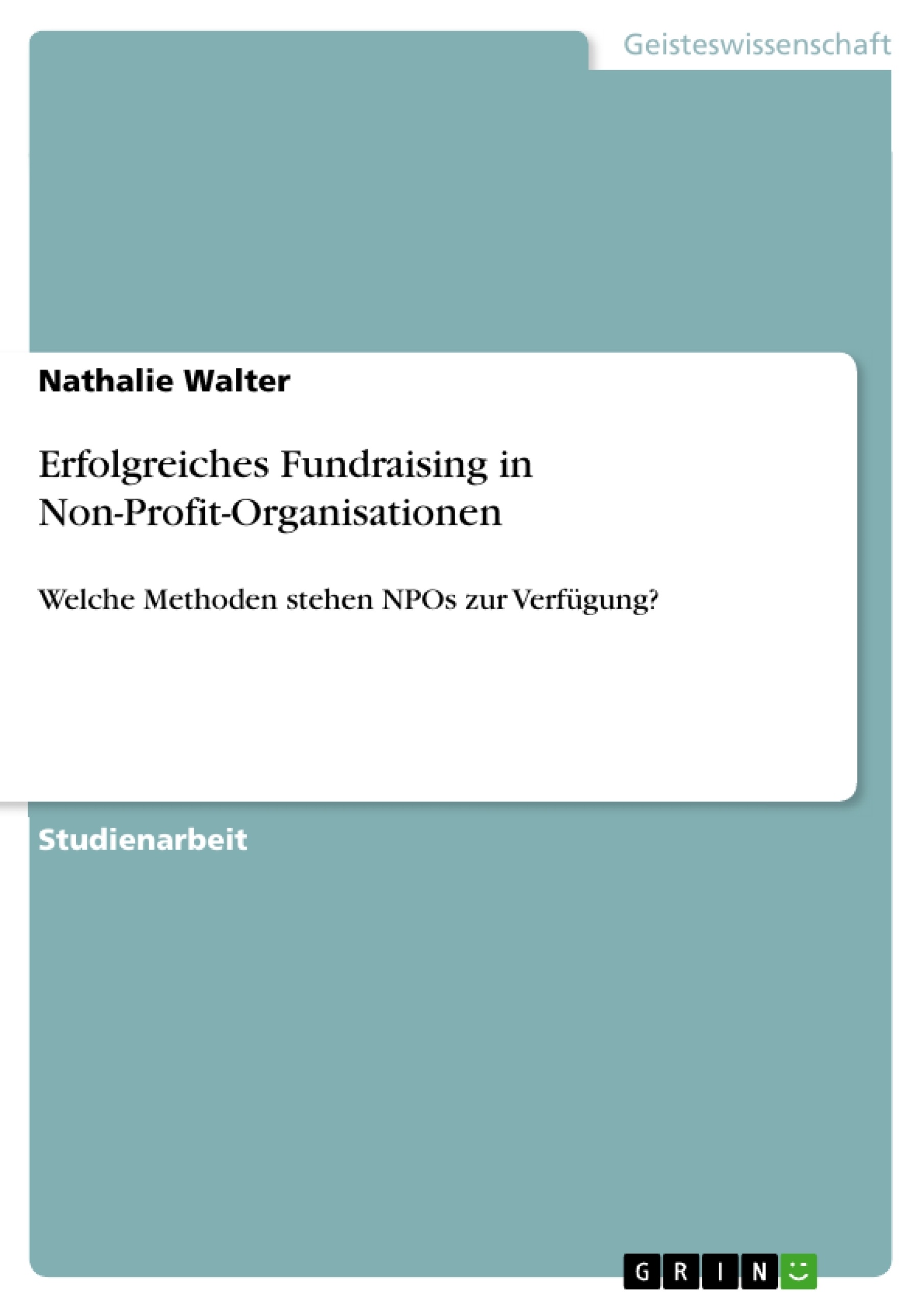Diese Ausarbeitung konzentriert sich auf Methoden des Fundraisings in Non-Profit-Organisationen und bezieht sich vorrangig auf Geldgeber*innen als Privatpersonen. Es ist damit zusammenhängend spannend und wichtig zu ermitteln, unter welchen Umständen und für welche Zwecke Bürger*innen sich dazu entschließen, eine Organisation in Form von Geld zu unterstützen. Ziel dieser Seminararbeit ist es, zu beantworten, wie erfolgreiches Fundraising in Non-Profit-Organisationen in Bezug auf Privatpersonen funktionieren kann.
Immer häufiger befinden sich gemeinnützige Träger der Sozialen Arbeit zwischen der Kürzung staatlicher und kommunaler Subventionen und einer gleichzeitig steigenden Nachfrage nach sozialen Dienstleistungen. Wenn der Staat sich immer mehr aus finanziellen Angelegenheiten, die den Dritten Sektor betreffen, zurückzieht, müssen soziale Unternehmen zwangsläufig lernen umzudenken und neue Finanzierungsquellen erschließen. In Zeiten zunehmender Ökonomisierung auch von sozialen Dienstleistungen kommen alternativen nicht-öffentlichen Finanzierungsmöglichkeiten damit eine immer größere Bedeutung zu, was sich auch in der immensen Anzahl an aktueller Literatur niederschlägt, die sich zu diesem Thema finden lässt.
Die Arbeit gliedert sich in die zwei zentralen Begriffe Non-Profit-Organisation und Fundraising und widmet sich danach detaillierteren Verfahren zur Spendenakquisition. In einem ersten Schritt sollen die besonderen Merkmale von Non-Profit-Organisationen und ihr Auftrag vorgestellt werden. Daraufhin folgt eine Begriffserklärung von Fundraising und eine Vorstellung ihrer Adressat*innen und grundlegenden Empfehlungen. Danach folgen zentrale Strategien und Methoden, die sich als geeignet für Non-Profit-Organisationen herausgestellt haben. Am Ende findet eine kritische Reflexion zum Thema statt und es wird ein Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Rahmenbedingungen von Non-Profit-Organisationen
- 2. Grundlagen von Fundraising
- 2.1 Begriffsdefinition
- 2.2 Grundsätzliche Empfehlungen für erfolgreiches Fundraising
- 2.3 Adressat*innen und die Rolle von Marketingstrategien
- 3. Methoden zur Spendenakquisition von Privatpersonen
- 3.1 Marktforschung
- 3.2 Direct Mailing
- 3.3 Direct Dialog
- 3.4 Telefonkommunikation
- 3.5 Online-Fundraising
- 4. Langfristige Spenderbindung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Thema Fundraising in Non-Profit-Organisationen, insbesondere in Bezug auf die Gewinnung von Spenden von Privatpersonen. Der Fokus liegt dabei auf der Beantwortung der Frage, wie erfolgreiches Fundraising in Bezug auf Privatpersonen funktionieren kann. Die Arbeit analysiert die Rahmenbedingungen von Non-Profit-Organisationen, definiert den Begriff Fundraising und erläutert grundlegende Empfehlungen für erfolgreiches Fundraising. Sie stellt verschiedene Methoden zur Spendenakquisition von Privatpersonen vor, wie beispielsweise Marktforschung, Direct Mailing, Direct Dialog, Telefonkommunikation und Online-Fundraising.
- Rahmenbedingungen von Non-Profit-Organisationen
- Begriffsdefinition und Bedeutung von Fundraising
- Grundlegende Empfehlungen für erfolgreiches Fundraising
- Methoden zur Spendenakquisition von Privatpersonen
- Langfristige Spenderbindung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Fundraisings in Non-Profit-Organisationen ein und erläutert den Hintergrund der steigenden Bedeutung von alternativen Finanzierungsquellen im Kontext der sozialen Arbeit. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit den Rahmenbedingungen von Non-Profit-Organisationen und stellt ihre Merkmale, Aufgaben und Finanzierungsmöglichkeiten vor. Das zweite Kapitel befasst sich mit den Grundlagen des Fundraisings, definiert den Begriff, stellt grundlegende Empfehlungen für erfolgreiches Fundraising vor und analysiert die Motivation von potentiellen Spender*innen.
Schlüsselwörter
Non-Profit-Organisationen, Fundraising, Spendenakquisition, Privatpersonen, Marketingstrategien, Spendendermotivation, Social Media, Online-Fundraising, Marktforschung, Direct Mailing, Direct Dialog, Telefonkommunikation, Langfristige Spenderbindung.
- Quote paper
- Nathalie Walter (Author), 2018, Erfolgreiches Fundraising in Non-Profit-Organisationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/470972