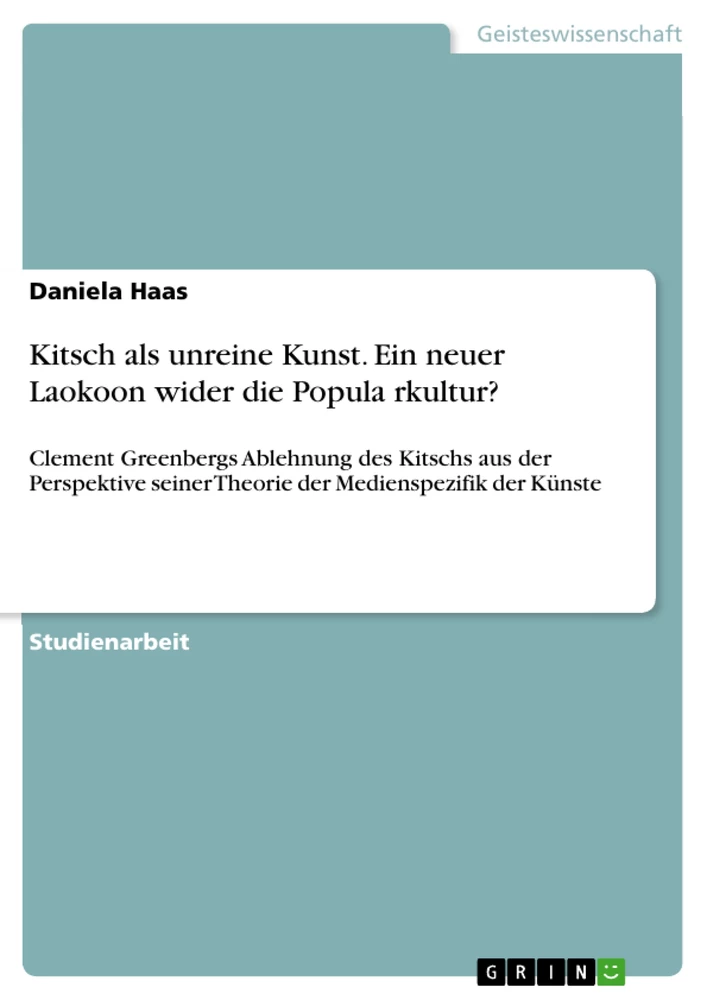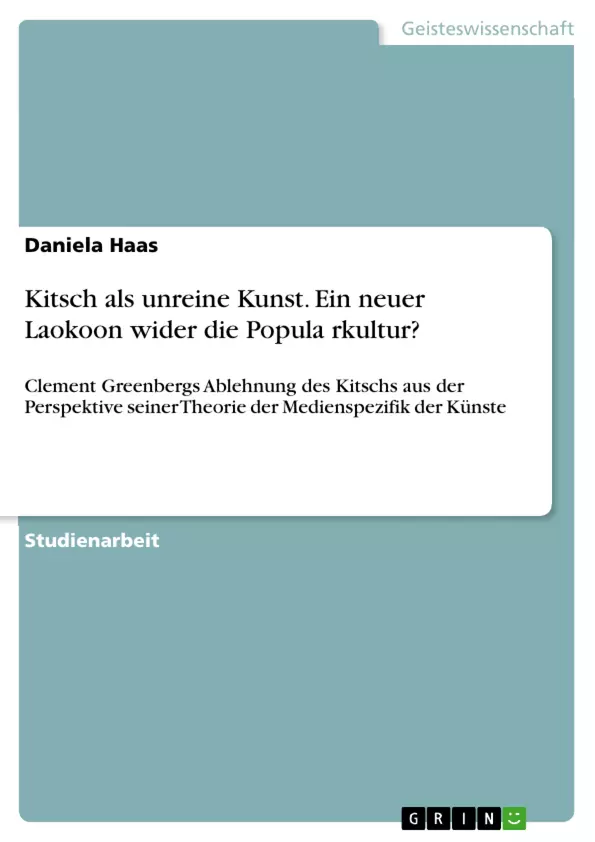Im Jahr 1939 konstatierte der US-amerikanische Kunstkritiker Clement Greenberg den Niedergang der westlichen Gesellschaft und Kultur. Als dessen wesentliche Merkmale sah er einerseits den zeitgenössischen Zustand der Kunst, vielmehr aber noch die Macht eines neuen Kulturphänomens, nämlich des Kitschs. Was genau veranlasste den Kritiker jedoch zu einer solchen Geringschätzung der Populärkultur?
Die Untersuchung von Greenbergs Urteil über die Populärkultur erfolgt in zwei Abschnitten. In einem ersten Schritt wird die Theorie der Medienspezifik der Künste beleuchtet. Hierzu wird zunächst ein Abriss der Theorie Lessings in ihren Grundzügen gegeben. Anschließend wird Greenbergs Konzept dargestellt und mit Lessings "Laokoon" verglichen. Hier gilt es zu untersuchen, in welchen Punkten Greenberg mit seinem Vorgänger übereinstimmt und welche Aspekte er innovativ entwickelt.
Auf Basis des gewonnenen Wissens werden anschließend in einem zweiten Schritt Greenbergs Aussagen zu Massenkultur und Avantgardekunst aus dem Aufsatz "Avantgarde und Kitsch" (1939) ausführlich beleuchtet, um zu ermitteln, ob seine negative Haltung gegenüber dem Kitsch beziehungsweise der populären Kultur darin gründet, dass deren Künste im Gegensatz zu jenen der Avantgarde die Grenzen ihrer medienspezifischen Gestaltungsmöglichkeiten überschreiten und infolgedessen als "unreine Künste" einzustufen sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Medienspezifik der Künste – Lessing versus Greenberg
- Gotthold Ephraim Lessings „Laokoon“: Die Gesetze medienspezifischer Mimesis
- Wesen und Regeln der Malerei
- Wesen und Regeln der Poesie
- Clement Greenberg: Ein dynamisches Entwicklungsmodell der Kunstgeschichte
- Der experimentelle Weg zur reinen Kunst
- Warum gerade Abstraktion? Selbstbereinigung als historisches Telos
- Wirklich ein, neuer Laokoon'?
- Greenberg und die Populärkultur
- Die Avantgarde: Bastion der Hochkultur
- Kitsch als niedere Kunstform
- Eine vielfältige Bedrohung für Kultur und Gesellschaft
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Clement Greenbergs Ablehnung der Populärkultur aus der Perspektive seiner Theorie der Medienspezifik der Künste. Ziel ist es, Greenbergs Kritik am Kitsch im Kontext seiner kunsttheoretischen Schriften zu beleuchten und zu ergründen, ob seine Ablehnung der Populärkultur aus der Überzeugung resultiert, dass deren Künste die Grenzen der medienspezifischen Gestaltungsmöglichkeiten überschreiten und daher als "unreine" Künste einzustufen sind.
- Greenbergs Theorie der Medienspezifik der Künste im Vergleich zu Lessings "Laokoon"
- Die Rolle der Avantgarde in Greenbergs Kulturkritik
- Die Definition von Kitsch als niedere Kunstform
- Die Folgen von Kitsch für die Kultur und Gesellschaft
- Die Kritik an der Populärkultur aus der Perspektive der "reinen Kunst"
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Ausgangssituation dar, in der Greenberg die westliche Kultur im Kontext der Populärkultur und der Avantgardekunst sieht. Kitsch wird als "Inbegriff alles Unechten" eingeführt, während die Avantgarde den Erhalt der "wahren Kultur" durch eine Kunst hohen Niveaus anstrebt. Greenbergs Theorie der Medienspezifik der Künste wird als Grundlage für die Analyse der Populärkultur vorgestellt.
- Die Medienspezifik der Künste - Lessing versus Greenberg: Dieses Kapitel widmet sich der Theorie der Medienspezifik der Künste und vergleicht die Ansätze von Lessing und Greenberg. Lessings "Laokoon" wird als Ausgangspunkt für die Diskussion über die medienspezifische Gestaltung von Malerei und Poesie vorgestellt. Greenbergs Konzept wird in seinen beiden zentralen Schriften "Zu einem neueren Laokoon" und "Modernistische Malerei" erläutert, wobei sein Fokus auf der Malerei liegt.
- Greenberg und die Populärkultur: Dieses Kapitel beleuchtet Greenbergs Kritik an der Populärkultur anhand seines Essays "Avantgarde und Kitsch". Es geht um die Rolle der Avantgarde als Bastion der Hochkultur und die Bedrohung, die Kitsch für diese darstellt. Der Kitsch wird als niedere Kunstform definiert und seine vielfältigen Auswirkungen auf Kultur und Gesellschaft werden untersucht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind Medienspezifik der Künste, Laokoon, Clement Greenberg, Populärkultur, Kitsch, Avantgarde, Hochkultur, Reinheit, Autonomie, Moderne Kunst. Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Greenbergs Theorie der Medienspezifik der Künste für seine Kritik an der Populärkultur und die Rolle des Kitschs als Bedrohung für die "reine Kunst".
Häufig gestellte Fragen
Wer war Clement Greenberg?
Clement Greenberg war ein einflussreicher US-amerikanischer Kunstkritiker, der besonders für seine Theorien zur modernistischen Malerei und seine Abgrenzung zwischen Avantgarde und Kitsch bekannt wurde.
Wie definiert Greenberg den Begriff "Kitsch"?
Greenberg sah im Kitsch eine minderwertige, kommerzialisierte Form der Kultur, die im Gegensatz zur anspruchsvollen Avantgarde steht und lediglich Effekte imitiert, anstatt sich mit den Medien der Kunst selbst auseinanderzusetzen.
Was ist der Kern von Lessings "Laokoon"-Theorie?
Lessing untersuchte in seinem Werk die Grenzen zwischen Malerei und Poesie und argumentierte, dass jede Kunstform ihren eigenen Gesetzen und medienspezifischen Ausdrucksmöglichkeiten folgen müsse.
Warum bezeichnet Greenberg bestimmte Künste als "unrein"?
Künste gelten als "unrein", wenn sie die Grenzen ihres eigenen Mediums überschreiten oder versuchen, Effekte anderer Kunstgattungen zu imitieren, anstatt nach "Reinheit" und Autonomie zu streben.
Welche Rolle spielt die Avantgarde laut Greenberg?
Die Avantgarde fungiert als Bastion der Hochkultur, die den Fortbestand wahrer ästhetischer Werte sichert, indem sie sich der kommerziellen Logik des Massengeschmacks entzieht.
- Citation du texte
- Daniela Haas (Auteur), 2018, Kitsch als unreine Kunst. Ein neuer Laokoon wider die Populärkultur?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/471246