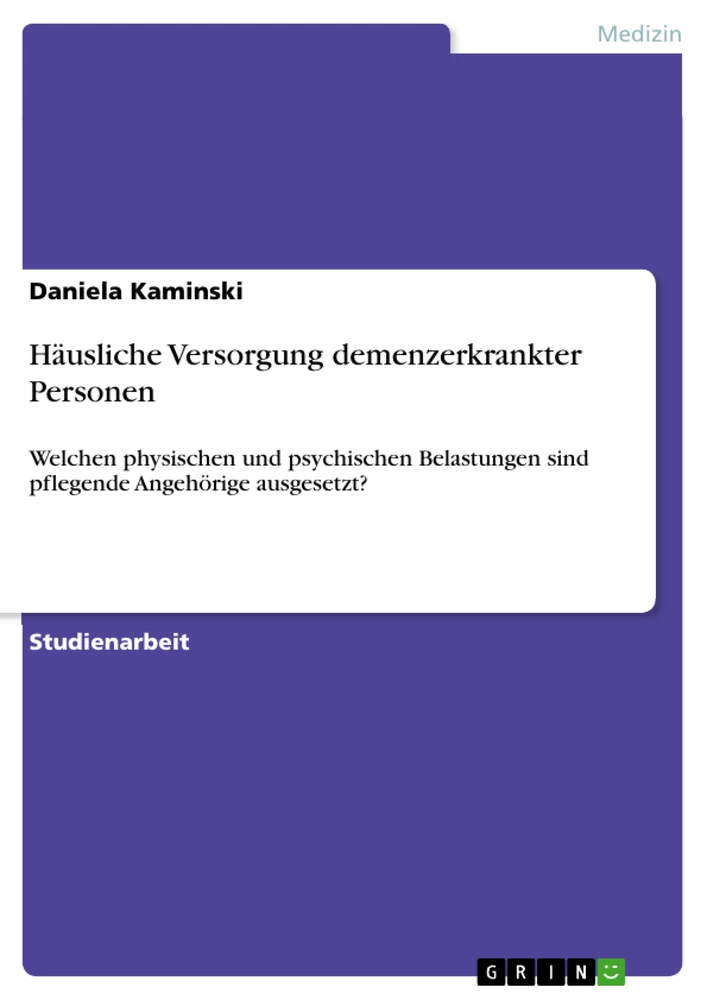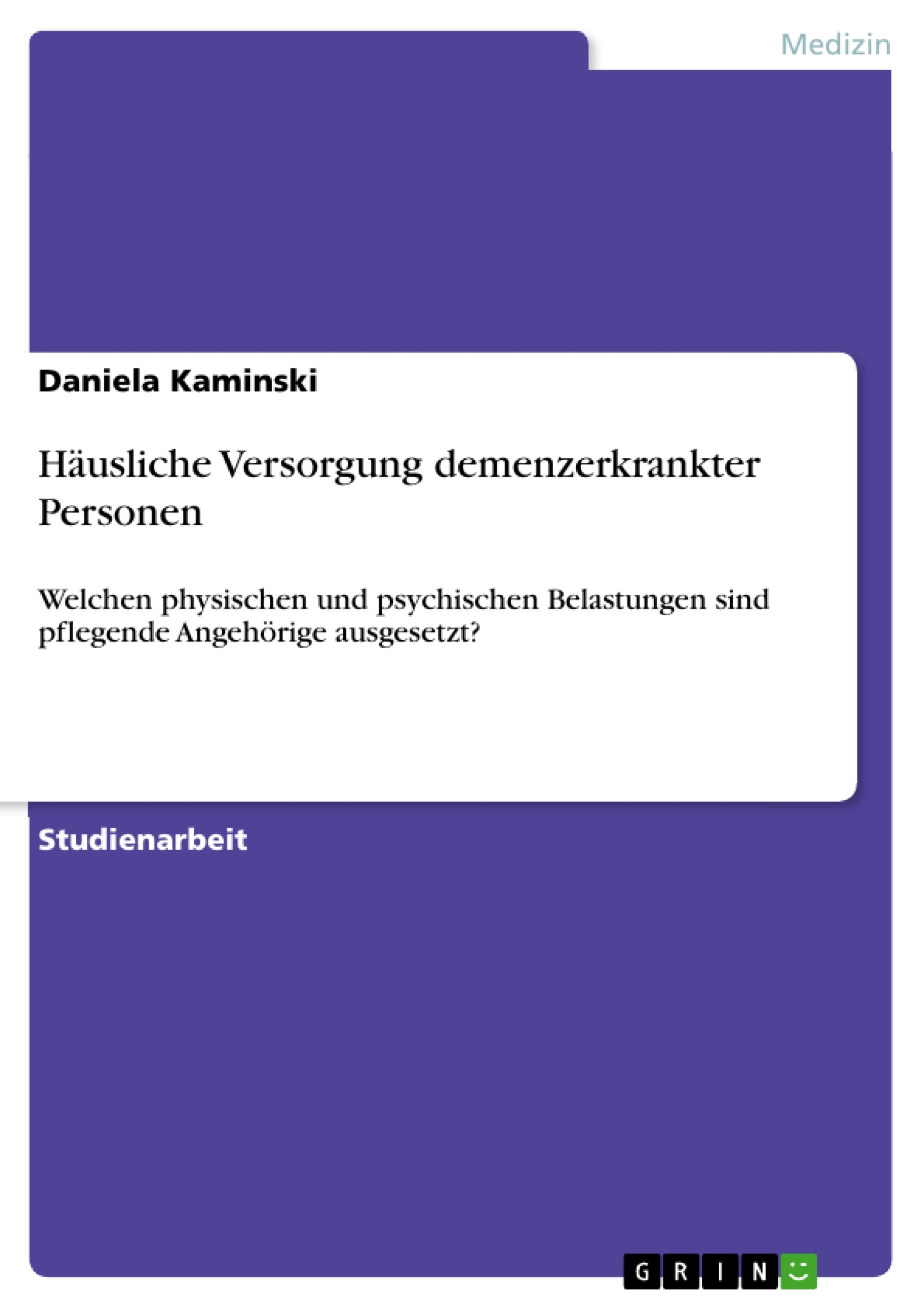Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, welchen Belastungen pflegende Angehörige ausgesetzt sind, welche Rolle eine Demenzerkrankung der zu Pflegenden dabei spielt und welche Interventionsmöglichkeiten es gibt, um diese Belastungen zu minimieren oder sogar zu verhindern. Die Pflege demenzerkrankter Personen gilt jedoch als hochbelastend, stressauslösend und zeitaufwendig. Die Gesellschaft ist daher auch mit einer wachsenden Anzahl stark seelisch, körperlich und finanziell belasteter Angehöriger konfrontiert. Pflegende Angehörige von Demenzerkrankten haben somit ein erhöhtes Risiko, von depressiven Störungen und körperlichen Gesundheitsbeeinträchtigungen betroffen zu sein.
Durch die demographische Alterung steigt die Anzahl älterer Menschen mit alters- und krankheitsbedingten Einschränkungen, welche dauerhaft auf pflegerische Versorgung angewiesen sind, stetig an. Die Pflege pflegebedürftiger Personen nimmt daher einen wichtigen Teil der gesundheitlichen Versorgung ein. Zu den Erkrankungen, die am stärksten mit einem hohen Lebensalter kollidieren, zählt die Demenzerkrankung. Demenz ist ein globales Problem, denn die Zahl der Demenzerkrankten steigt rapide an. Die durchschnittliche Krankheitsdauer bei Demenz liegt bei 3-10 Jahren, wodurch die Bedeutung pflegender Angehöriger bei der pflegerischen Versorgung verdeutlicht wird.
Aktuell gibt es ca. 3,4 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland, ca. 2,6 Millionen davon werden zuhause versorgt und ca. 1,7 Millionen allein durch pflegende Angehörige. Insgesamt sind es somit 76 % der Pflegebedürftigen, die zuhause versorgt werden, 51,7 % davon ohne professionelle Hilfe von außen. Lediglich bei 24 % sind somit keine Angehörigen an der Pflege beteiligt. Die Familie gilt als „größter Pflegedienst“ in Deutschland. Ungefähr drei bis fünf Millionen Privatpersonen sind an der Versorgung zuhause lebender Pflegebedürftiger beteiligt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Public Health Relevanz
- 2. Das Krankheitsbild Demenz
- 3. Pflegende Angehörige
- 3.1. Aufgaben und Bedeutung pflegender Angehöriger
- 3.2. Motive pflegender Angehöriger
- 4. Herausforderungen für pflegende Angehörige
- 4.1. Psychische und physische Belastungen pflegender Angehöriger
- 4.2. Besonderheiten bei der Pflege demenzerkrankter Personen
- 5. Lösungsansätze
- 5.1. Voraussetzungen für Veränderungen im Belastungserleben
- 5.2. Interventionsmöglichkeiten und Verbesserungspotenzial
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die psychischen und physischen Belastungen, denen pflegende Angehörige in der häuslichen Versorgung demenzerkrankter Personen ausgesetzt sind. Ziel ist es, die Ursachen dieser Belastungen zu ergründen, die Rolle der Demenzerkrankung dabei zu beleuchten und mögliche Interventionsansätze zur Minimierung oder Vermeidung dieser Belastungen aufzuzeigen.
- Psychische und physische Belastungen pflegender Angehöriger
- Einfluss der Demenzerkrankung auf die Belastungssituation
- Interventionsmöglichkeiten zur Belastungsreduktion
- Relevanz des Themas im Kontext des demografischen Wandels
- Herausforderungen und Chancen für die gesundheitliche Versorgung
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Relevanz des Themas "Pflegende Angehörige demenzerkrankter Personen" im Kontext der demografischen Entwicklung in Deutschland erläutert. Kapitel zwei widmet sich der Demenz als Krankheitsbild und beschreibt die Symptome, die mit der Erkrankung einhergehen.
Kapitel drei fokussiert auf die Aufgaben und die Bedeutung pflegender Angehöriger in der häuslichen Versorgung und beleuchtet die Motive, die Menschen dazu bewegen, Angehörige zu pflegen. Im vierten Kapitel werden die Herausforderungen für pflegende Angehörige im Detail betrachtet, insbesondere die psychischen und physischen Belastungen, denen sie ausgesetzt sind. Besonderheiten bei der Pflege demenzerkrankter Personen werden ebenfalls beleuchtet.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit Lösungsansätzen, um die Belastungen pflegender Angehöriger zu reduzieren. Voraussetzungen für Veränderungen im Belastungserleben sowie Interventionsmöglichkeiten und Verbesserungspotenziale werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Pflegende Angehörige, Demenz, Demenzerkrankung, häusliche Versorgung, psychische Belastung, physische Belastung, Interventionsmöglichkeiten, Gesundheitsversorgung, demografischer Wandel, Pflegebedürftigkeit, Sozialgesetzbuch XI.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Pflegebedürftige werden in Deutschland zu Hause versorgt?
Von den ca. 3,4 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden etwa 2,6 Millionen (76 %) zu Hause versorgt. Rund 1,7 Millionen davon erhalten die Pflege allein durch Angehörige ohne professionelle Hilfe.
Welchen speziellen Belastungen sind Angehörige von Demenzerkrankten ausgesetzt?
Die Pflege gilt als hochbelastend und zeitaufwendig. Angehörige tragen ein erhöhtes Risiko für depressive Störungen, physische Erschöpfung und finanzielle Einbußen aufgrund der intensiven Betreuung über viele Jahre hinweg.
Warum wird die Familie als „größter Pflegedienst“ Deutschlands bezeichnet?
Da über die Hälfte aller Pflegebedürftigen ausschließlich durch Familienmitglieder versorgt wird und insgesamt etwa drei bis fünf Millionen Privatpersonen in die häusliche Pflege involviert sind, stellt die familiäre Pflege die tragende Säule des Systems dar.
Was sind die typischen Motive für die häusliche Pflege durch Angehörige?
Häufige Motive sind emotionale Verbundenheit, Pflichtgefühl, das Versprechen, den Angehörigen nicht in ein Heim zu geben, sowie moralische und gesellschaftliche Erwartungen.
Welche Interventionsmöglichkeiten gibt es zur Entlastung der Pflegenden?
Möglichkeiten zur Entlastung umfassen Beratungsangebote, Schulungen für den Umgang mit Demenz, Inanspruchnahme von Pflegesachleistungen, Verhinderungspflege sowie psychologische Unterstützung zur Stressbewältigung.
Wie lange dauert eine Demenzerkrankung im Durchschnitt?
Die durchschnittliche Krankheitsdauer liegt bei 3 bis 10 Jahren, was die langfristige zeitliche und psychische Bindung der pflegenden Angehörigen verdeutlicht.
- Quote paper
- Daniela Kaminski (Author), 2019, Häusliche Versorgung demenzerkrankter Personen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/471262