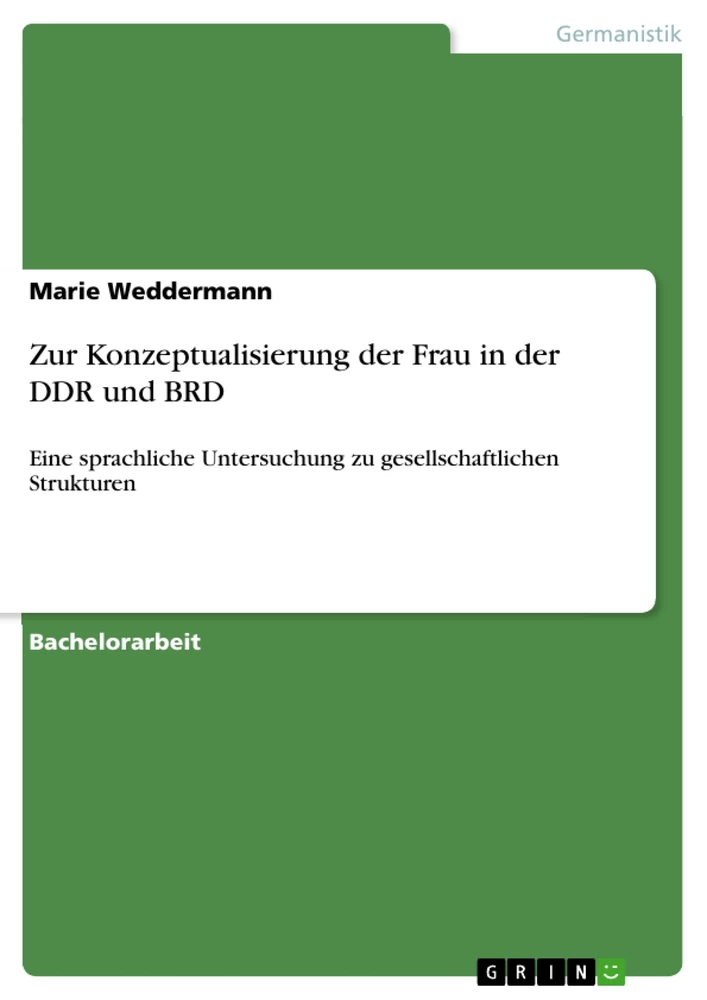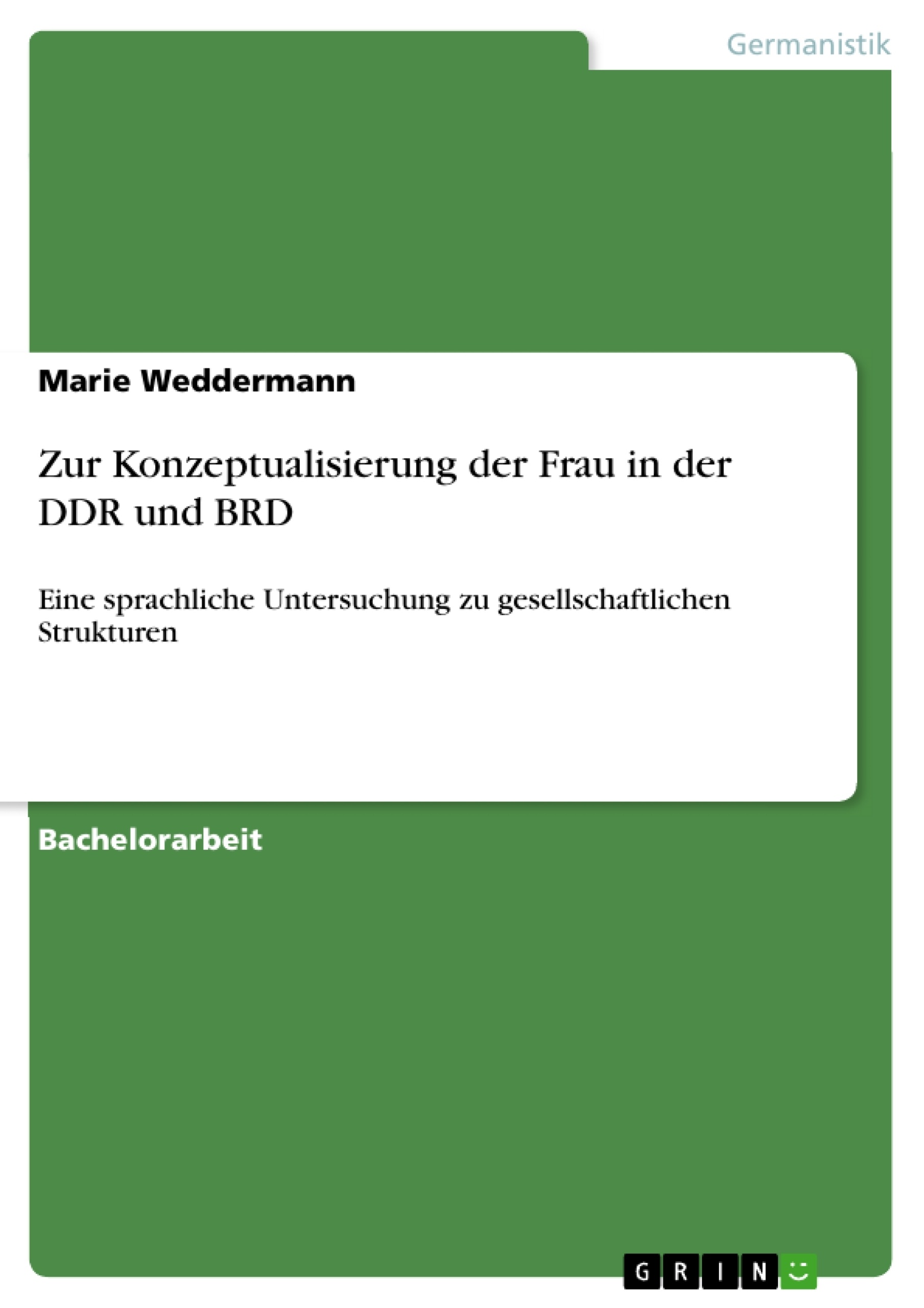Diese Arbeit untersucht, wie die Frau in der DDR und der BDR jeweils sprachlich konzeptualisiert wurde. Die zwei unterschiedlichen politischen Systeme der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik teilten 40 Jahre lang Deutschland. Dies lässt die Frage entstehen, inwieweit die Trennung eine Entwicklung der deutschen Sprache beeinflusst hat. In dieser Arbeit steht die Rolle der Frau im Fokus. Die Vorstellung des zurückgebliebenen Ostens ist immer noch weit verbreitet. Doch inwieweit stimmt das wirklich? In dieser Arbeit soll gezeigt werden, wie fortschrittlich Ostdeutschland im Vergleich zu Westdeutschland bezüglich der Emanzipation war. Gestützt wird sich dabei auf den Duden, welcher in zwei Fassungen (BRD/DDR) erschien.
Der sprachliche Bereich rund um die Frau erscheint dabei besonders ergiebig, da sich Sprachforscher bisher noch nicht mit einem Sprachvergleich bezüglich der Konzeptualisierung der Frau im geteilten Deutschland befasst haben und die Frau in den beiden ideologischen Systemen unterschiedliche Funktionen und Rollen einnahm, was in dieser Arbeit unter anderem aufgezeigt werden soll. Auf Seiten der BRD stand das Bild der Hausfrau und Mutter und in der DDR das Bild der Arbeiterin und Mutter. Interessant ist somit der Aspekt, ob sich das fortschrittliche Bild der DDR-Frau auch sprachlich zeigte. Das Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, ob eine Tendenz hinsichtlich der unterschiedlichen Frauenrollen existiert, die sich sprachlich manifestiert hat. Anders formuliert soll untersucht werden, ob unterschiedliche Tendenzen der Frauenkonzepte in der DDR und BRD existieren. Die Forschungsfrage ist, ob es sprachliche Unterschiede in der Konstruktion der Frauenrolle zwischen Ost- und Westdeutschland gab. Es ist anzunehmen, dass Sprache in der DDR vermehrt eine stärkere und unabhängigere Frauenrolle als in der BRD repräsentierte und dass diese Unterschiede sich auf die soziale Struktur des jeweiligen Gebiets zurückführen lassen, denn die Sprache konstruiert Wirklichkeit und es erscheint daher nur plausibel, dass sich gesellschaftliche Strukturen auch sprachlich zeigen.
Zur Untersuchung des Ziels und der Forschungsfragen sowie der Überprüfung der Hypothesen wird mithilfe von Wörterbüchern aus der Zeit der Teilung der DDR und BRD die Sprache aus den jeweiligen Gebieten analysiert und verglichen. Dabei werden die Wörterbücher des Dudens betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsüberblick
- 3. Situation der Frauen in Ost- und Westdeutschland
- 3.1 Überblick über die Situation nach der Teilung Deutschlands
- 3.2 Frauen in der DDR
- 3.2.1 Frauen im Bereich der Politik
- 3.2.2 Staatliche Unterstützung der Frau
- 3.2.3 Frauen in der Arbeit
- 3.2.4 Frauen in der Bildung
- 3.2.5 Die doppelte Rolle der Frau
- 3.3 Frauen in der BRD bis 1989
- 3.3.1 Erwerbstätigkeit der Frau
- 3.3.2 Frauen und politische Regelungen
- 3.3.3 Die Rolle der Frau
- 3.4 Zusammenfassung und Fazit
- 4. Sprache in Ost- und Westdeutschland
- 4.1 Merkmale der Sprache in der DDR
- 4.2 Merkmale der Sprache in der BRD
- 4.3 Zusammenfassung und Fazit
- 5. Untersuchung: Darstellung der Frau
- 5.1 Konzepte der Frau
- 5.1.1 Konzepte in Tabelle: Anredeformen
- 5.1.2 Konzepte in Tabelle: Arbeit und Bildung
- 5.1.3 Konzepte in Tabelle: Beschreibungen
- 5.1.4 Konzepte in Tabelle: Bezeichnungen
- 5.1.5 Konzepte in Tabelle: Haushalt und Familie
- 5.1.6 Konzepte in Tabelle: Nationalitäten
- 5.1.7 Konzepte in Tabelle: Politik
- 5.1.8 Konzepte in Tabelle: Religion
- 5.1.9 Konzepte in Tabelle: Bezeichnungen für Stärke
- 5.1.10 Konzepte in Tabelle: Tätigkeiten
- 5.2 Gesamtauswertung
- 5.1 Konzepte der Frau
- 6. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die sprachliche Konzeptualisierung der Frau in der DDR und BRD. Das Hauptziel ist die Analyse möglicher sprachlicher Unterschiede in der Konstruktion der Frauenrolle zwischen Ost und West, ausgehend von der Hypothese, dass die DDR-Sprache eine stärkere und unabhängigere Frauenrolle repräsentierte als die BRD-Sprache. Die Arbeit basiert auf einem Vergleich von Wörterbüchern aus beiden deutschen Staaten.
- Sprachliche Unterschiede in der Darstellung der Frau in Ost- und Westdeutschland
- Einfluss der politischen Systeme auf die sprachliche Konzeptualisierung der Frau
- Vergleich der Frauenrollen in der DDR und BRD
- Analyse der Wortwahl und Bezeichnungen für Frauen in unterschiedlichen Kontexten
- Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Struktur und sprachlicher Repräsentation der Frau
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach sprachlichen Unterschieden in der Konstruktion der Frauenrolle zwischen Ost- und Westdeutschland. Sie begründet die Relevanz der Untersuchung mit dem unterschiedlichen Bild der Frau in den beiden deutschen Staaten (Hausfrau/Mutter in der BRD, Arbeiterin/Mutter in der DDR) und der bisherigen Forschungslücke in diesem spezifischen sprachlichen Vergleich. Das methodische Vorgehen, basierend auf einem Vergleich von Duden-Auflagen aus Ost und West, wird erläutert, sowie die Auswahl der Wörterbücher begründet. Die Arbeit gliedert sich in einen Forschungsüberblick, eine Analyse des historischen Kontextes, eine linguistische Betrachtung und die Auswertung der tabellarischen Daten aus den Wörterbüchern.
2. Forschungsüberblick: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die bestehende Forschungsliteratur zur Sprache in Ost- und Westdeutschland. Es wird kritisch auf die vorhandenen Arbeiten eingegangen, die oft von parteiischer Betrachtung der DDR oder BRD geprägt sind. Der Fokus liegt auf sozialpolitischen Aspekten, untersucht anhand von Wörterbüchern und Zeitungen, mit besonderem Augenmerk auf die Neubildung von Lexemen. Genannt wird beispielsweise das Sammelwerk „Sprache und Kommunikation in Deutschland Ost und West“ von Hellmann und Schröder.
3. Situation der Frauen in Ost- und Westdeutschland: Dieses Kapitel analysiert die historische Situation der Frauen in der DDR und BRD. Es bietet einen Überblick über die Lage nach der deutschen Teilung und vergleicht die Rolle der Frau in beiden Systemen in verschiedenen Bereichen wie Politik, Arbeit, Bildung und Familie. Der Vergleich soll die unterschiedlichen sozialen Strukturen aufzeigen und den Kontext für die spätere sprachliche Analyse liefern.
4. Sprache in Ost- und Westdeutschland: Dieser Abschnitt untersucht linguistische Unterschiede und Entwicklungen in der Sprache der DDR und BRD. Er beleuchtet spezifische Merkmale der Sprache in beiden Staaten, um ein tieferes Verständnis der sprachlichen Eigenheiten zu schaffen, die im darauf folgenden Kapitel bei der Analyse der Frauenkonzepte berücksichtigt werden.
5. Untersuchung: Darstellung der Frau: Das Kernstück der Arbeit präsentiert eine tabellarische Gegenüberstellung von Wörtern aus den untersuchten Wörterbüchern, die sich auf die Frau und ihre Rolle beziehen. Diese Tabellen werden nach verschiedenen Konzepten (Anredeformen, Arbeit, Bildung, Haushalt, Familie, etc.) geordnet und analysiert. Die Auswertung dient der Überprüfung der eingangs formulierten Hypothese.
Schlüsselwörter
Frauenrolle, DDR, BRD, Sprachvergleich, Lexik, Wortwahl, Frauenkonzepte, politische Systeme, soziale Strukturen, ideologische Einflüsse, Sprachwandel.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Sprachliche Konzeptualisierung der Frau in der DDR und BRD
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit untersucht die sprachliche Konzeptualisierung der Frau in der DDR und der BRD. Sie analysiert mögliche sprachliche Unterschiede in der Konstruktion der Frauenrolle zwischen Ost und West, ausgehend von der Hypothese, dass die DDR-Sprache eine stärkere und unabhängigere Frauenrolle repräsentierte als die BRD-Sprache.
Welche Methode wird in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit basiert auf einem Vergleich von Wörterbüchern aus beiden deutschen Staaten. Die methodische Vorgehensweise umfasst einen Forschungsüberblick, eine Analyse des historischen Kontextes, eine linguistische Betrachtung und die Auswertung tabellarischer Daten aus den Wörterbüchern. Es wird kritisch auf die vorhandene Literatur eingegangen, die oft von parteiischer Betrachtung der DDR oder BRD geprägt ist.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Forschungsüberblick, Situation der Frauen in Ost- und Westdeutschland (inklusive detaillierter Unterkapitel zu den jeweiligen politischen Systemen und deren Einfluss auf Frauen), Sprache in Ost- und Westdeutschland, Untersuchung: Darstellung der Frau (mit tabellarischer Gegenüberstellung von Wörtern aus den untersuchten Wörterbüchern), und Schlussfolgerung.
Welche konkreten Themen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht sprachliche Unterschiede in der Darstellung der Frau in Ost- und Westdeutschland, den Einfluss der politischen Systeme auf die sprachliche Konzeptualisierung der Frau, den Vergleich der Frauenrollen in der DDR und BRD, die Analyse der Wortwahl und Bezeichnungen für Frauen in unterschiedlichen Kontexten und den Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Struktur und sprachlicher Repräsentation der Frau.
Welche Daten werden analysiert?
Die Hauptdatenquelle sind Wörterbücher aus der DDR und der BRD. Die Analyse konzentriert sich auf die Wortwahl und die Bezeichnungen für Frauen in verschiedenen Kontexten, kategorisiert nach Anredeformen, Arbeit, Bildung, Haushalt, Familie, Nationalitäten, Politik, Religion, Bezeichnungen für Stärke und Tätigkeiten.
Welche Hypothese wird geprüft?
Die zentrale Hypothese ist, dass die DDR-Sprache eine stärkere und unabhängigere Frauenrolle repräsentiert als die BRD-Sprache.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf bestehende Forschungsliteratur zur Sprache in Ost- und Westdeutschland, insbesondere auf sozialpolitische Aspekte, untersucht anhand von Wörterbüchern und Zeitungen. Ein genanntes Beispiel ist das Sammelwerk „Sprache und Kommunikation in Deutschland Ost und West“ von Hellmann und Schröder. Die Arbeit verwendet Duden-Auflagen aus Ost und West als primäre Datenquelle.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Frauenrolle, DDR, BRD, Sprachvergleich, Lexik, Wortwahl, Frauenkonzepte, politische Systeme, soziale Strukturen, ideologische Einflüsse, Sprachwandel.
- Citar trabajo
- Marie Weddermann (Autor), 2018, Zur Konzeptualisierung der Frau in der DDR und BRD, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/471268