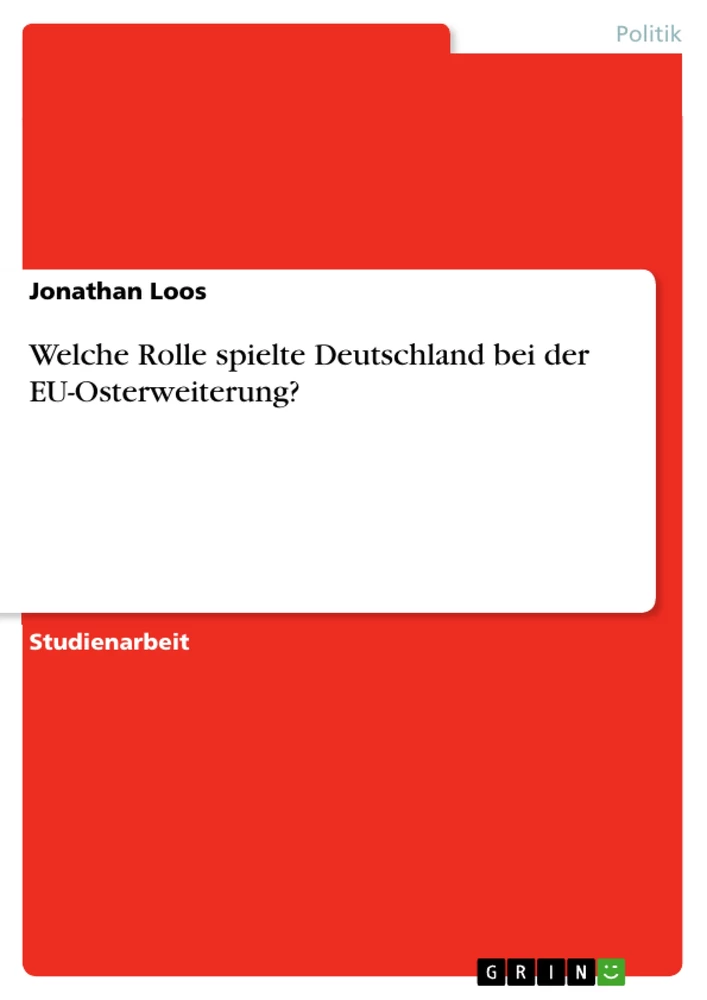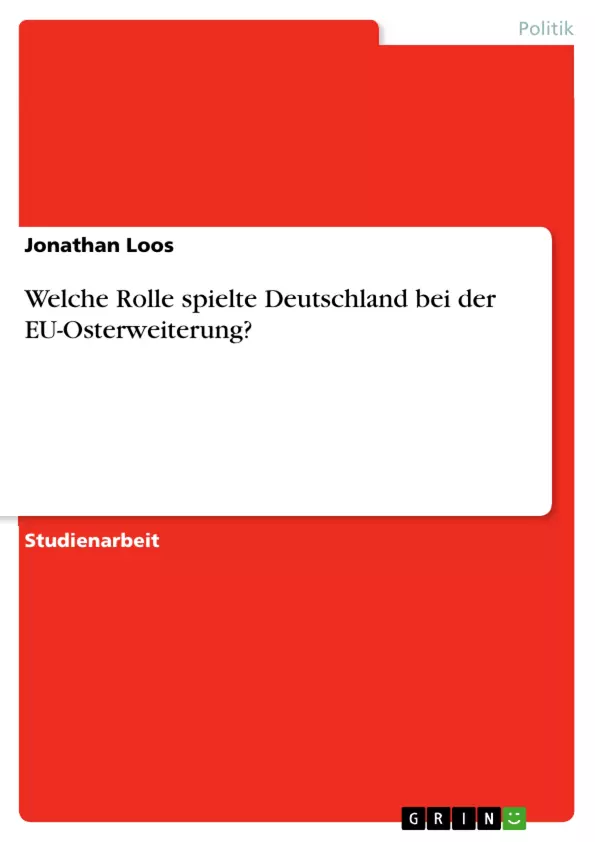Im Mai 2004 traten mit den mittel- und osteuropäischen Staaten (MOE-Staaten) Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Estland, Lettland und Litauen, sowie den Mittelmeer-Inselstaaten Malta und Zypern zehn neue Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) bei. Die Osterweiterung war mehr als nur die Aufnahme von zehn neuen Mitgliedern in den Rechtsraum der EU, sie war zudem auch von immenser ideeller Bedeutung. Der deutsche Außenminister Joschka Fischer sprach im Oktober 2000 von einer möglichen "Wiedervereinigung Europas". In dieser Arbeit soll die Rolle Deutschlands bei dieser Erweiterung beleuchtet werden.
Nach einer theoretischen Einordnung werden zunächst die strukturellen Gegebenheiten in Europa skizziert, die die Rahmenbedingungen für die Aushandlung der Osterweiterung bildeten. Ausgehend davon wird die Rolle Deutschlands näher analysiert. Dafür wird zunächst ein Blick auf das außen- und europapolitische Selbstverständnis der Bundesrepublik in der Zeit nach dem Ende des Ost-West-Gegensatzes geworfen und daraus ableitend die Motive für die Unterstützung der EU-Osterweiterung durch Deutschland ausgeführt. Vor diesem Hintergrund werden die einzelnen Politiken der Regierungen Kohl und Schröder bezüglich ihres Einflusses auf die Osterweiterung untersucht. Abschließend wird die deutsche Politik theoretisch verortet. Untersucht wird dabei, welche Theorie der IB das Handeln der Bundesrepublik in der Frage der Osterweiterung am besten erklären kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Theoretische Vorüberlegungen
- (Neo-) Realismus
- Konstruktivismus
- Institutionalismus
- Die Osterweiterung der Europäischen Union
- Strukturelle Voraussetzungen in Europa nach dem Ende des Ost-West-Konflikts
- Der Rollenkonflikt zwischen Vertiefung und Erweiterung
- Etappen der EU-Osterweiterung
- Deutschlands Rolle bei der EU-Osterweiterung
- Außenpolitisches Selbstverständnis Deutschlands
- Neue Konstellation für Deutschland nach 1989/90
- Deutschlands Motive für eine Unterstützung der Osterweiterung
- Politische Motive
- Ökonomische Motive
- Die deutsche Rolle im Prozess der EU-Osterweiterung
- Regierung Kohl
- Regierung Schröder
- Theoretische Verortung der deutschen Erweiterungspolitik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rolle Deutschlands bei der EU-Osterweiterung im Jahr 2004. Sie analysiert die Motive und das außenpolitische Selbstverständnis Deutschlands in diesem Prozess, und zwar mit Blick auf verschiedene Theorien der internationalen Beziehungen.
- Die Osterweiterung als geopolitisches und ideelles Ereignis für die EU
- Die theoretischen Grundlagen der deutschen Europapolitik (Realismus, Konstruktivismus, Institutionalismus)
- Die Rolle Deutschlands in der Gestaltung der EU-Osterweiterung
- Die Analyse der deutschen Erweiterungspolitik unter den Regierungen Kohl und Schröder
- Die Einordnung der deutschen Europapolitik in den Rahmen der Theorien der internationalen Beziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den historischen Kontext der EU-Osterweiterung beleuchtet und die zentralen Fragestellungen der Arbeit definiert. Kapitel 2 widmet sich den theoretischen Vorüberlegungen und stellt verschiedene Theorien der internationalen Beziehungen vor, die zur Analyse der deutschen Europapolitik relevant sind. Kapitel 3 gibt einen Überblick über die strukturellen Voraussetzungen und die Etappen der EU-Osterweiterung. In Kapitel 4 wird Deutschlands Rolle bei der EU-Osterweiterung aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, einschließlich des außenpolitischen Selbstverständnisses und der Motive Deutschlands für die Unterstützung der Erweiterung. Die einzelnen Politiken der Regierungen Kohl und Schröder werden auf ihren Einfluss auf die Osterweiterung untersucht. Schließlich wird in Kapitel 5 die deutsche Erweiterungspolitik theoretisch verortet und es wird geprüft, welche Theorie die Handlungen der Bundesrepublik am besten erklären kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen EU-Osterweiterung, deutsche Außenpolitik, Theorien der internationalen Beziehungen, Realismus, Konstruktivismus, Institutionalismus, deutsche Europapolitik, Regierungspolitik, Regierung Kohl, Regierung Schröder.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte Deutschland bei der EU-Osterweiterung 2004?
Deutschland galt als einer der Hauptbefürworter und Motoren der Erweiterung, getrieben durch das außenpolitische Selbstverständnis einer "Wiedervereinigung Europas".
Was waren die ökonomischen Motive Deutschlands für die Erweiterung?
Deutschland profitierte von der Erschließung neuer Märkte in Osteuropa und der Stabilisierung der wirtschaftlichen Beziehungen zu seinen östlichen Nachbarn.
Wie unterschied sich die Politik der Regierungen Kohl und Schröder?
Während unter Kohl die ideelle "Wiedervereinigung" im Vordergrund stand, fokussierte sich die Regierung Schröder stärker auf die konkreten strukturellen und finanziellen Bedingungen der Erweiterung.
Was bedeutet der Rollenkonflikt zwischen Vertiefung und Erweiterung?
Es beschreibt das Spannungsfeld zwischen der Aufnahme neuer Mitglieder (Erweiterung) und der gleichzeitigen Reform und Stärkung der EU-Institutionen (Vertiefung).
Welche Theorien erklären das deutsche Handeln in der Osterweiterung?
Die Arbeit untersucht das Handeln anhand von Theorien wie dem Neorealismus, Konstruktivismus und Institutionalismus.
- Quote paper
- Jonathan Loos (Author), 2016, Welche Rolle spielte Deutschland bei der EU-Osterweiterung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/471306