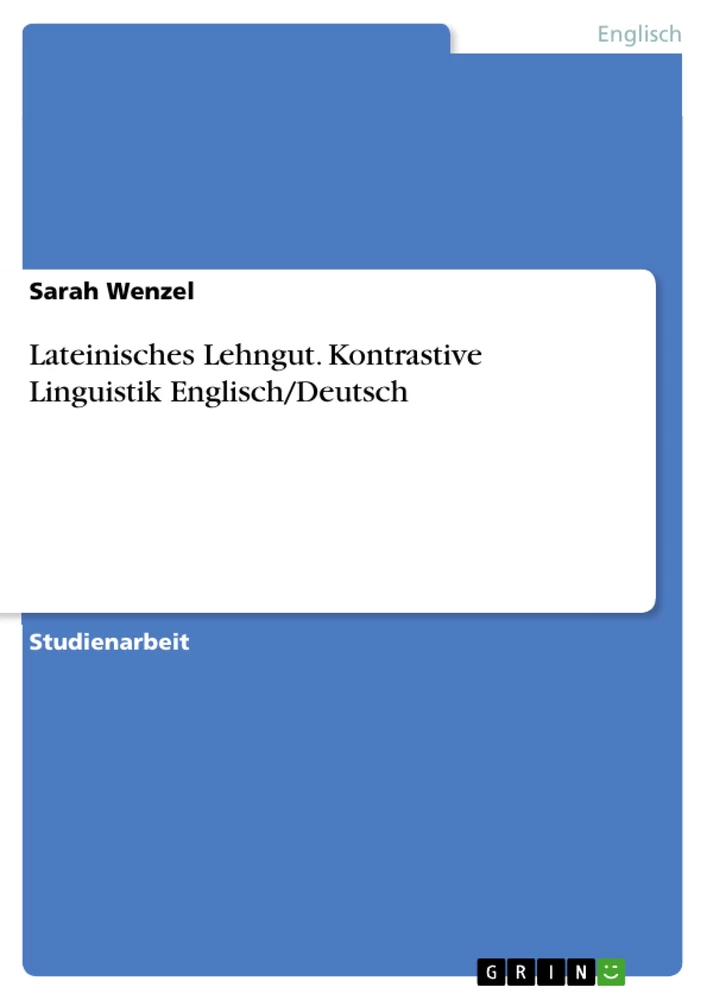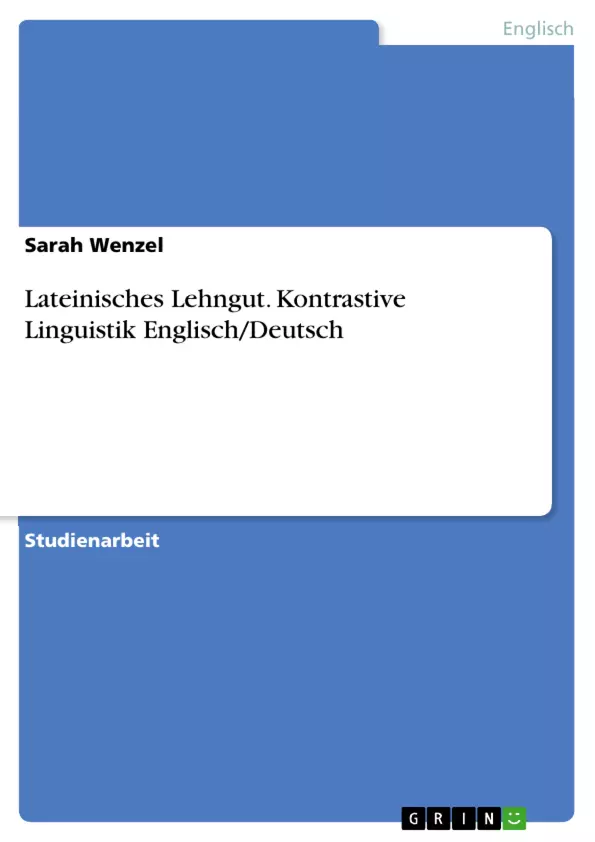Die Sprachen unserer heutigen modernen Welt reflektieren die vielen Wandlungen vergangener Jahrhunderte wieder. Dies hängt mit den geschichtlichen und politischen Ereignissen zusammen, die nachhaltigen Einfluss auf das Leben der Menschen, auf ihr Tun und Denken haben und somit, wie in den Ausführungen zuvor deutlich geworden ist, auch auf die Sprache der Menschen. Nachhaltigen und einschneidenden Einfluss kann dabei vor allem das Zusammentreffen verschiedener Völker auf deren Sprachentwicklung haben. Ganz besonders weitreichende und tiefgreifende Auswirkungen auf andere Sprachen hatte - und hat noch immer - das Lateinische, die Sprache des römischen Volkes. Dies soll im Folgenden exemplarisch am Beispiel des lateinischen Lehnguts im Englischen und Deutschen aufgezeigt werden.
Dabei steht die Frage im Zentrum welchen Einfluss die lateinische Sprache jeweils auf die englische und deutsche Sprache hatte. Eine Einbettung in den geschichtlichen Kontext ist hierfür unverzichtbar und bildet deshalb Grundlage und Ausgangspunkt der Analyse. Die Entwicklung der beiden Sprachen soll dabei chronologisch und nebeneinander dargestellt werden, um einen direkten Vergleich des lateinischen Lehnguts im Englischen und Deutschen zu ermöglichen.
Sprache ist eine häufig unterschätzte Grundlage unseres menschlichen Zusammenlebens. Dabei ist sie schon für das Individuum selbst von kaum zu überschätzender Bedeutung, denn sie ermöglicht uns, uns selbst zu denken, die Gedanken in uns und die Dinge um uns herum zu benennen und sie so mit Sinn und Bedeutung zu füllen. Sie ist die Grundlage unseres Denkens und zeigt uns gleichzeitig die Grenze unseres Verstandes auf, denn was wir nicht denken können, können wir nicht benennen und übersteigt somit unseren sprachlichen und geistigen Horizont.
Sprache ist zudem Grundlage für das Zusammenleben von Menschen. Durch sie treten Menschen miteinander in Kontakt und können sich über Dinge um sie herum austauschen und sich selbst mitteilen. Somit entsteht durch Kommunikation und Interaktion eine Ordnung und Orientierung über die Beziehungen untereinander und entweder ein Zusammengehörigkeitsgefühl oder Abgrenzung vom anderen, was die Grundlage für Gesellschaftsbildung ist. Sprache ermöglicht also Gesellschaft und hält diese zusammen, grenzt jedoch auch andere aus. Die Arbeit konzentriert sich in den folgenden Ausführungen auf den Kontakt zwischen Völkern unterschiedlicher Sprachen und ihre wechselseitige Beeinflussung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Die Bedeutung von Sprache für Völker
- 2. Lateinisches Lehngut im Englischen und Deutschen
- 2.1 Begriffsklärung: Was ist Lehngut?
- 2.2 Der lateinische Einfluss auf die deutsche und englische Sprache
- 2.2.1 Die Zeit des römischen Imperiums
- 2.2.2 Die Kelten
- 2.2.3 Die Christianisierung
- 2.2.4 Die Normannische Eroberung
- 2.2.5 Das Zeitalter des Humanismus
- 2.2.6 Das Zeitalter der Renaissance
- 2.2.7 Lateinischer Einfluss heute
- 3. Abschließendes Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss des Lateinischen auf die englische und deutsche Sprache. Ziel ist es, die Entwicklung des lateinischen Lehnguts in beiden Sprachen anhand von konkreten Beispielen zu beleuchten und Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen.
- Die Bedeutung von Sprache für die menschliche Kommunikation und Gesellschaftsbildung
- Die Rolle des Lateinischen als Einflussfaktor auf die Entwicklung der englischen und deutschen Sprache
- Die verschiedenen Formen des lateinischen Lehnguts, wie z. B. Lehnwörter, Lehnübersetzungen und Lehnbedeutungen
- Die unterschiedlichen historischen Phasen des lateinischen Einflusses auf die beiden Sprachen
- Der Einfluss der Christianisierung und der Renaissance auf die Entwicklung des lateinischen Lehnguts
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung legt die Bedeutung von Sprache für die menschliche Kommunikation und Gesellschaftsbildung dar. Sie betont die besondere Rolle des Lateinischen als Einflussfaktor auf die Entwicklung verschiedener Sprachen, insbesondere Englisch und Deutsch.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Begriffsklärung des "Lehnguts" und erläutert die verschiedenen Formen, in denen lateinische Elemente in die englische und deutsche Sprache aufgenommen wurden. Es werden auch die historischen Phasen des lateinischen Einflusses auf die beiden Sprachen dargestellt.
- Kapitel 2.1: In diesem Abschnitt wird der Begriff "Lehngut" genauer definiert und die verschiedenen Arten des Lehnwortschatzes, wie z. B. Lehnwörter, Lehnübersetzungen und Lehnbedeutungen, erläutert.
- Kapitel 2.2: Dieser Abschnitt untersucht den Einfluss des Lateinischen auf die deutsche und englische Sprache im Laufe der Geschichte. Es werden verschiedene Epochen behandelt, wie z. B. die Zeit des römischen Imperiums, die Christianisierung und die Renaissance.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem lateinischen Lehngut im Englischen und Deutschen und analysiert den Einfluss des Lateinischen auf die Entwicklung der beiden Sprachen. Zentrale Themen sind die Geschichte des Sprachkontakts, die verschiedenen Formen des Lehnguts (Lehnwörter, Lehnübersetzungen, Lehnbedeutungen), die Bedeutung von Sprache für die Kultur und Gesellschaft sowie der Einfluss von historischen Ereignissen wie der Christianisierung und der Renaissance auf die Sprachentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat Latein die deutsche und englische Sprache beeinflusst?
Latein wirkte über Jahrhunderte durch das römische Imperium, die Christianisierung und die Renaissance als Hauptquelle für Lehnwörter und Fachbegriffe.
Was ist der Unterschied zwischen Lehnwort und Lehnübersetzung?
Ein Lehnwort wird direkt übernommen (z.B. "Fenster"), während eine Lehnübersetzung die Struktur eines fremden Wortes nachbildet.
Welche Rolle spielte die Christianisierung für das Lehngut?
Durch die Kirche kamen zahlreiche lateinische Begriffe für Bildung, Verwaltung und Religion sowohl ins Deutsche als auch ins Englische.
Warum hat das Englische so viel lateinisches Lehngut?
Besonders die Normannische Eroberung und der Einfluss des Französischen brachten eine massive Welle lateinisch-romanischer Begriffe ins Englische.
Hat Latein heute noch Einfluss auf moderne Sprachen?
Ja, besonders in der Wissenschaft, Medizin und Rechtsprechung bleibt lateinisches Lehngut die unverzichtbare Basis der internationalen Fachsprache.
- Citar trabajo
- Sarah Wenzel (Autor), 2014, Lateinisches Lehngut. Kontrastive Linguistik Englisch/Deutsch, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/471470