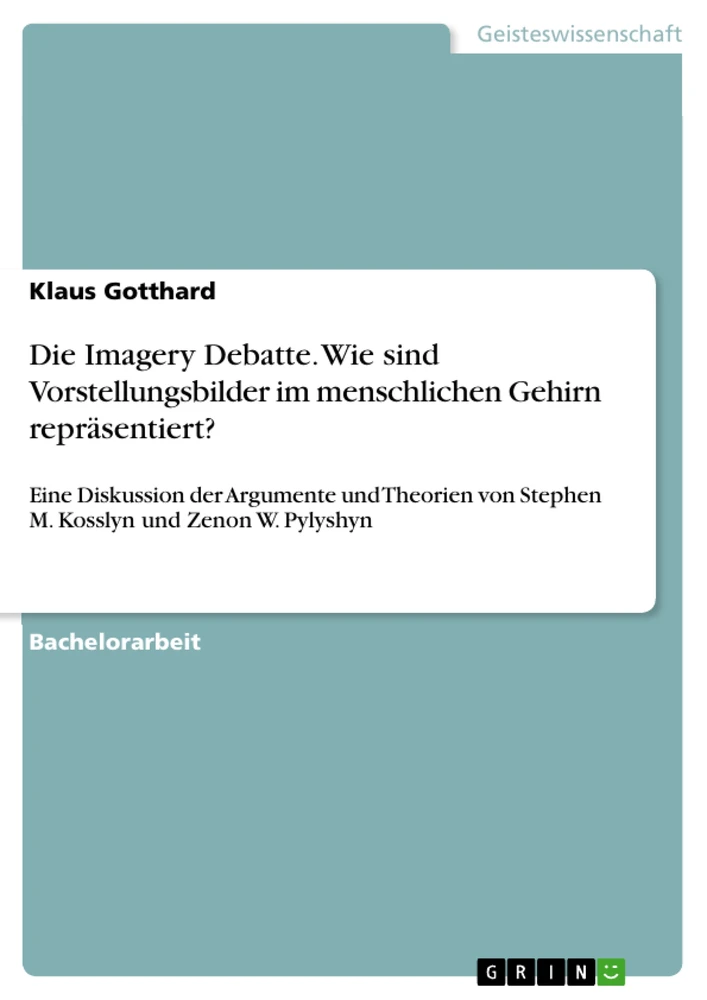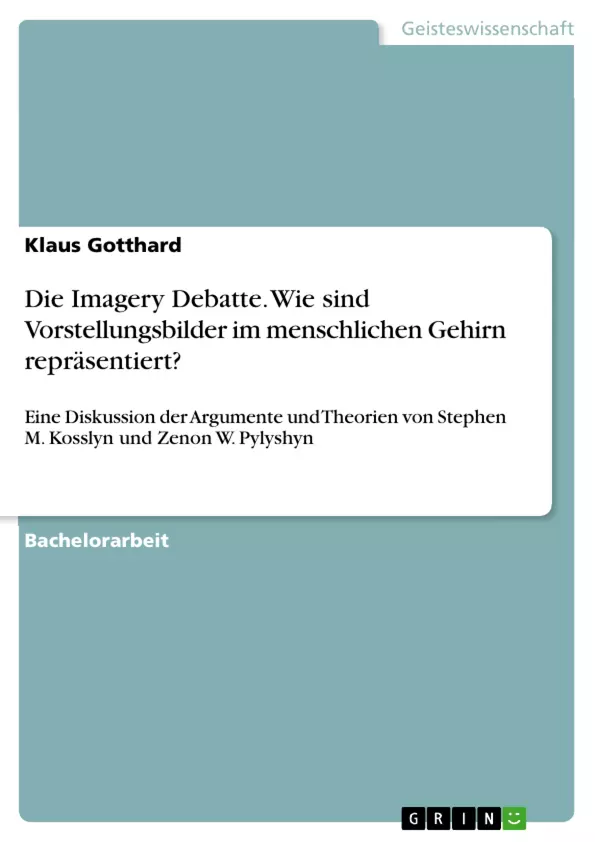Die folgende Arbeit geht der Frage nach, was genau im Gehirn vor sich geht, wenn man sich etwas bildlich vorstellt.
Mentale innere Bilder spielen in der Geschichte der Wissenschaft und der Philosophie schon immer eine Rolle. Nicht wenige Denker und Künstler haben angegeben, ihre Ideen durch innere Vorstellungsbilder entwickelt zu haben oder mit mentalen Visualisierungen Probleme "vor dem inneren Auge" erkannt und gelöst zu haben. Sogar Mathematiker berichten darüber, dass sie sich Probleme häufig räumlich-visuell vorstellen. Doch was passiert genau im Gehirn, wenn wir uns etwas vorstellen?
In den letzten 30 Jahren tauchte diese Frage in den Kognitionswissenschaften, der Philosophie des Geistes und der Neuropsychologie mit neuer Frische auf. Mit dem Vormarsch der neuropsychologischen Forschung sollte die Frage nach inneren Bildern nun eine neue Beantwortung finden. Doch bis heute ist das Zustandekommen nicht ausreichend geklärt. Zwar leugnen die wenigsten Wissenschaftler die Existenz des subjektiven Phänomens von Mental Images, jedoch haben sich im Zuge der philosophischen, neuropsychologischen und kognitionswissenschaftlichen Entwicklungen neue Theorien und Ansätze über Gehirn, Kognition und Bewusstsein entwickelt und eine Erklärung von Vorstellungsbildern ist mit aktuellen Erkenntnissen in Einklang zu bringen.
Im Zuge der Mitte der 1970er Jahre entwickelten Computational Theory of Mind (kurz: CTM), die von ihrem Begründer Jerry Fodor als "the only game in town" betitelt wurde, stellt die Annahme, Vorstellungsbilder hätten ein eigenes neuronales Format, ein Problem da. In dieser Arbeit werden Theorien und Argumente zweier Hauptvertreter, Zenon W. Pylyshyn und Stephen M. Kosslyn, der sogenannten Imagery-Debatte zur Frage nach Vorstellungsbildern vorgestellt und diskutiert. Ziel ist es, einen systematischen Überblick über nach wie vor aktuelle Fragen zur Imagery-Debatte und die Ansätze von Pylyshyn und Kosslyn, jene Fragen zu beantworten, zu geben. Dabei werden kognitions wissenschaftliche, neuropsychologische und philosophische Ansätze und Argumente vorgestellt und die beiden unterschiedlichen Theorien verglichen und diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlegende Fragestellung der Imagery-Debatte: Welcher neuronale Prozess ist konstitutiv für Vorstellungsbilder?
- Der Beginn der Debatte: Die Rotations- und Scanning-Experimente
- Pylyshyns Theorie zu Vorstellungsbildern
- Pylyshyns repräsentationalistische Annahmen
- Pylyshyns Erklärungsansatz zu bildhaftem Vorstellen
- Die Schwierigkeit des Bildbegriffs: Was ist eine bildhafte Repräsentation?
- Kosslyns Theorie zu Vorstellungsbildern
- Grundlagen von Kosslyns Protomodel zur Objektidentifikation
- Kosslyns Theorie von bildhaftem Vorstellen
- Pylyshyns Einwände zu den Rotations- und Scanning-Experimenten
- Pylyshyns Argument von verstecktem Wissen
- Pylyshyns Argument von kognitiver Penetrabilität und der Vermischung der Beschreibungsebenen
- Neurophysiologische Befunde bezüglich mentaler Vorstellungsbilder
- Neuroimaging-Experimente
- Neuroimaging-Experimente und Studien bezüglich mentaler Vorstellungsbilder
- Einwände gegen die Aussagekraft von Neuroimaging-Experimenten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Imagery-Debatte und analysiert die unterschiedlichen Theorien und Argumente von Stephen M. Kosslyn und Zenon W. Pylyshyn zur Frage der neuronalen Prozesse, die bei Vorstellungsbildern im menschlichen Gehirn eine Rolle spielen. Ziel ist es, einen systematischen Überblick über die wichtigsten Fragen und Ansätze der Debatte zu geben und die beiden Theorien miteinander zu vergleichen und zu diskutieren.
- Die Rolle mentaler Bilder in den Kognitionswissenschaften, der Philosophie des Geistes und der Neuropsychologie
- Die Frage nach der Repräsentation und den neuronalen Prozessen von Vorstellungsbildern
- Die Theorien von Kosslyn und Pylyshyn im Kontext der Computational Theory of Mind (CTM)
- Die Diskussion über die Existenz von bildhaften Repräsentationen
- Die Analyse der Rotations- und Scanning-Experimente und der Argumente von Pylyshyn
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die grundlegende Frage nach der Natur von Vorstellungsbildern und die Bedeutung dieser Frage für verschiedene Wissenschaftsdisziplinen. Die Imagery-Debatte wird eingeführt und der Fokus auf die Theorien von Kosslyn und Pylyshyn gelegt.
- Grundlegende Fragestellung: Die Fragestellung der Arbeit wird präzisiert, die Standpunkte von Kosslyn und Pylyshyn werden skizziert und die Bedeutung der Frage nach der neuronalen Grundlage von Vorstellungsbildern wird hervorgehoben.
- Der Beginn der Debatte: Zwei entscheidende Experimente, die Rotations- und Scanning-Experimente, werden vorgestellt. Diese Experimente bilden die Grundlage für die Theorien und Argumente von Kosslyn und Pylyshyn.
- Pylyshyns Theorie zu Vorstellungsbildern: Der deskriptionalistische Ansatz von Pylyshyn wird erläutert, der die Existenz von bildhaften Repräsentationen in Frage stellt. Seine grundlegenden Annahmen und sein Erklärungsansatz zum bildhaften Vorstellen werden dargestellt.
- Die Schwierigkeit des Bildbegriffs: Die Frage nach der Definition einer bildhaften Repräsentation wird diskutiert, wobei die Ideen von Kosslyn, Pylyshyn, Gottschling und Sachs-Hombach berücksichtigt werden.
- Kosslyns Theorie zu Vorstellungsbildern: Kosslyns Theorie, die bildhafte Repräsentationen annimmt, wird detailliert dargestellt und erläutert. Seine Theorie des Protomodells zur Objektidentifikation und seine Theorie von bildhaftem Vorstellen werden vorgestellt.
- Pylyshyns Einwände: Die Argumente von Pylyshyn, die die Scanning- und Rotations-Experimente und die grundlegende Theorie von Kosslyn kritisieren, werden präsentiert. Sein Argument von verstecktem Wissen und sein Argument von kognitiver Penetrabilität und der Vermischung der Beschreibungsebenen werden erläutert.
- Neurophysiologische Befunde: Neurophysiologische Befunde zu Kosslyns Theorie werden aus der Perspektive von Kosslyn und Pylyshyn beleuchtet.
- Neuroimaging-Experimente: Experimente mit bildgebenden Verfahren werden vorgestellt, die Hirnaktivität bei Vorstellungsaufgaben untersuchen und Rückschlüsse auf die Beschaffenheit von Vorstellungsbildern zulassen. Die Ergebnisse dieser Experimente werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Imagery-Debatte, Vorstellungsbilder, mentale Bilder, neuronale Prozesse, Repräsentation, bildhafte Repräsentation, Pylyshyn, Kosslyn, Rotations- und Scanning-Experimente, Computational Theory of Mind (CTM), deskriptionalistischer Ansatz, Neurophysiologie, Neuroimaging, bildgebende Verfahren.
Häufig gestellte Fragen zur Imagery-Debatte
Was ist die Imagery-Debatte?
Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung darüber, wie mentale Vorstellungsbilder im Gehirn repräsentiert sind: als bildhafte Strukturen oder als sprachähnliche Beschreibungen.
Welche Position vertritt Stephen M. Kosslyn?
Kosslyn vertritt den bildhaften Ansatz. Er glaubt, dass mentale Bilder räumliche Eigenschaften haben und ähnliche Hirnareale nutzen wie die tatsächliche visuelle Wahrnehmung.
Was besagt Zenon W. Pylyshyns Theorie?
Pylyshyn vertritt den deskriptionalistischen Ansatz. Er argumentiert, dass Vorstellungsbilder auf abstrakten, symbolischen Beschreibungen (Propositionen) basieren, ähnlich wie Computercode.
Was zeigen Scanning-Experimente?
In Experimenten brauchen Probanden länger, um in ihrer Vorstellung weite Distanzen auf einer mentalen Karte „abzutasten“, was Kosslyn als Beweis für die räumliche Natur der Bilder sieht.
Was sind Neuroimaging-Befunde in diesem Kontext?
Bildgebende Verfahren zeigen, dass beim bildhaften Vorstellen oft der primäre visuelle Cortex aktiviert wird, was die Theorie bildhafter Repräsentationen stützt.
- Quote paper
- Klaus Gotthard (Author), 2018, Die Imagery Debatte. Wie sind Vorstellungsbilder im menschlichen Gehirn repräsentiert?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/471597