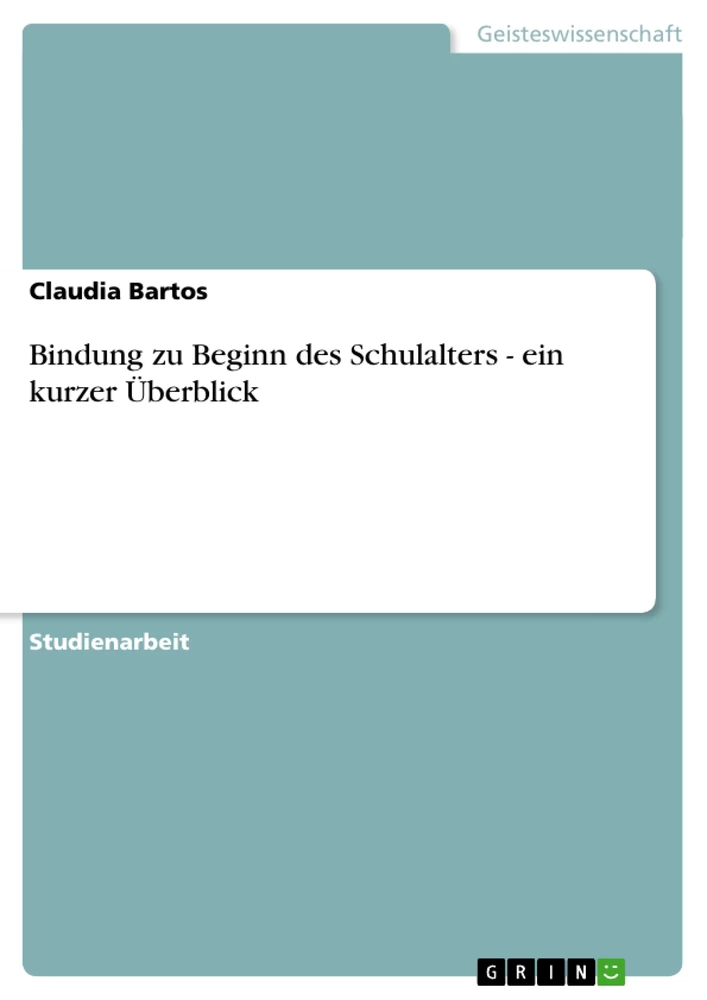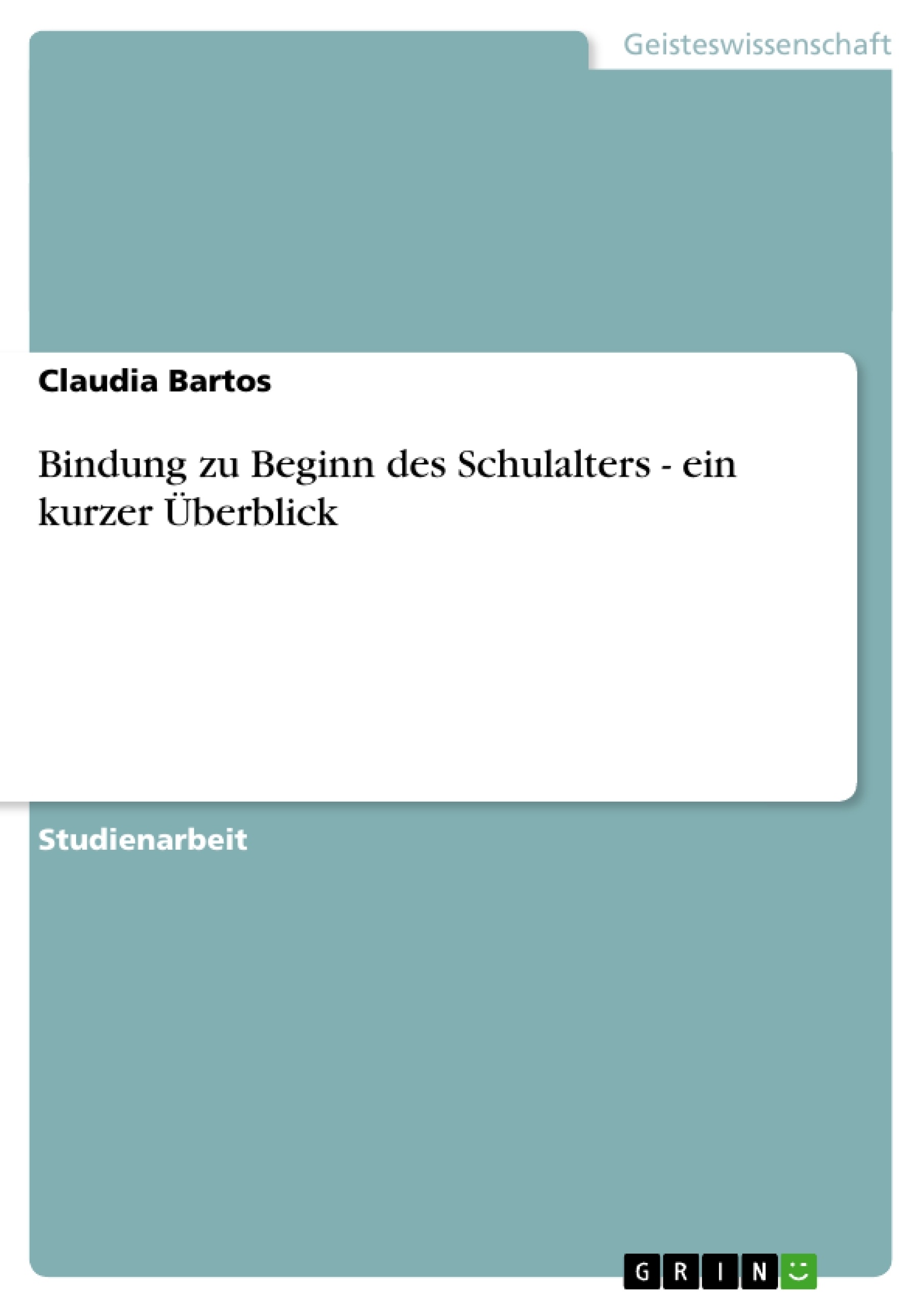Ab dem Lebensalter von sechs kommen die Kinder in die Schule und beginnen die Welt zu erkennen, in dem sie diese mental auffassen und für sich selbst verarbeiten. Nach Vollmer(1991) benutzen sie dafür sogenannte Denkzeuge, die dazu dienen das Erkannte auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
Bereits die Tradition des Abendlandes und René Descartes(1596-1650) haben Erkenntnistheorien hervorgebracht. Sie unterscheiden zwei verschiedenen Bereiche in der Welt: Zum einen gibt es den mentalen (Descartes:denkender; Abendland: geisteswissenschaftlicher)und zum anderen den materiellen (Descartes:cartesianisch; Abendland: naturwissenschaftlich)Teil des Weltbildes. Da diese sich kaum mit Emotionen befassen, sind sie der Bindungsforschung jedoch nicht sehr nützlich.Oeser(1987) schuf hierzu den „Kreislauf der Erkenntnis“. Hiernach vollzieht sich die Erkenntnis in folgender Reihenfolge:
Anschauung eines Ereignisses in der Umwelt - Information - Schlüsse werden gezogen (Induktion) - Hypothesen werden aufgestellt - Ein Weltbild wird konstruiert und mit einer Theorie verbunden (dieses kann falsch sein) - Konsequenzen werden gezogen (Deduktion) -Die Folgen werden überdacht, eine Prognose für zukünftiges Verhalten entwickelt - Das Ganze wird auf die ursprüngliche Information zurückgeführt
Vorraussetzung für diesen Erkenntnisweg ist der „innere Kreis der Erkenntnis“, in dem sich Vernunft, analytischer und synthetischer Verstand befinden.
In den frühen Jahren der Kindheit bekommt ein Kind Mitteilung der Eltern, ob etwas wahr ist oder nicht. Hierfür ist das Gespräch mit Erwachsenen notwendig. Auch muss das Kind den Zusammenhang zwischen Geschehnissen in der Umwelt und den damit verbundenen Emotionen feststellen. Erst wenn eine Übereinstimmung von Subjektivität und der Welt erfahren wird, kann das Kind aktiv in seinem Umfeld mitwirken.
„Wenn all dies gelingt, dann entsteht ein kohärentes, realitätsnahes, verinnerlichtes Weltbild“ Doch funktioniert dies alles auch bei einem „psychisch unsicheren“ Kind? Die Bindungstheorie besagt, dass ein „kohärentes Weltbild“ besser bei Kindern in sicheren Bindungsbeziehungen entsteht. Gefühle und ihre Ursachen werden bereits im Säuglingsalter wahrgenommen, sprachlich umgesetzt werden können sie aber erst, wenn in der Familie darüber gesprochen wird. „Gefühlsbetonte Anfänge des Erkennens“ erfolgen beim Kind bereits sehr früh durch sinnliche Wahrnehmung, vor allem durch die Interpretation der Stimme der Bindungsperson (z.B. Intonation).
Inhaltsverzeichnis
- Der Kreislauf der Erkenntnis
- Erkenntnis über Sprache in Bindungsbeziehungen
- Anfänge zur Erfassung von Bindungsverhalten bei Sechsjährigen
- Bindung mit 6 Jahren: Beschreibung und längsschnittliche Vergleiche
- Bindungsverhaltensmuster von sechsjährigen Kindern
- Vergleiche mit den Bindungsverhaltensmustern derselben Kinder in der fremden Situation mit einem Jahr
- Vergleiche mit dem Verhalten der Kinder im Kindergarten
- Das interaktive Verhalten der Mütter im Vergleich zu der Bindungsqualität der Kinder
- Bindungsrepräsentation im Alter von 6 Jahren in symbolischen Darstellungen
- Familienzeichnungen von Kindern
- Der Umgang mit Bindungsgefühlen – Der Trennungsangst-Test bei 6 jährigen
- Das Verhalten, die geäußerten Gefühle und die Lösungsvorschläge bindungssicherer und -unsicherer Kinder
- Diskurs über Bindungsthemen und „konstruktive interanale Kohärenz“
- Schlussfolgerungen
- Eigene kritische Würdigung des Textes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Einfluss der Bindungserfahrungen auf die Entwicklung des Kindes im Schulalter. Er analysiert, wie sich Bindungsqualitäten im Alter von sechs Jahren in verschiedenen Bereichen manifestieren, darunter Sprachentwicklung, soziales Verhalten und emotionale Regulation.
- Der Zusammenhang zwischen Bindungssicherheit und der Fähigkeit, ein kohärentes Weltbild zu entwickeln.
- Die Rolle der Sprache und Kommunikation in der Bindungsbeziehung für die Entwicklung des Kindes.
- Die Erfassung und Klassifizierung von Bindungsverhalten bei Sechsjährigen.
- Die Bedeutung der internalen Arbeitsmodelle in der Bindungsforschung.
- Die Auswirkungen der Bindungsqualität auf das Verhalten von Kindern in Trennungssituationen.
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Kreislauf der Erkenntnis: Dieses Kapitel erläutert den Prozess der Erkenntnisgewinnung und stellt den "Kreislauf der Erkenntnis" vor. Es wird die Rolle der Bindungspersonen bei der Entwicklung eines realitätsnahen Weltbildes betont.
- Erkenntnis über Sprache in Bindungsbeziehungen: Dieses Kapitel analysiert den Zusammenhang zwischen sprachlicher Kompetenz und Bindungsqualität bei Sechsjährigen. Es werden Studien vorgestellt, die zeigen, wie die Bindungserfahrungen die Fähigkeit des Kindes beeinflussen, Sprache zu verstehen und zu verwenden.
- Anfänge zur Erfassung von Bindungsverhalten bei Sechsjährigen: Dieses Kapitel beschreibt die Methode zur Erfassung von Bindungsverhalten bei Sechsjährigen, die von Mary Main, Nancy Kaplan und Jude Cassidy entwickelt wurde. Es werden die verschiedenen Bindungsklassifikationen vorgestellt und die wichtigsten beobachteten Verhaltensweisen beschrieben.
- Bindung mit 6 Jahren: Beschreibung und längsschnittliche Vergleiche: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Aspekte der Bindung im Alter von sechs Jahren, einschließlich der unterschiedlichen Bindungsverhaltensmuster, Vergleiche mit früheren Messungen und dem Einfluss des elterlichen Verhaltens.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind Bindungsforschung, Bindungstheorie, Bindungsverhalten, sichere Bindung, unsichere Bindung, interne Arbeitsmodelle, Sprachentwicklung, Kommunikation, emotionale Regulation, Trennungsangst, Kindergartenalter, Schulalter.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „Kreislauf der Erkenntnis“ nach Oeser?
Der Kreislauf beschreibt den Prozess von der Anschauung eines Ereignisses über die Informationsverarbeitung, Induktion von Hypothesen bis hin zur Deduktion von Konsequenzen und Verhaltensprognosen.
Wie beeinflusst die Bindungssicherheit das Weltbild eines Kindes?
Kinder in sicheren Bindungsbeziehungen entwickeln eher ein kohärentes, realitätsnahes und verinnerlichtes Weltbild, da Gefühle und Ursachen in der Familie offen besprochen werden.
Welche Rolle spielt die Sprache in der Bindungsbeziehung?
Sprache ermöglicht es Kindern, Gefühle und Wahrnehmungen umzusetzen. Die Kommunikation mit Erwachsenen ist notwendig, damit das Kind Zusammenhänge zwischen Umwelt und Emotionen versteht.
Wie wird Bindungsverhalten bei sechsjährigen Kindern erfasst?
Die Erfassung erfolgt oft über symbolische Darstellungen wie Familienzeichnungen oder den Trennungsangst-Test, bei dem Verhalten, geäußerte Gefühle und Lösungsvorschläge analysiert werden.
Was versteht man unter „internalen Arbeitsmodellen“?
Internale Arbeitsmodelle sind verinnerlichte Repräsentationen von Bindungserfahrungen, die das Verhalten und die Erwartungen des Kindes in sozialen Situationen steuern.
- Citation du texte
- Claudia Bartos (Auteur), 2005, Bindung zu Beginn des Schulalters - ein kurzer Überblick, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47243