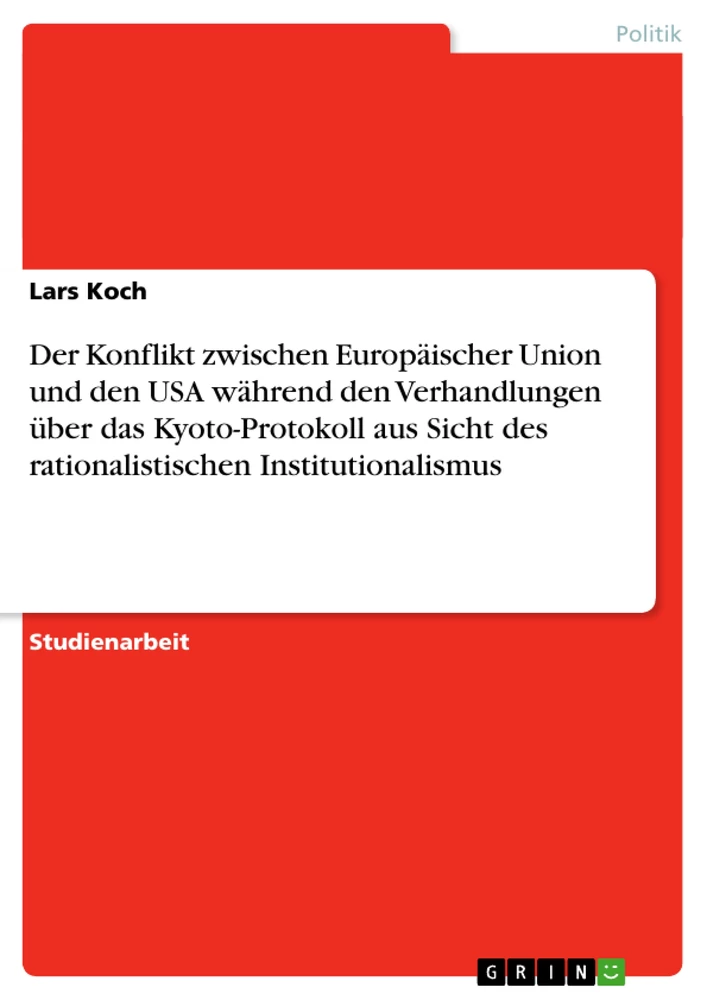Am 01.12.1997 begann im japanischen Kyoto eine Klimaschutzkonferenz mit Vertretern von 155 Staaten, in deren Rahmen ein Klimaschutzabkommen mit dem Ziel der Senkung der Emission von Treibhausgasen vereinbart werden sollte. Auf dieser Konferenz trafen unter anderem unterschiedliche Positionen in der Frage des Klimaschutzes zwischen den USA und der Europäischen Union aufeinander.
Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union forderten dabei eine verbindliche Verpflichtung der Industriestaaten, ihre Treibhausgasemissionen ab dem Jahr 2000 auf dem Niveau von 1990 zu stabilisieren (vgl. OTT 1997: 206). Die USA hingegen lehnten die Festlegung von verbindlichen Zielen und Zeiträumen zur Emissionssenkung ab. Sie forderten vielmehr Regelungen, die es erlauben ohne starre zeitliche und inhaltliche Zwänge Maßnahmen zum Schutz des Klimas umzusetzen, und zwar dann, wenn diese Maßnahmen die geringsten Kosten verursachen (vgl. BORSCH 1998: 261). Trotz dieser Positionsdifferenzen kam es in Kyoto jedoch zum Abschluss eines Klimaschutzabkommens, dessen Text einen Kompromiss zwischen den Forderungen der USA und denen der Europäischen Union darstellt (vgl. BORSCH 1998: 278). In dieser Hausarbeit soll nun untersucht werden, warum es trotz der Positionsdifferenzen zwischen zwei Hauptakteuren der Konferenz am Ende zu einer Einigung, d.h. zu Kooperation kam. Als theoretischer Rahmen soll hier die Denkschule des rationalistischen Institutionalismus Verwendung finden.
Zu diesem Zweck soll zunächst ein kurzer Überblick über die internationale Klimaschutzpolitik von 1992 bis zur Konferenz von Kyoto gegeben und die Verhandlungspositionen der Konfliktparteien dargestellt werden. Anschließend wird die Denkschule des rationalistischen Institutionalismus vorgestellt und versucht, mit Hilfe dieser Denkschule eine Antwort auf die oben gestellte Frage zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Internationale Klimapolitik: Der Weg nach Kyoto
- Die Klimarahmenkonvention von Rio de Janeiro
- Die Vertragsstaatenkonferenzen von Berlin und Genf
- Die Vertragsstaatenkonferenz von Kyoto 1997
- Die Verhandlungsposition der USA
- Die Verhandlungsposition der Europäischen Union
- Der rationalistische Institutionalismus
- Das Kyoto-Protokoll und der rationalistische Institutionalismus
- Problematische soziale Situation
- Interdependenz
- Internationale Regime im Klimaschutz
- Zusammenfassung / Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Entstehung des Kyoto-Protokolls und analysiert die Gründe für die Kooperation zwischen den USA und der Europäischen Union, trotz ihrer unterschiedlichen Verhandlungspositionen. Dabei dient die Denkschule des rationalistischen Institutionalismus als theoretischer Rahmen.
- Internationale Klimapolitik
- Verhandlungspositionen der USA und der Europäischen Union
- Der rationalistische Institutionalismus
- Das Kyoto-Protokoll
- Kooperation und Konfliktlösung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problematik des Klimawandels und die Bedeutung des Kyoto-Protokolls für die internationale Klimapolitik beleuchtet.
Kapitel 2 bietet einen Überblick über die Entwicklung der internationalen Klimapolitik von 1992 bis 1997, einschließlich der Klimarahmenkonvention von Rio de Janeiro und der Vertragsstaatenkonferenzen von Berlin und Genf. Besonderes Augenmerk liegt auf den Verhandlungspositionen der USA und der Europäischen Union im Vorfeld der Konferenz von Kyoto.
Kapitel 3 führt den rationalistischen Institutionalismus als theoretischen Rahmen für die Analyse der Entstehung des Kyoto-Protokolls ein.
Kapitel 4 untersucht die Rolle des rationalistischen Institutionalismus im Kontext des Kyoto-Protokolls und analysiert die Faktoren, die zu einer Kooperation zwischen den USA und der Europäischen Union führten, trotz ihrer unterschiedlichen Standpunkte.
Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung und einem Fazit, die die wichtigsten Erkenntnisse aus der Analyse hervorheben.
Schlüsselwörter
Internationale Klimapolitik, Kyoto-Protokoll, rationalistischer Institutionalismus, Verhandlungsposition, Kooperation, Konflikt, Treibhausgasemissionen, Umweltpolitik, internationale Beziehungen, Klimarahmenkonvention, Vertragsstaatenkonferenz.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Hauptkonflikt zwischen der EU und den USA in Kyoto?
Die EU forderte verbindliche Ziele zur Stabilisierung der Emissionen auf dem Niveau von 1990, während die USA starre Zeitpläne ablehnten und flexiblere, kosteneffiziente Maßnahmen bevorzugten.
Welche Theorie wird zur Analyse der Verhandlungen genutzt?
Die Arbeit nutzt den rationalistischen Institutionalismus als theoretischen Rahmen, um zu erklären, warum es trotz Differenzen zur Kooperation kam.
Wann fand die Klimaschutzkonferenz in Kyoto statt?
Die Konferenz begann am 1. Dezember 1997 in Kyoto, Japan, unter Beteiligung von 155 Staaten.
Was ist das Ziel des Kyoto-Protokolls?
Das Ziel ist die Senkung der Emissionen von Treibhausgasen durch ein internationales Abkommen.
Welche Rolle spielt die Interdependenz in der Analyse?
Im Rahmen des rationalistischen Institutionalismus wird untersucht, wie gegenseitige Abhängigkeiten und internationale Regime die Zusammenarbeit im Klimaschutz fördern.
- Quote paper
- Lars Koch (Author), 2005, Der Konflikt zwischen Europäischer Union und den USA während den Verhandlungen über das Kyoto-Protokoll aus Sicht des rationalistischen Institutionalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47251