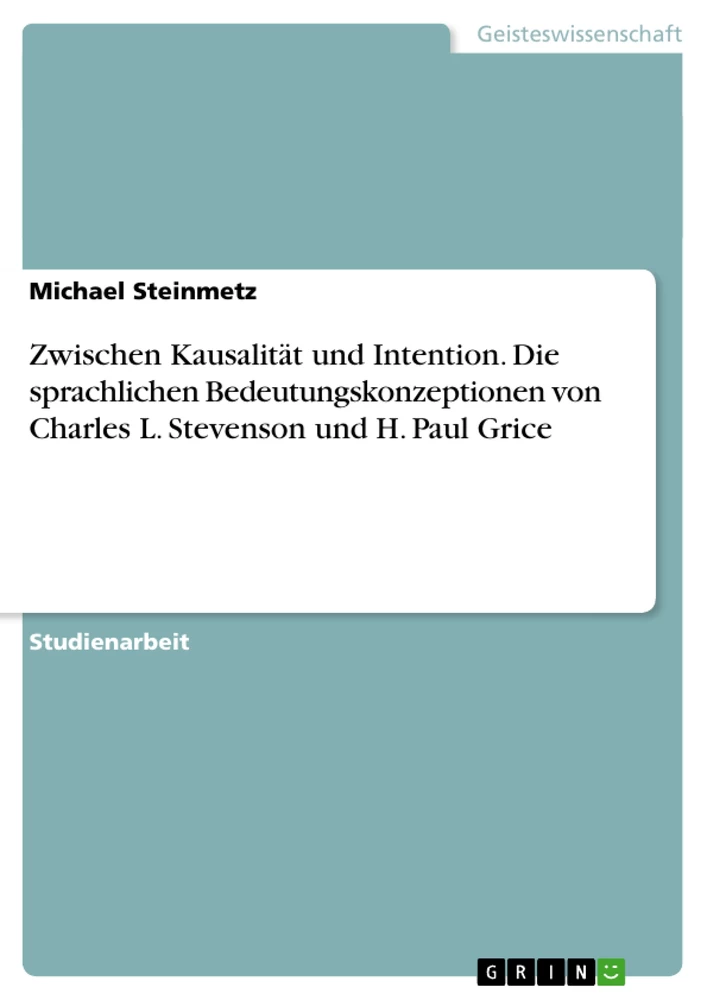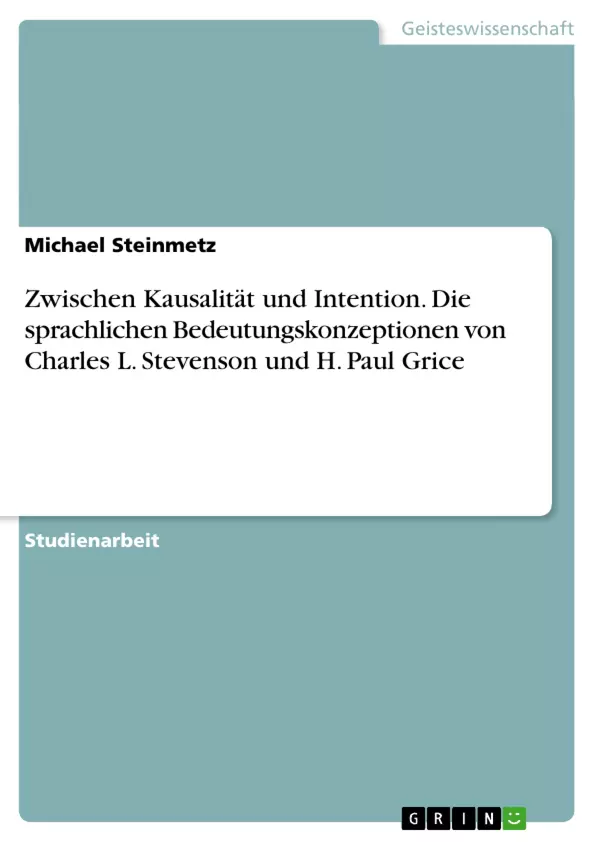Charles L. Stevenson - vornehmlich bekannt durch seine metaethische These, sittliche Wert-Urteile haben keinerlei deskriptiven Charakter, sondern dienen einzig und allein dem Zweck, Emotionen hervorzurufen, um damit andere zu beeinflussen oder zu überzeugen - entfaltet im dritten Kapitel seines eindringlich rezipierten Buches „Ethics and Language“ eine kausale Bedeutungstheorie für Lexeme bzw. Lexemkombinationen, welche unter anderem die seinerzeit revolutionäre Möglichkeit bietet, das Phänomen der Bedeutungsambiguität zu erklären.
Paul Grice – vornehmlich bekannt durch seine im Aufsatz „Logic and Conversation“ erarbeitete ‚Implikaturentheorie’ – greift Stevensons Ansatz auf, diskutiert ihn flüchtig, verreißt ihn und entwickelt eine eigene Bedeutungstheorie, welche besonders den Begriff der ‚Intention’ akzentuiert. Grice distanziert sich, indem er negierend auf Stevenson rekurriert, obstinat von einer kausalen Bedeutungstheorie. Er betrachtet die Bedeutung nicht als eine mit dem Zeichen kausal verbundene mentale Haltung, sondern versucht Bedeutung, oder vielmehr kommunikative Bedeutung als Erklärung, oder besser, als eine Disjunktion von möglichen Erklärungen der Sprecherintentionen aufzufassen. Damit verlässt Grice das seinerzeit vorherrschende psychologisch-behavioristische und naturalistische Milieu der Natur- und Geisteswissenschaften und lenkt den Fokus des Bedeutungsdiskurses auf die Ebene mentaler Repräsentationen des Sprechers, namentlich auf dessen kommunikative Absichten.
Unter der Fragestellung ‚Inwiefern lassen sich Divergenzen bzw. Kongruenzen zwischen den beiden Bedeutungstheorien ausmachen?’, wird Stevensons Aufsatz „Some Pragmatic Aspects of Meaning“ mit Grices Abhandlung „Meaning“ verglichen und abschließend zu harmonisieren versucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Natural Meaning“
- Stevensons „natürliche Manifestation“
- Grices „natürliche Bedeutung“
- Die sprachliche Bedeutung
- Stevensons kausale Theorie
- Stevensons emotiv behavioristische Bedeutungstheorie
- Stevensons kognitiv behavioristische Bedeutungstheorie
- Erstes Resümee
- Grices Kritik an Stevensons kausaler Theorie
- Grices intentionale Theorie
- Stevensons kausale Theorie
- Abschließender Vergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sprachlichen Bedeutungskonzeptionen von Charles L. Stevenson und H. Paul Grice im Hinblick auf ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Der Fokus liegt auf der Parallelisierung beider Ansätze, um ein umfassenderes Verständnis der jeweiligen Theorien zu erlangen und deren Stärken und Schwächen aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert die Argumentationslinien beider Philosophen und bewertet deren methodische Herangehensweisen.
- Vergleich der kausalen und intentionalen Bedeutungstheorien von Stevenson und Grice.
- Analyse von Stevensons „natürlicher Manifestation“ und Grices „natürlicher Bedeutung“.
- Untersuchung der Kritik Grices an Stevensons kausaler Theorie.
- Bewertung der Rolle von Emotionen und Intentionen in der sprachlichen Bedeutung.
- Auswertung der methodischen Ansätze (behavioristisch vs. intentional).
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die beiden zentralen Figuren, Charles L. Stevenson und H. Paul Grice, sowie deren Bedeutungstheorien vor. Sie umreißt die Zielsetzung der Arbeit, nämlich die Parallelisierung der scheinbar gegensätzlichen Ansätze, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Der methodische Ansatz, die Arbeiten von Stevenson und Grice als dialogischen Diskurs zu betrachten, wird erläutert. Die zentrale Forschungsfrage nach Divergenzen und Kongruenzen in den Bedeutungstheorien wird formuliert.
„Natural Meaning“: Dieses Kapitel analysiert den Begriff der „natürlichen Bedeutung“ bei Stevenson und Grice. Stevenson versucht, sprachlichen Zeichen anhand empirischer Evidenzen eine berechenbare Bedeutung zuzuweisen, wobei er sich auf das Phänomen konzentriert, dass sprachlichen Einheiten oft nur ein Bedeutungspotential zukommt. Er versucht dies an humanspezifischen Haltungen und Emotionen festzumachen, unter Verwendung des Begriffs „emotive meaning“. Er veranschaulicht dies mit dem Beispiel „natürlicher Manifestationen“ von Emotionen wie Gähnen oder Seufzen, um den Zusammenhang zwischen emotionalem Ausdruck und sprachlicher Bedeutung herzustellen. Grice hingegen greift Stevensons Ansatz auf, differenziert jedoch zwischen „natural meaning“ und „nonnatural meaning“, ein Punkt, den er als Ausgangspunkt seiner eigenen Bedeutungstheorie nutzt. Die Untersuchung der verschiedenen Verwendungsweisen von „to mean“ bildet den methodischen Kern dieses Kapitels.
Die sprachliche Bedeutung: Dieses Kapitel vertieft die Analyse der Bedeutungstheorien von Stevenson und Grice. Es wird Stevensons kausale Theorie detailliert dargestellt, unterteilt in seine emotiv und kognitiv behavioristischen Ansätze. Das Resümee zu Stevensons Theorie dient als Brücke zur Kritik Grices, welcher Stevensons kausale Theorie ablehnt und seine eigene intentionale Theorie entwickelt, mit Fokus auf Sprecherintentionen und kommunikativer Bedeutung. Das Kapitel vergleicht die behavioristischen und naturalistischen Grundlagen von Stevensons Theorie mit Grices mentalistischer Perspektive.
Schlüsselwörter
Sprachliche Bedeutung, Charles L. Stevenson, H. Paul Grice, Kausalität, Intentionalität, emotive Bedeutung, descriptive Bedeutung, natürliche Bedeutung, Bedeutungstheorie, Pragmatik, Implikaturen, Behaviorismus, Mentalismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Vergleich der Bedeutungstheorien von Stevenson und Grice
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht und kontrastiert die sprachlichen Bedeutungstheorien von Charles L. Stevenson und H. Paul Grice. Der Fokus liegt auf der Parallelisierung beider Ansätze, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und deren Stärken und Schwächen zu analysieren. Die methodischen Herangehensweisen beider Philosophen werden ebenfalls bewertet.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht den Begriff der „natürlichen Bedeutung“ („Natural Meaning“) bei beiden Autoren, vergleicht Stevensons kausale Theorie (emotiv und kognitiv behavioristisch) mit Grices intentionaler Theorie und analysiert Grices Kritik an Stevensons Ansatz. Die Rolle von Emotionen und Intentionen in der sprachlichen Bedeutung sowie die methodischen Ansätze (behavioristisch vs. intentional) werden ebenfalls untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik und die Zielsetzung beschreibt. Es folgt ein Kapitel über „Natural Meaning“, das die jeweiligen Auffassungen von Stevenson und Grice analysiert. Ein weiteres Kapitel vertieft die Analyse der sprachlichen Bedeutung, wobei Stevensons kausale Theorie und Grices intentionale Theorie detailliert dargestellt und verglichen werden. Die Arbeit schließt mit einem abschließenden Vergleich.
Was ist Stevensons Beitrag zur Bedeutungstheorie?
Stevenson entwickelt eine kausale Bedeutungstheorie, die in emotiv und kognitiv behavioristische Ansätze unterteilt ist. Er versucht, sprachlichen Zeichen anhand empirischer Evidenzen eine berechenbare Bedeutung zuzuweisen, wobei er sich auf das Bedeutungspotential sprachlicher Einheiten konzentriert und versucht, dies an humanspezifischen Haltungen und Emotionen (emotive meaning) festzumachen. Er nutzt das Beispiel „natürlicher Manifestationen“ (z.B. Gähnen) um den Zusammenhang zwischen emotionalem Ausdruck und sprachlicher Bedeutung zu veranschaulichen.
Was ist Grices Beitrag zur Bedeutungstheorie?
Grice entwickelt eine intentionale Theorie der Bedeutung, die sich auf Sprecherintentionen und kommunikative Bedeutung konzentriert. Er kritisiert Stevensons kausale Theorie und differenziert zwischen „natural meaning“ und „nonnatural meaning“, wobei letzterer den Ausgangspunkt seiner eigenen Theorie bildet. Sein Fokus liegt auf dem Verständnis von Bedeutung als Ergebnis von Sprecherintentionen im kommunikativen Kontext.
Wie unterscheidet sich Grices Ansatz von Stevensons?
Der Hauptunterschied liegt in der methodischen Herangehensweise: Stevenson verwendet einen behavioristischen Ansatz, der sich auf beobachtbare Verhaltensweisen konzentriert, während Grice einen mentalistischen Ansatz verfolgt, der die Intentionen des Sprechers als zentralen Aspekt der Bedeutung betrachtet. Grice kritisiert Stevensons Fokus auf kausale Zusammenhänge und betont stattdessen die Rolle von Intentionen in der sprachlichen Kommunikation.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Sprachliche Bedeutung, Charles L. Stevenson, H. Paul Grice, Kausalität, Intentionalität, emotive Bedeutung, descriptive Bedeutung, natürliche Bedeutung, Bedeutungstheorie, Pragmatik, Implikaturen, Behaviorismus, Mentalismus.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage ist die nach den Divergenzen und Kongruenzen in den Bedeutungstheorien von Stevenson und Grice. Die Arbeit untersucht, inwiefern sich die Ansätze ähneln und unterscheiden und welche Stärken und Schwächen sie jeweils aufweisen.
- Citation du texte
- Michael Steinmetz (Auteur), 2005, Zwischen Kausalität und Intention. Die sprachlichen Bedeutungskonzeptionen von Charles L. Stevenson und H. Paul Grice , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47297