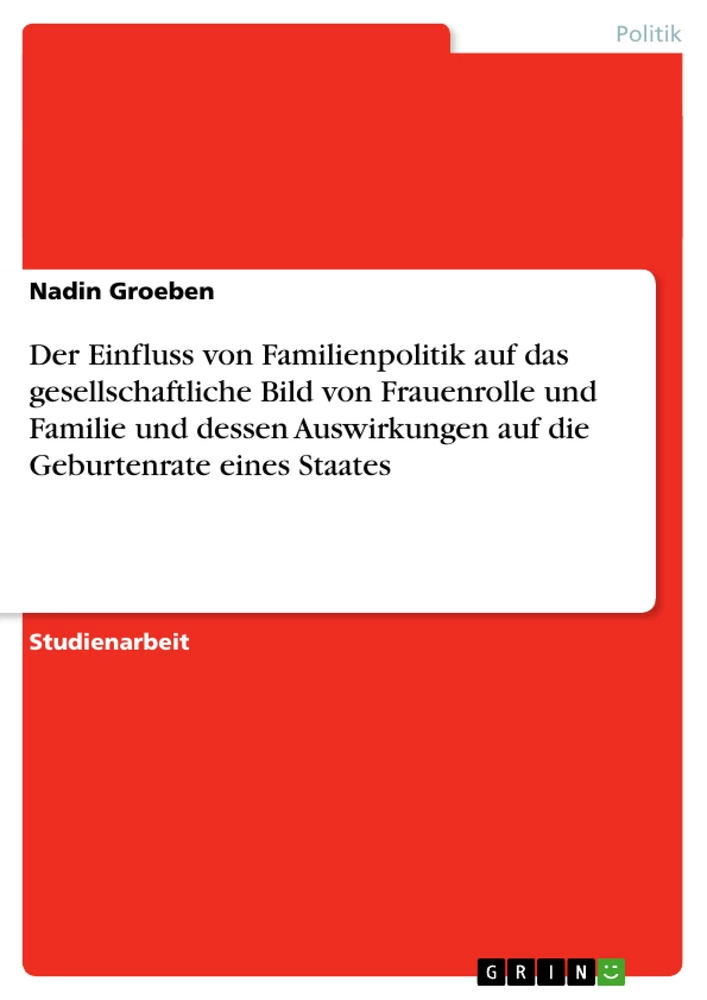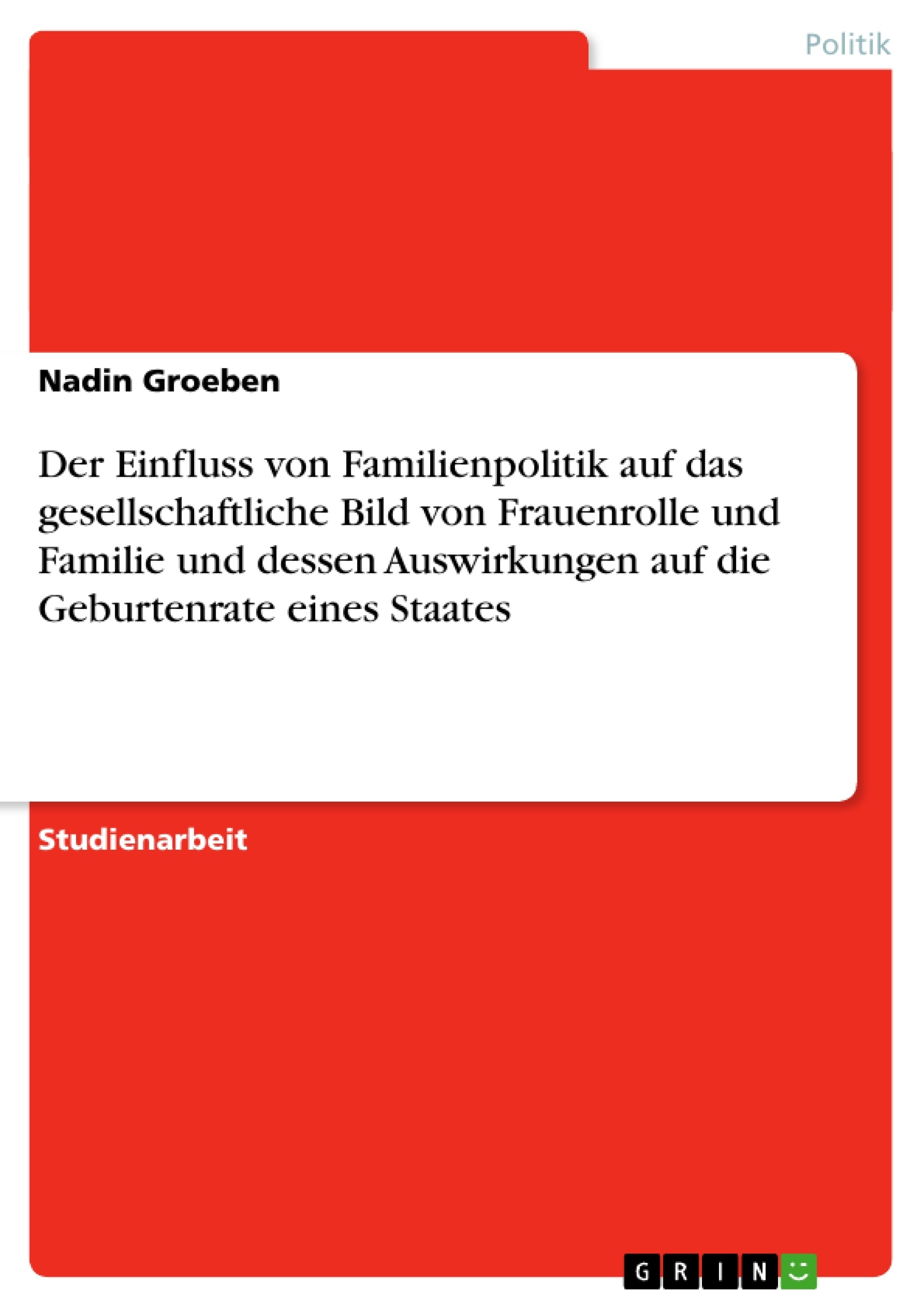In seinem Buch „Die deformierte Gesellschaft - Wie die Deutschen ihre Wirklichkeit verdrängen“ beklagt Meinhard Miegel als eine Hauptursache für die schwierige wirtschaftliche Lage in Deutschland, die im europäischen Vergleich gesehen, sehr niedrige Geburtenrate oder, wie er es bezeichnet „mangelnde Humankapital“. Die Ursache hierfür schildert er folgendermaßen:
„Die Kinderarmut individualistischer Wohlstandsgesellschaften ist nicht die Folge unbeabsichtigter Fehlentwicklungen, die sich durch zusätzliche Kindergartenplätze oder höhere steuerliche Freibeträge beheben ließen. Vielmehr ist sie der Ausdruck des Wesenskerns dieser Gesellschaft.“ (Miegel 2002,22)
Die vorliegende Arbeit untersucht diese These und möchte die Frage beantworten, in wiefern die Familienpolitik einen Einfluss auf die Rollenverteilung von Frauen und Männern in der Gesellschaft hat und ob ein Zusammenhang zu den Geburtenraten hergestellt werden kann. Dazu schildert sie zuerst die aktuelle Situation von Familien in Deutschland unter Berücksichtigung von Studien und Statistiken. Zur Verdeutlichung, auf welche Art die Rollenbilder einer Gesellschaft durch Familienpolitik beeinflusst werden können, folgt eine Darstellung der völlig unterschiedlichen Entwicklung von BRD und DDR in diesem Bereich. Der darauf folgende Vergleich der familienpolitischen Maßnahmen der geburtenstarken Länder verdeutlicht den positiven Einfluss, den die Gleichstellung der Geschlechter auf die Bevölkerungsentwicklung hat und zeigt Defizite auf, die sich in diesem Bereich in Deutschland feststellen lassen.
Nach einem Überblick über die aktuellen Konzepte der deutschen Parteien im Bereich Familienpolitik schließt die Arbeit mit einer Zusammenfassung und einer persönlichen Stellungnahme zur Fragestellung.
Inhaltsverzeichnis
- Zielsetzung der Arbeit
- Aktuelle Situation der Familien in Deutschland
- Kinderwunsch und Erwartungen an die Politik
- Wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation von Familien in Deutschland
- Familie und Beruf
- Geschichte der Familienpolitik in Deutschland seit den 50er Jahren
- Entwicklung der Familienpolitik in der Bundesrepublik Deutschland
- Familienpolitik in der DDR
- Familienpolitische Maßnahmen westeuropäischer Staaten im Vergleich
- Dienstleistungen statt Transferzahlungen
- Zusammenhang zwischen Geschlechtergleichstellung und Geburtenraten
- Aktuelle Familienpolitische Konzepte der großen deutschen Parteien
- Aktuelle Kampagne des Bundesministeriums für Familie
- Familienpolitische Kernpunkte der Wahlprogramme der Parteien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Einfluss der Familienpolitik auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von Frauenrolle und Familie und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Geburtenrate eines Staates. Ausgehend von der These Meinhard Miegels aus seinem Buch „Die deformierte Gesellschaft“, wonach die niedrige Geburtenrate in Deutschland eine Folge der individualistischen Wohlstandsgesellschaft ist, untersucht die Arbeit die Rolle der Familienpolitik in der Gestaltung von Rollenbildern und dem Zusammenhang mit der Geburtenrate.
- Analyse des Einflusses der Familienpolitik auf die Rollenverteilung von Frauen und Männern
- Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Familienpolitik und Geburtenraten
- Beurteilung der aktuellen Situation von Familien in Deutschland im Kontext demographischer Trends
- Vergleich der Familienpolitik in der BRD und der DDR
- Bewertung der Familienpolitik westeuropäischer Staaten im Kontext der Geschlechtergleichstellung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Darstellung der aktuellen Situation von Familien in Deutschland, wobei die Ergebnisse einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung aus dem Jahr 2003 herangezogen werden. Die Studie beleuchtet den Kinderwunsch, die Erwartungen an die Politik und die demographischen Trends in Deutschland. Im weiteren Verlauf werden die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen für Familien beleuchtet, wobei der Fokus auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelegt wird. Es werden zudem staatliche Leistungen für Familien, wie Mutterschutz, Elternzeit und Erziehungsgeld, vorgestellt.
Kapitel 3 befasst sich mit der Geschichte der Familienpolitik in Deutschland seit den 1950er Jahren. Die Entwicklung der Familienpolitik in der BRD und der DDR wird getrennt betrachtet, um die unterschiedlichen Ansätze und die jeweiligen Auswirkungen auf die Rollenbilder und die Geburtenrate zu beleuchten.
Kapitel 4 bietet einen Vergleich der familienpolitischen Maßnahmen westeuropäischer Staaten. Dabei wird insbesondere auf den Zusammenhang zwischen Geschlechtergleichstellung und Geburtenraten eingegangen. Die Arbeit identifiziert Defizite in der deutschen Familienpolitik und zeigt den positiven Einfluss von Gleichstellung auf die Bevölkerungsentwicklung auf.
Kapitel 5 gibt einen Überblick über die aktuellen Konzepte der deutschen Parteien im Bereich der Familienpolitik.
Schlüsselwörter
Familienpolitik, Frauenrolle, Familie, Geburtenrate, Kinderwunsch, Rollenverteilung, Gleichstellung der Geschlechter, demographischer Wandel, Deutschland, BRD, DDR, Westeuropa, Familienpolitik im Vergleich, Studien, Statistiken.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Geburtenrate in Deutschland im europäischen Vergleich niedrig?
Gründe sind unter anderem die schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf, traditionelle Rollenbilder und strukturelle Defizite in der Kinderbetreuung im Vergleich zu Ländern wie Frankreich oder Schweden.
Wie unterschied sich die Familienpolitik in der BRD und der DDR?
Die DDR förderte massiv die Erwerbstätigkeit von Frauen durch flächendeckende Kinderbetreuung, während die BRD lange Zeit das Modell der Hausfrauenehe durch steuerliche Anreize (Ehegattensplitting) unterstützte.
Hat die Gleichstellung der Geschlechter Einfluss auf die Geburtenrate?
Ja, internationale Vergleiche zeigen, dass Länder mit einer hohen Gleichstellung und guten Betreuungsinfrastruktur oft höhere Geburtenraten aufweisen, da Frauen sich nicht zwischen Kind und Karriere entscheiden müssen.
Was bedeutet „individualistische Wohlstandsgesellschaft“ in diesem Kontext?
Der Begriff (nach Meinhard Miegel) beschreibt eine Gesellschaft, in der persönliche Freiheit und materieller Wohlstand oft über die Familiengründung gestellt werden, was zu Kinderarmut führen kann.
Welche staatlichen Leistungen gibt es für Familien in Deutschland?
Dazu gehören unter anderem das Kindergeld, Elterngeld (früher Erziehungsgeld), Mutterschutzfristen sowie rechtliche Ansprüche auf Elternzeit und Kinderbetreuungsplätze.
Was fordern Familien von der Politik laut Studien?
Studien zeigen, dass sich Eltern vor allem eine bessere Infrastruktur (Kitas, Ganztagsschulen) und flexiblere Arbeitszeitmodelle wünschen, anstatt rein monetärer Transferzahlungen.
- Quote paper
- Nadin Groeben (Author), 2005, Der Einfluss von Familienpolitik auf das gesellschaftliche Bild von Frauenrolle und Familie und dessen Auswirkungen auf die Geburtenrate eines Staates, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47329