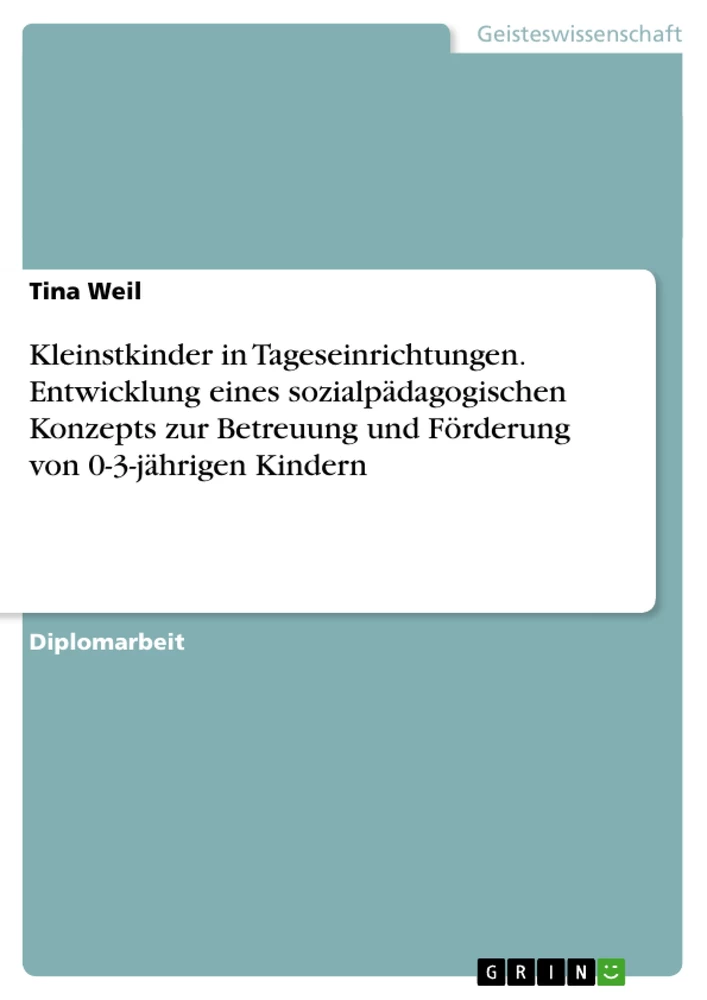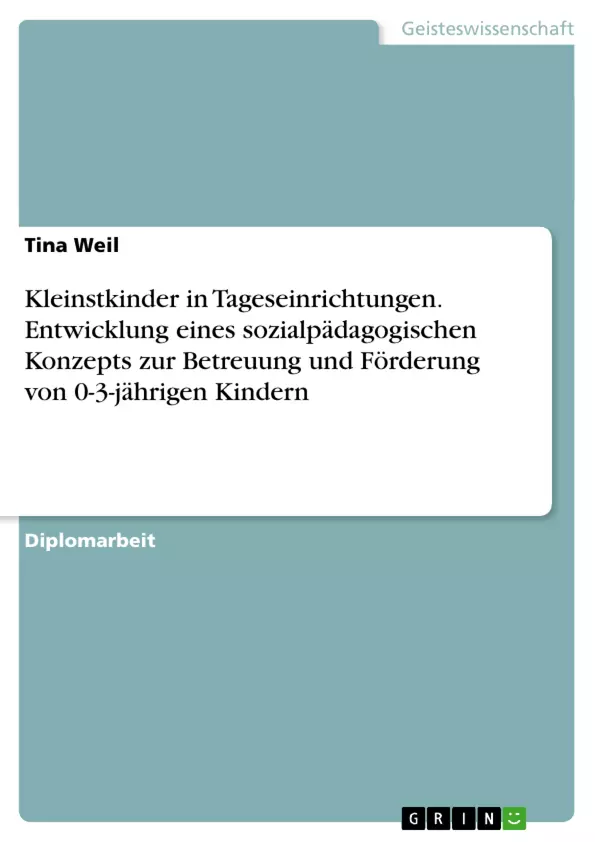In den Medien wurde im Laufe der letzten Monate immer wieder die explizite oder implizite Forderung, nach einer außerfamiliären Betreuungsform für Kinder unter drei Jahren, gestellt. Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Platzangebots in den Tagesstätten wird im Zusammenhang mit der Verbesserung der Chancengleichheit, mit der finanziellen Sicherung der Familien, mit der fehlenden Wahlmöglichkeit für Alleinerziehende oder, wie in jüngster Zeit, mit dem volkswirtschaftlichen Nutzen gefordert. Zwei Aspekte werden in der öffentlichen Diskussion allerdings nur wenig berücksichtigt:
(1) Obwohl die oben genannten Gründe den Ausbau der Betreuungsplätze für 0-3-Jährige zwar hinreichend rechtfertigen würden, gehen sie lediglich von den Bedürfnissen und Wünschen der Erwachsenen aus. Für die Kleinsten scheint nach wie vor die Erziehung in der Familie die pädagogisch beste Lösung zu sein. Diese Einstellung kann so nicht mehr gelten, da die Realität der Familie heute großenteils nicht mehr mit dem klassischen Bild der Kleinfamilie, bestehend aus Mutter, Vater und mehreren Kindern übereinstimmt. Die pädagogischen Motive einer außerfamiliären Betreuung in Tageseinrichtungen verdienen meiner Ansicht nach wesentlich mehr Beachtung. Anspruch dieser Arbeit ist es daher nicht, den Bestand und die Erweiterung entsprechender Einrichtungen zu rechtfertigen. Vielmehr möchte ich die außerfamiliäre Betreuungsform als wertvolle Alternative und Ergänzung voraussetzen, deren Anspruch über eine Definition als eine Kompromisslösung zur Kompensation des postmodernen, gesellschaftlichen Wandels - den man in Kauf nehmen muss - klar hinausgeht.
(2) Ebenso stiefmütterlich beachtet werden die konkreten pädagogischen Forderungen an Betreuungsarrangements für Kleinstkinder. Ziel dieser Arbeit ist es aus diesem Grund, den Einrichtungen für 0-3-Jährige ein Rahmenkonzept zu liefern, innerhalb dessen sich die Erzieher auf der Basis von wissenschaftlich gesicherten Informationen, professionell gestaltend verhalten können. Diese Arbeit soll die Spontaneität und Individualität der Handlungsweisen von pädagogischen Fachkräften im Kleinstkindbereich durch empirisch gesicherte Erkenntnisse ergänzen und in professionelles, begründbares Verhalten überführen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Kleinstkindbetreuung in Deutschland
- Entstehungsgeschichte der Kinderkrippen in Deutschland
- Einfluss pädagogischer Theorien und Modelle
- Versorgungsqualität von Kleinstkindern in Deutschland
- Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Theorien der frühkindlichen Entwicklung
- Wahrnehmung als Grundlage der Interaktion
- Neuronale Entwicklungen als Grundlage kognitiver Fähigkeiten
- Aspekte der Primärsozialisation
- Definition
- Soziabilität von Anfang an
- Frühkindliche Interaktionsformen
- Die Bedeutung der frühkindlichen Peer-Beziehungen
- Förderung der sozialen Entwicklung und der Peer-Interaktionen
- Physische Entwicklung des Kleinstkindes
- Motorische Entwicklung in den ersten drei Lebensjahren
- Die Bedeutung von Bewegung
- Psychomotorische Überlegungen und Erkenntnisse
- Anforderungen an Tageseinrichtungen für Kleinstkinder
- Ergebnisse aus der bindungstheoretischen Diskussion
- Die Bindungstheorie Bowlbys
- Bedeutung der Bezugspersonen und Bindungssicherheit
- Die Eingewöhnung als Qualitätskriterium in der außerfamilialen Kleinstkindbetreuung
- Sprache
- Bedeutung, Bestandteile, Voraussetzungen und Entwicklung
- Bedeutung des Spracherwerbs
- Komponenten des Spracherwerbs
- Voraussetzungen des Spracherwerbs
- Sprachentwicklung
- Zur Ontogenese der Identität
- Definition
- Grundvoraussetzungen der Identitätsbildung
- Der Körper als Grundlage der Selbsterkenntnis
- Frühkindliche Bildung - Überlegungen
- Der Bildungsbegriff
- Autopoiesis
- Ein frühkindliches Bildungskonzept
- Pädagogische Modelle
- Pädagogisches Curriculum aus Schweden
- Das Konzept der Early Excellence Centres aus Großbritannien
- Der situationsorientierte Ansatz als vorherrschendes pädagogisches Konzept deutscher Kindergärten
- Pädagoische Zielorientierung
- Grundlagen und Entwicklung des Ansatzes
- Die Bedeutung von und der Umgang mit Situationen
- Bestandteile des pädagogischen Konzepts
- Übertragung auf die Altersgruppe der unter Dreijährigen
- Das pädagogische Modell aus Reggio-Emilia
- Historische Entwicklung und Erklärung des Begriffs
- Die Bedeutung der kindlichen Wahrnehmung
- Die Bedeutung eigener kindlicher Erfahrungen
- Die Bedeutung der individuellen Wertschätzung
- Besonderheiten des Konzepts
- Reggio-Pädagogik für Kleinstkinder?
- Das Konzept Emmi Piklers
- Historisch-biographische Entwicklung des Konzepts
- Der kompetente Säugling
- Beziehungen als Grundlage der frühkindlichen Entwicklung
- Die selbständige Bewegungsentwicklung und ihre Bedeutung
- Rahmenbedingungen für ein Konzept zur Betreuung und Förderung von 0-3-jährigen Kindern in Tageseinrichtungen
- Präambel
- Zielsetzung
- Kontext der frühkindlichen Förderung
- Erfüllung kindlicher Grundbedürfnisse
- Sichere Bindungsrepräsentation
- Soziale Kontakte
- Komplexe Erfahrungen
- Fortführende Überlegungen
- Fazit und Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Betreuung und Förderung von Kleinstkindern in Tageseinrichtungen. Ziel ist es, ein sozialpädagogisches Konzept zu entwickeln, welches die individuellen Bedürfnisse und die Entwicklung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren berücksichtigt. Dabei stehen die besonderen Anforderungen dieser Altersgruppe im Fokus, insbesondere in Bezug auf Bindung, Sprache, Motorik und die Förderung ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung.
- Entwicklungspsychologische Grundlagen der frühkindlichen Entwicklung
- Bindungstheorie und ihre Bedeutung für die Kleinstkindbetreuung
- Spracherwerb und sprachliche Förderung im Kleinstkindalter
- Pädagogische Konzepte und Modelle für die Betreuung von Kleinstkindern
- Rahmenbedingungen für ein sozialpädagogisches Konzept zur Betreuung und Förderung von Kleinstkindern
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung erläutert die Relevanz des Themas Kleinstkindbetreuung und die Notwendigkeit eines sozialpädagogischen Konzepts für die Förderung dieser Altersgruppe.
- Kleinstkindbetreuung in Deutschland: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte der Kinderkrippen in Deutschland, den Einfluss pädagogischer Theorien und Modelle sowie die Versorgungsqualität von Kleinstkindern in Deutschland. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Kleinstkindbetreuung werden ebenfalls beleuchtet.
- Theorien der frühkindlichen Entwicklung: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Theorien der frühkindlichen Entwicklung, darunter die Wahrnehmung als Grundlage der Interaktion, die neuronale Entwicklung und Aspekte der Primärsozialisation. Es werden die Bedeutung der frühkindlichen Peer-Beziehungen und die Förderung der sozialen Entwicklung sowie die physische Entwicklung des Kleinstkindes mit Fokus auf motorische Entwicklung und die Bedeutung von Bewegung behandelt.
- Anforderungen an Tageseinrichtungen für Kleinstkinder: Dieses Kapitel untersucht die Anforderungen an Tageseinrichtungen für Kleinstkinder unter Berücksichtigung der Bindungstheorie, der Sprachentwicklung sowie der frühkindlichen Bildung. Es werden die Bedeutung der Bezugspersonen und Bindungssicherheit, die Eingewöhnung als Qualitätskriterium in der außerfamilialen Kleinstkindbetreuung und die Bedeutung von Sprache in der frühkindlichen Entwicklung diskutiert. Die Ontogenese der Identität und die Bedeutung des Körpers als Grundlage der Selbsterkenntnis werden ebenfalls beleuchtet.
- Pädagogische Modelle: Dieses Kapitel stellt verschiedene pädagogische Modelle für die Betreuung von Kleinstkindern vor, darunter das pädagogische Curriculum aus Schweden, das Konzept der Early Excellence Centres aus Großbritannien, der situationsorientierte Ansatz, der im Vordergrund deutscher Kindergärten steht, und das Modell aus Reggio-Emilia. Das Kapitel beleuchtet auch das Konzept von Emmi Pikler.
- Rahmenbedingungen für ein Konzept zur Betreuung und Förderung von 0-3-jährigen Kindern in Tageseinrichtungen: Dieses Kapitel bespricht die Präambel und die Zielsetzung des Konzepts. Es werden die Erfüllung kindlicher Grundbedürfnisse, die Sichere Bindungsrepräsentation, soziale Kontakte und komplexe Erfahrungen als wesentliche Bestandteile des Konzepts vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit den Themen Kleinstkindbetreuung, frühkindliche Entwicklung, Bindungstheorie, Spracherwerb, sozialpädagogisches Konzept, Tageseinrichtungen, Pädagoische Modelle, situationsorientierter Ansatz, Reggio-Pädagogik, Emmi Pikler, Bedürfnisse und Förderung von Kleinstkindern.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieses sozialpädagogischen Konzepts?
Ziel ist es, ein wissenschaftlich fundiertes Rahmenkonzept für die professionelle Betreuung und Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen zu bieten.
Welche Rolle spielt die Bindungstheorie in der Kleinstkindbetreuung?
Die Bindungstheorie nach Bowlby ist zentral für das Verständnis von Eingewöhnungsprozessen und der Bedeutung fester Bezugspersonen für die Bindungssicherheit der Kinder.
Welche pädagogischen Modelle werden in der Arbeit vorgestellt?
Es werden unter anderem der situationsorientierte Ansatz, die Reggio-Pädagogik, das Konzept von Emmi Pikler sowie Modelle aus Schweden und Großbritannien analysiert.
Warum ist die motorische Entwicklung bei 0-3-Jährigen so wichtig?
Bewegung gilt als Grundlage für kognitive Fähigkeiten und die Identitätsbildung; das Konzept betont die Bedeutung selbstständiger Bewegungsentwicklung.
Was sind „Early Excellence Centres“?
Dies ist ein pädagogisches Modell aus Großbritannien, das in der Arbeit als Beispiel für internationale Best Practices in der Kleinstkindbetreuung angeführt wird.
- Quote paper
- Tina Weil (Author), 2003, Kleinstkinder in Tageseinrichtungen. Entwicklung eines sozialpädagogischen Konzepts zur Betreuung und Förderung von 0-3-jährigen Kindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47366