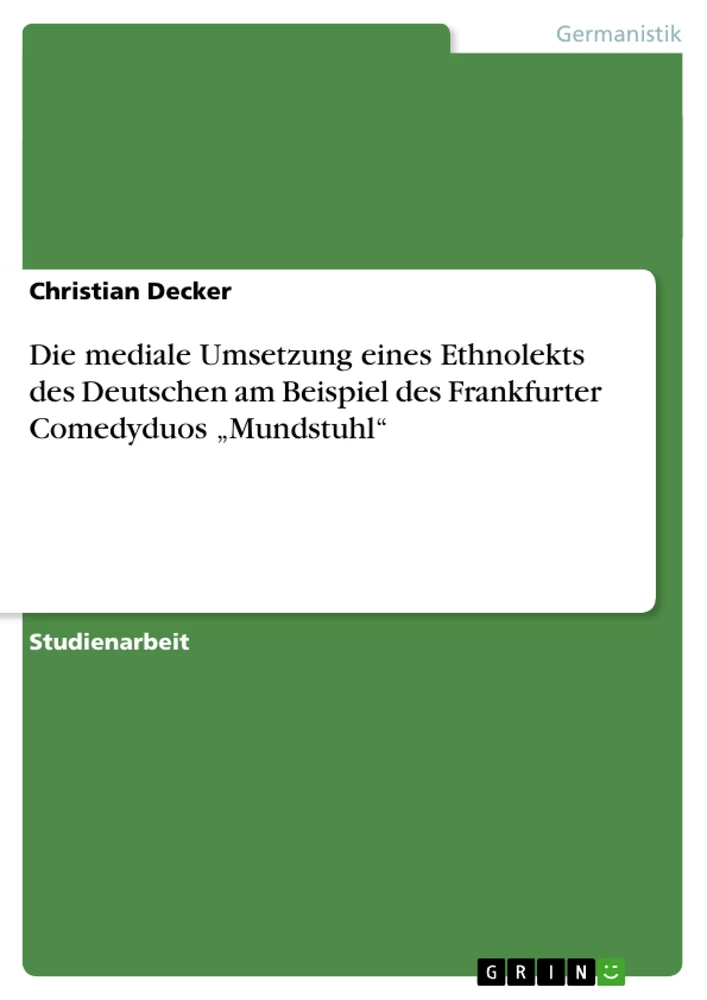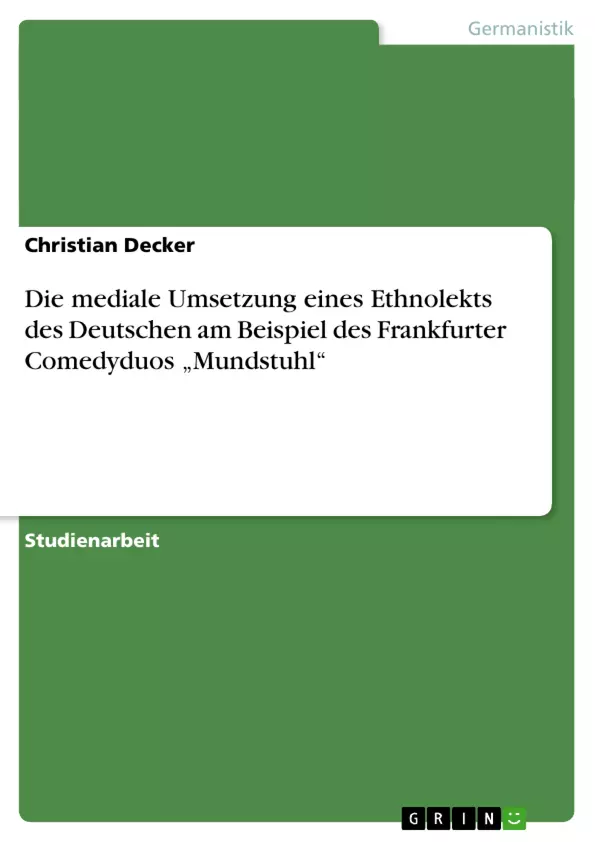Als wichtigster Vertreter eines Ethnolekts fließt der Türkenslang oder die Kanaksprak in die Sprechgewohnheiten der jungen Generation ein. Die Forschung auf diesem Gebiet beschränkt sich in bundesdeutschem Gebiet, soweit dies für die vorliegende Arbeit recherchiert wurde, auf wenige Autoren. Eine umfangreiche, empirische Datenerhebung zum Türkenslang wurde bisher nicht durchgeführt. Das grundlegende Problem der Ethnolektforschung scheint darin zu liegen, dass Ethnolekte nur schwer einzugrenzen sind, bzw. starken Veränderungen unterliegen. Die Untersuchung eines Ethnolekts scheitert bereits daran, dass die Sprecher ihn nicht konsequent verwenden. Erfolgt bei den Dialekten des Deutschen eine Einteilung nach geographischen Gesichtspunkten, so sind Ethnolekte stärker an soziale Gruppen bzw. gesellschaftliche Schichten gebunden. Die Sprecher identifizieren sich mit ihrer gesellschaftlichen Gruppe oder Clique durch ihren Ethnolekt. Abgegrenzt von den deutschen Standardsprechern entsteht so eine eigene sprachliche Insel. Die Ethnolektsprecher werden mit stereotypen Merkmalen versehen. Als gängige Klischees in Bezug auf junge Ethnolekt-Sprecher gelten beispielsweise ein provozierendes Auftreten und ständige Gewaltbereitschaft. Solche stereotypen Konstruktionen sind auch bei den Dialekten des Deutschen zu beobachten. Schwaben gelten beispielsweise als fleißig, und Sachsen als langsam. Diese stereotypen Merkmale von Dialekten dienen in vielen Kunstformen- ob Kabarett, Theater oder Fernsehen - der Parodie einzelner Personen oder ganzer Gruppen. Vielmehr als die Rezeption von Dialekten erfreut sich zur Zeit der Türkenslang in allen Medien größter Beliebtheit. Comedystars, Schauspieler und Kabarettisten machen sich den deutsch-türkischen Ethnolekt zu Nutze: Pro 7 sendet Erkan und Stefan, der SWR etabliert Taxi Sharia; Bülent Cylan, Django Asyl oder Mundstuhl bringen die Kanaksprak auf Kabarett- und Comedybühnen.
Nun funktioniert ein medial rezipierter Ethnolekt nach bestimmten Kriterien. Welche Kriterien das sind und welche Unterschiede ein medial aufbereiteter Ethnolekt gegenüber den realen Sprechgewohnheiten aufweist, das soll Inhalt dieser Arbeit sein. Als Medienvorlage dienen Ausschnitte von CD-Aufnahmen des Frankfurter Comedyduos Mundstuhl.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überblick über den Forschungsstand
- Türkenslang als Ethnolekt des Deutschen
- Die Stufen des Ethnolekts
- Sprachliche Merkmale des primären „Straßen“-Ethnolekts
- Sprachliche Merkmale der 2./3. Migrantengeneration
- Mixing
- Die Merkmale des Gastarbeiterdeutsches
- Die mediale Aufbereitung eines Ethnolekts in Mundstuhls Dragan und Alder
- Informationen zu Mundstuhl
- Das Konzept Dragan und Alder
- Der Ethnolekt von Dragan und Alder
- Vorgehensweise der Untersuchung
- Phonetisch/Phonologisch
- Morphosyntaktisch
- Zusammenfassung
- Literatur
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die mediale Umsetzung des Ethnolekts, speziell des Türkenslangs, am Beispiel des Frankfurter Comedyduos Mundstuhl. Sie analysiert die sprachlichen Merkmale des Türkenslangs und die Unterschiede zwischen dem realen „Straßenethnolekt“ und seiner stilisierten Darstellung in Mundstuhls Dragan und Alder-Sketchen. Die Arbeit beleuchtet die sprachliche Komponente sowie den handwerklich-künstlerischen Aspekt der medialen Inszenierung, wobei der Fokus auf den sozialen Aspekt des Ethnolekts und die Entstehung von Sprecher-Stereotypen liegt.
- Definition und Entwicklung des Begriffs „Ethnolekt“
- Sprachliche Merkmale des Türkenslangs
- Mediale Aufbereitung des Ethnolekts in Mundstuhls Dragan und Alder
- Unterschiede zwischen realem und medialem Ethnolekt
- Soziale Aspekte des Ethnolekts und Sprecher-Stereotype
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt die Relevanz des Themas und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Wie wird der Ethnolekt, insbesondere der Türkenslang, in den Medien dargestellt und welche Unterschiede bestehen zwischen dem realen Sprachgebrauch und der medial stilisierten Form? Kapitel zwei liefert einen Überblick über den Forschungsstand zum Ethnolekt, beleuchtet den Begriff „Ethnolekt“ und definiert verschiedene Stufen der Ethnolektentwicklung. Kapitel drei analysiert die sprachlichen Merkmale des „Straßenethnolekts“, insbesondere der 2./3. Migrantengeneration. Kapitel vier untersucht die mediale Aufbereitung des Ethnolekts in Mundstuhls Dragan und Alder, analysiert die sprachlichen Unterschiede zwischen dem realen Sprachgebrauch und der medial stilisierten Form sowie die handwerklich-künstlerischen Aspekte der medialen Inszenierung.
Schlüsselwörter
Ethnolekt, Türkenslang, Kanaksprak, Mundstuhl, Dragan und Alder, Mediale Umsetzung, Sprachliche Merkmale, Soziale Aspekte, Sprecher-Stereotype, Sprachforschung, Jugendsprache, Migrantensprache.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einem Ethnolekt?
Ein Ethnolekt ist eine Sprachvarietät, die von einer bestimmten ethnischen Gruppe in einem Sprachraum verwendet wird und sich durch spezifische Merkmale von der Standardsprache abhebt.
Welche Rolle spielt das Duo „Mundstuhl“ in dieser Untersuchung?
Das Frankfurter Comedyduo Mundstuhl dient als Beispiel für die mediale Aufbereitung eines Ethnolekts, insbesondere durch ihre Figuren „Dragan und Alder“, die den sogenannten „Türkenslang“ parodieren.
Was sind typische Klischees gegenüber Ethnolekt-Sprechern?
Häufige Stereotype sind ein provozierendes Auftreten, eine ständige Gewaltbereitschaft und eine Abgrenzung von der Standardsprachgesellschaft.
Worin unterscheidet sich der mediale Ethnolekt vom realen Sprachgebrauch?
Der mediale Ethnolekt ist oft stilisiert und überzeichnet, um komödiantische Effekte zu erzielen, während der reale „Straßenethnolekt“ komplexeren sozialen Regeln und Sprachmischungen folgt.
Welche sprachlichen Merkmale werden bei Mundstuhl analysiert?
Die Arbeit untersucht phonetische, phonologische sowie morphosyntaktische Merkmale, die für die Figuren Dragan und Alder charakteristisch sind.
- Arbeit zitieren
- M.A. Christian Decker (Autor:in), 2003, Die mediale Umsetzung eines Ethnolekts des Deutschen am Beispiel des Frankfurter Comedyduos „Mundstuhl“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47437