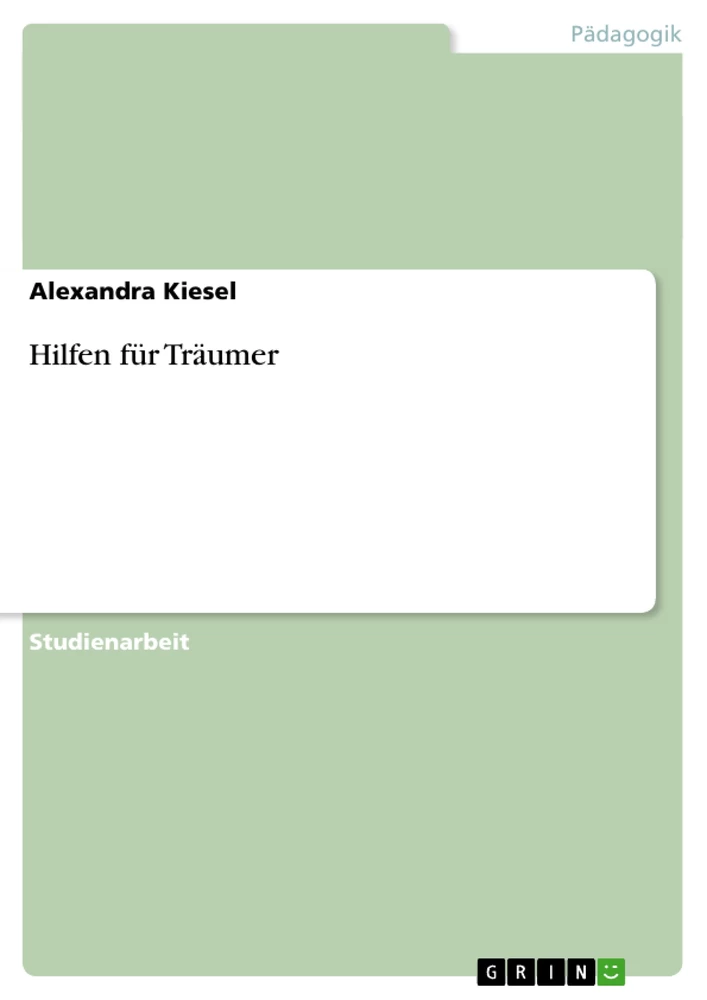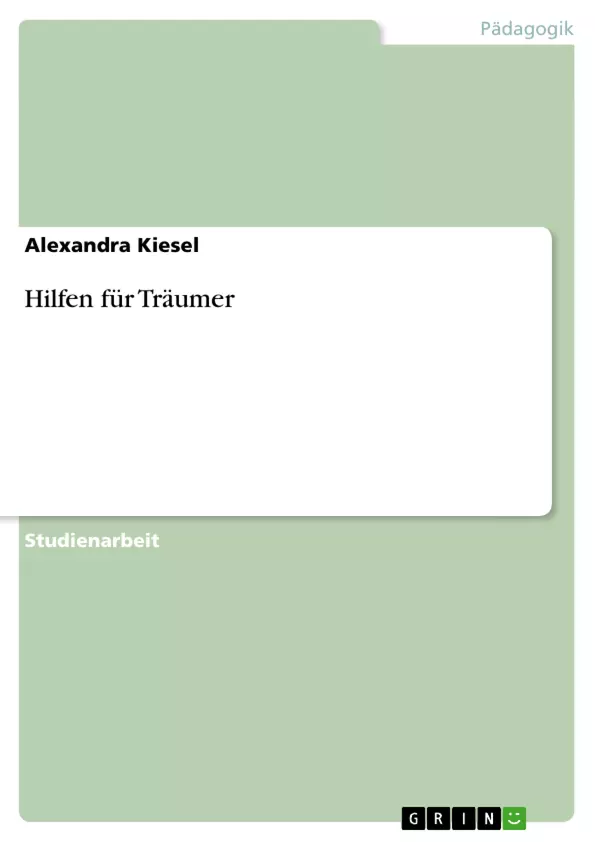Neurobiologisch hat das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom seine Ursache in einer Funktionsstörung des Stirnhirns und einiger Nervenzentren, mit denen das Stirnhirn in Verbindung steht.
Das Stirnhirn stabilisiert die Konzentration, das Verhalten, die Fein- und Grobmotorik, die emotionale Steuerung und die Fähigkeit, Außenreize zu filtern. Es außerdem verantwortlich für die Verhaltens- und Impulskontrolle und für die Wahrnehmungsverarbeitung.
Die Funktionsstörung äußert sich auf Neurotransmitterebene.
Neurotransmitter sind Botenstoffe, die die Hirntätigkeit erst ermöglichen, wie z.B. Dopamin, Katecholamin, Acetylcholin, Noradrenalin, Serotonin u.v.a. Welche Substanz hierbei vorwiegend betroffen ist und das gestörte Gleichgewicht im Zusammenspiel der verschiedenen Botenstoffe bedingt, entscheidet, ob das Kind hypo- oder hyperaktiv ist. Beides sind also zwei verschiedene Seiten ein und derselben Veranlagung.
Helga Simchen trifft hierfür in ihrem Buch “ADS-Unkonzentriert, verträumt, zu langsam und viele Fehler im Diktat” folgende Unterscheidung:
Eine Störung des Dopamin-Noradrenalin-Systems führt zu Hyperaktivität.
Eine zusätzliche Störung im Serotonin-Noradrenalinstoffwechsel führt zur Hypoaktivität.
Jedoch warnt sie auch davor, diese These zu verallgemeinern, da über die genauen Ursachen noch immer ein großer Forschungsbedarf besteht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Das hypoaktive Kind - was ist das für ein Kind?
- 1.1 Ursachen
- 1.2 Diagnostik
- 1.3 Symptome
- 2. Therapie des ADS mit Hypoaktivität (und Hyperaktivität)
- 2.1 Medikamentöse Therapie
- 2.2 Familientherapie
- 2.3 Psychotherapie
- 2.4 Verhaltenstherapie
- 2.4.1 Training der Daueraufmerksamkeit und Konzentration
- 2.4.2 Training der Grob-, Feinmotorik und Körperkoordination
- 2.4.3 Training bei Wahrnehmungsstörungen
- 2.5 Alternative Methoden
- 2.5.1 Diät
- 2.5.2 Kinesiologie
- 2.5.3 Akupunktur
- 2.5.4 Bachblüten
- 3. Schluss/ Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem hypoaktiven Kind im Kontext des Aufmerksamkeitsdefizit-Syndroms (ADS). Ziel ist es, die Ursachen, die Diagnostik und mögliche Therapieansätze für diese Kinder zu beleuchten. Der Fokus liegt dabei auf dem Verständnis der Besonderheiten hypoaktiver Kinder im Vergleich zu hyperaktiven Kindern mit ADS.
- Ursachen des Aufmerksamkeitsdefizit-Syndroms mit Hypoaktivität
- Diagnostische Verfahren zur Erkennung von ADS bei hypoaktiven Kindern
- Therapeutische Möglichkeiten, einschließlich medikamentöser und nicht-medikamentöser Ansätze
- Unterschiede zwischen hyperaktiven und hypoaktiven Kindern mit ADS
- Die Bedeutung des sozialen Umfelds bei der Entstehung und Behandlung von ADS
Zusammenfassung der Kapitel
1. Das hypoaktive Kind - was ist das für ein Kind?: Dieses Kapitel führt anhand von Beispielen (Nadja und Miro) in die Thematik des hypoaktiven Kindes mit ADS ein. Es verdeutlicht die Unterschiede im Erscheinungsbild zu hyperaktiven Kindern, wobei beide Gruppen unter dem gemeinsamen Nenner ADS zusammengefasst werden. Die Beschreibung der Kinder illustriert die Schwierigkeiten, die diese Kinder in Schule und Kindergarten erfahren, und unterstreicht den Bedarf an einer differenzierten Betrachtungsweise von ADS.
1.1 Ursachen: Dieser Abschnitt erörtert neurobiologische Theorien zur Entstehung von ADS. Im Zentrum steht die Funktionsstörung des Stirnhirns und die Rolle von Neurotransmittern wie Dopamin, Noradrenalin und Serotonin. Die Autorin diskutiert die Hypothese, dass ein Ungleichgewicht dieser Botenstoffe zu unterschiedlichen Ausprägungen von ADS (hypo- oder hyperaktiv) führt. Allerdings betont sie gleichzeitig den bestehenden Forschungsbedarf und die Komplexität der Ursachen, indem sie auf die Bedeutung psychosozialer Faktoren wie familiäre Beziehungen hinweist und eine rein neurobiologische Erklärung kritisch hinterfragt.
1.2 Diagnostik: Das Kapitel beschreibt die diagnostischen Schritte zur Feststellung von ADS bei Kindern. Es wird hervorgehoben, dass eine umfassende Diagnose die Berücksichtigung verschiedener Faktoren erfordert, darunter die Anamnese, die soziale Umgebung des Kindes, neurologische und psychologische Untersuchungen sowie Verhaltensbeobachtungen. Die Autorin betont die Notwendigkeit einer langfristigen Beobachtung und die Zusammenarbeit verschiedener Fachkräfte (z.B. Kinder- und Jugendpsychiater, Verhaltenstherapeuten).
1.3 Symptome: Hier werden die Symptome von ADS mit Hypoaktivität (im Gegensatz zu Hyperaktivität) beschrieben. Der Fokus liegt auf den charakteristischen Merkmalen hypoaktiver Kinder, wie Tagträumereien, langsamer Verrichtung von Aufgaben und Schwierigkeiten bei der Konzentration. Der Abschnitt vergleicht diese Symptome mit denen hyperaktiver Kinder mit ADS und betont die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise beider Ausprägungen.
Schlüsselwörter
Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADS), Hypoaktivität, Hyperaktivität, Neurotransmitter, Diagnostik, Therapie, Verhaltenstherapie, Familientherapie, neurobiologische Ursachen, psychosoziale Faktoren, Kinder, Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Das hypoaktive Kind - Ein umfassender Überblick
Was ist das Thema dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das hypoaktive Kind im Kontext des Aufmerksamkeitsdefizit-Syndroms (ADS). Es behandelt die Ursachen, Diagnostik und verschiedene Therapieansätze für hypoaktive Kinder mit ADS und vergleicht diese mit den hyperaktiven Formen des Syndroms.
Was sind die Hauptthemen des Dokuments?
Die Hauptthemen umfassen die Ursachen von ADS mit Hypoaktivität (einschließlich neurobiologischer und psychosozialer Faktoren), die Diagnostikverfahren zur Erkennung von ADS bei hypoaktiven Kindern, verschiedene Therapiemethoden (medikamentös und nicht-medikamentös, wie Verhaltenstherapie, Familientherapie, alternative Methoden), und einen Vergleich zwischen hyperaktiven und hypoaktiven Kindern mit ADS.
Welche Ursachen für ADS mit Hypoaktivität werden behandelt?
Das Dokument erörtert neurobiologische Theorien, die auf Funktionsstörungen des Stirnhirns und ein Ungleichgewicht von Neurotransmittern (Dopamin, Noradrenalin, Serotonin) hinweisen. Es betont jedoch auch die Bedeutung psychosozialer Faktoren und die Komplexität der Ursachen, wobei eine rein neurobiologische Erklärung kritisch hinterfragt wird.
Wie wird ADS mit Hypoaktivität diagnostiziert?
Die Diagnose von ADS bei hypoaktiven Kindern erfordert eine umfassende Betrachtung verschiedener Faktoren: Anamnese, soziale Umgebung des Kindes, neurologische und psychologische Untersuchungen sowie Verhaltensbeobachtungen. Eine langfristige Beobachtung und die Zusammenarbeit verschiedener Fachkräfte (z.B. Kinder- und Jugendpsychiater, Verhaltenstherapeuten) sind unerlässlich.
Welche Symptome kennzeichnen ein hypoaktives Kind mit ADS?
Im Gegensatz zu hyperaktiven Kindern zeigen hypoaktive Kinder mit ADS Symptome wie Tagträumereien, langsame Verrichtung von Aufgaben und Schwierigkeiten bei der Konzentration. Das Dokument betont die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise beider Ausprägungen von ADS.
Welche Therapieansätze werden im Dokument vorgestellt?
Das Dokument beschreibt verschiedene Therapieansätze, darunter medikamentöse Therapien, Familientherapie, Psychotherapie, und Verhaltenstherapie (mit Fokus auf Aufmerksamkeitstraining, Motoriktraining und Training bei Wahrnehmungsstörungen). Zusätzlich werden alternative Methoden wie Diät, Kinesiologie, Akupunktur und Bachblüten erwähnt.
Wie unterscheiden sich hyperaktive und hypoaktive Kinder mit ADS?
Das Dokument hebt die unterschiedlichen Erscheinungsbilder von hyperaktiven und hypoaktiven Kindern mit ADS hervor. Während hyperaktive Kinder durch Unruhe und Impulsivität auffallen, zeichnen sich hypoaktive Kinder durch Schwierigkeiten bei der Konzentration, Tagträumereien und eine langsamere Arbeitsweise aus. Beide Gruppen leiden jedoch unter dem gemeinsamen Nenner ADS.
Welche Rolle spielt das soziale Umfeld?
Das Dokument betont die Bedeutung des sozialen Umfelds sowohl bei der Entstehung als auch bei der Behandlung von ADS. Familiäre Beziehungen und die soziale Integration des Kindes spielen eine wichtige Rolle für den Therapieerfolg.
Gibt es Fallbeispiele?
Ja, das Dokument enthält Fallbeispiele (Nadja und Miro), die die Herausforderungen hypoaktiver Kinder in Schule und Kindergarten veranschaulichen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für dieses Thema?
Relevante Schlüsselwörter sind: Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADS), Hypoaktivität, Hyperaktivität, Neurotransmitter, Diagnostik, Therapie, Verhaltenstherapie, Familientherapie, neurobiologische Ursachen, psychosoziale Faktoren, Kinder, Entwicklung.
- Quote paper
- Alexandra Kiesel (Author), 2003, Hilfen für Träumer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47462