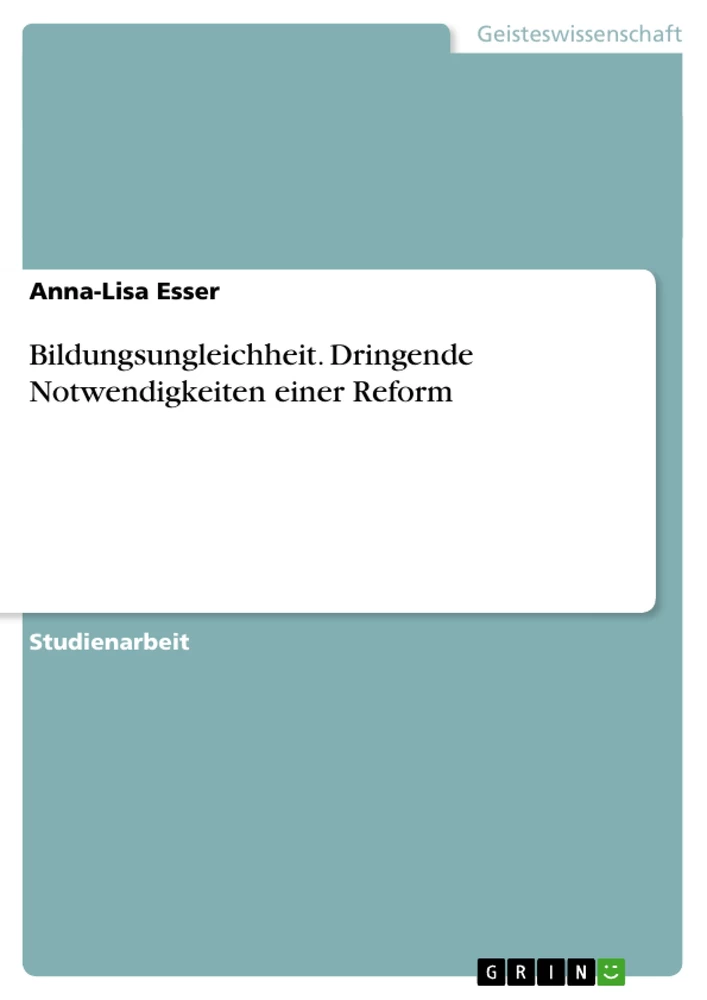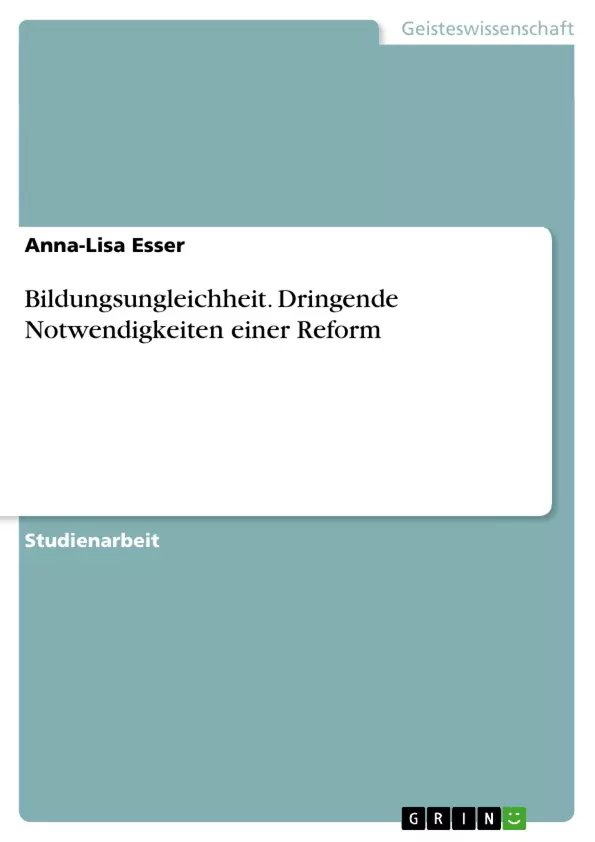"Armut hat schwarze Haare". So wurde ein Artikel in der Wochenzeitung „Die Zeit“ (Drieschner, 2003, 3) betitelt. Da Armut sich auch über mangelnde Bildung bedingt, kann man die Überschrift umformen und erhält: „Bildungsarmut hat schwarze Haare.“ Diese Aussage deutet an, dass Ausländerkinder weniger Chancen auf einen hohen Bildungsabschluss haben als deutsche Kinder. Das deutsche Bildungssystem ist - wie spätestens nach der PISA-Studie allgemein bekannt ist - nicht in der Lage, soziale Ungleichheit auszugleichen. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Schichtzugehörigkeit und Bildungsbenachteiligung; die soziale Herkunft hat in Deutschland massive Auswirkungen auf die Bildungskompetenz der Kinder. Ins Auge fallen vor allem gravierende Unterschiede der Bildungsbeteiligung und des Kompetenzerwerbs in Abhängigkeit von dem Migrationsstatus.
In der Bundesrepublik gilt jedoch die Forderung nach uneingeschränkter Chancengleichheit. Diese besagt im Bildungsbereich, dass alle entsprechend ihren Leistungen und Fähigkeiten gleiche Chancen zum Erwerb mittlerer oder höherer Bildungsabschlüsse haben sollen. In der vorliegenden Seminararbeit soll untersucht werden, inwieweit diesen Maßstäben genüge getan werden kann, was unter Bildungsgleichheit bzw. -ungleichheit zu verstehen ist und ob ausländische Schüler bzw. Schüler, deren Muttersprache nicht die Unterrichtssprache ist, tatsächlich stärker benachteiligt sind als deutsche Kinder. Der Schwerpunkt wird hier auf die unterschiedlichen erreichbaren Zugangsmöglichkeiten der einzelnen Schülergruppen gelegt. Zunächst soll ein Überblick über die verschiedenen Begriffe der Ungleichheit geschaffen und ihre Entstehungsgründe beleuchtet werden. Anschließend wird die Bildungsungleichheit im Allgemeinen skizziert, sowie die erschwerten Bildungsmöglichkeiten der ausländischen Kinder im Besonderen veranschaulicht werden. Daran anknüpfend sollen die Ursachen für diese Bildungsbarrieren herausgearbeitet werden. Schließlich soll zusammenfassend die Problematik im Bildungswesen und die dringende Notwendigkeit einer Reform dargestellt und der Frage nachgegangen werden, wodurch diese Bildungsbarrieren entstehen und wie sie möglicherweise behoben werden können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition der sozialen Ungleichheit und Schichtdifferenzierung
- 2.1. Soziale Ungleichheit – ein Definitionsversuch
- 2.2. Unterscheidungsmerkmale der sozialen Ungleichheit
- 2.3. Exkurs: Der Begriff Chancengleichheit
- 3. Bildungsexpansion und ihre Folgen
- 4. Bildungsungleichheit und die Merkmale für die unterschiedlichen Bildungschancen
- 4.1. Gleiche Bildungschancen für alle?
- 4.2. Sozioökonomische Lage des Elternhauses und kulturelles Kapital
- 4.3. Bildung und Berufstätigkeit (Humankapital) der Eltern
- 4.4. Familienstruktur und im Elternhaus gesprochene Sprache
- 4.5. Engagement und Kommunikation innerhalb der Familie und soziale Kompetenz
- 4.6. Soziale Auslese durch das Schulsystem
- 5. Bildungsungleichheit bei Kindern mit Migrationshintergrund
- 5.1. Größere Bildungsbarrieren für Ausländerkinder
- 5.2. Gründe für die Differenzierung in den Bildungswegen von Migranten
- 6. Fazit und mögliche Bildungsreformziele
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Bildungsungleichheit in Deutschland, insbesondere die Benachteiligung ausländischer Schüler. Die Arbeit analysiert, inwieweit die Forderung nach Chancengleichheit im Bildungssystem erfüllt wird und welche Faktoren zu unterschiedlichen Bildungserfolgen führen. Der Schwerpunkt liegt auf den Zugangsmöglichkeiten zu Bildung verschiedener Schülergruppen.
- Definition und Arten sozialer Ungleichheit
- Einfluss sozioökonomischer Faktoren auf Bildungschancen
- Besondere Herausforderungen für Kinder mit Migrationshintergrund
- Analyse des deutschen Bildungssystems im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit
- Mögliche Reformen zur Verbesserung der Chancengleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt mit einem provokanten Zitat den Zusammenhang zwischen Armut, mangelnder Bildung und der Benachteiligung von Ausländerkindern ein. Sie stellt die Problematik der sozialen Ungleichheit im deutschen Bildungssystem dar, die durch die PISA-Studie deutlich wurde. Die Arbeit fokussiert sich auf die Frage, inwieweit Chancengleichheit im Bildungssystem gegeben ist und wie stark ausländische Schüler benachteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf dem Zugang zu Bildung liegt. Es wird ein Überblick über die zu behandelnden Themen versprochen, beginnend mit einer Definition von Ungleichheit und einer Darstellung der Problematik im Allgemeinen und bei ausländischen Kindern im Besonderen.
2. Definition der sozialen Ungleichheit und Schichtdifferenzierung: Dieses Kapitel beginnt mit der Definition von sozialer Ungleichheit als Ergebnis unterschiedlicher Bewertungen von beruflichem Status, Einkommen und Vermögen. Es werden unterschiedliche Zugänge zu ökonomischen Ressourcen und Bildungsmöglichkeiten hervorgehoben. Der historische Wandel des Verständnisses von sozialer Ungleichheit von einer gottgegebenen Ordnung zu einem gesellschaftlichen Konstrukt wird beleuchtet. Die Rolle der meritokratischen Triade (Bildung, Beruf, Einkommen) wird diskutiert, und der Begriff der sozialen Schicht als vertikale Strukturierung der Güterverteilung wird erklärt. Schließlich wird der Unterschied zwischen vertikaler und horizontaler Ungleichheit erläutert, und die Bedeutung von sozialen Milieus wird erwähnt. Das Kapitel bildet die theoretische Grundlage für das Verständnis der Bildungsungleichheit.
3. Bildungsexpansion und ihre Folgen: (Kapitel fehlt im Ausgangstext und muss aus dem Kontext erschlossen werden. Hier wäre eine Beschreibung der Auswirkungen der Bildungsexpansion auf die soziale Ungleichheit notwendig, z.B. ob diese zu einer Reduzierung oder Verstärkung der Ungleichheit geführt hat).
4. Bildungsungleichheit und die Merkmale für die unterschiedlichen Bildungschancen: Dieses Kapitel behandelt die Faktoren, die zu unterschiedlichen Bildungschancen führen. Es wird die sozioökonomische Lage der Eltern, ihr kulturelles Kapital, Bildung und Beruf, Familienstruktur, die im Elternhaus gesprochene Sprache, sowie das Engagement und die Kommunikation innerhalb der Familie als wichtige Einflussfaktoren herausgestellt. Der Abschnitt über die soziale Auslese durch das Schulsystem weist auf die Rolle des Bildungssystems bei der Reproduktion sozialer Ungleichheit hin. Das Kapitel verdeutlicht die komplexen Zusammenhänge zwischen familiären und schulischen Faktoren und den Bildungsergebnissen.
5. Bildungsungleichheit bei Kindern mit Migrationshintergrund: Dieser Abschnitt fokussiert sich auf die zusätzlichen Herausforderungen, denen Kinder mit Migrationshintergrund im Bildungssystem begegnen. Er hebt die größeren Bildungsbarrieren hervor, die zu einer Differenzierung in den Bildungswegen führen. Die Ursachen dieser Unterschiede werden analysiert, wobei die Kombination verschiedener Benachteiligungen wahrscheinlich im Vordergrund steht.
Schlüsselwörter
Bildungsungleichheit, soziale Ungleichheit, Chancengleichheit, Migrationshintergrund, sozioökonomischer Status, kulturelles Kapital, Bildungssystem, soziale Auslese, Bildungsreform.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Bildungsungleichheit in Deutschland
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Bildungsungleichheit in Deutschland, insbesondere die Benachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund. Sie analysiert, inwieweit die Chancengleichheit im Bildungssystem erreicht wird und welche Faktoren zu unterschiedlichen Bildungserfolgen führen. Der Schwerpunkt liegt auf den Zugangsmöglichkeiten zu Bildung verschiedener Schülergruppen.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Arten sozialer Ungleichheit, Einfluss sozioökonomischer Faktoren auf Bildungschancen, besondere Herausforderungen für Kinder mit Migrationshintergrund, Analyse des deutschen Bildungssystems im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit und mögliche Reformen zur Verbesserung der Chancengleichheit.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Definition sozialer Ungleichheit und Schichtdifferenzierung, Bildungsexpansion und ihre Folgen, Bildungsungleichheit und die Merkmale für unterschiedliche Bildungschancen, Bildungsungleichheit bei Kindern mit Migrationshintergrund und Fazit mit möglichen Bildungsreformzielen. Jedes Kapitel wird in der Inhaltsangabe zusammengefasst.
Welche Faktoren beeinflussen die Bildungschancen laut der Seminararbeit?
Die Seminararbeit identifiziert verschiedene Faktoren, die die Bildungschancen beeinflussen: sozioökonomische Lage des Elternhauses, kulturelles Kapital der Eltern, Bildung und Beruf der Eltern, Familienstruktur, im Elternhaus gesprochene Sprache, Engagement und Kommunikation innerhalb der Familie und soziale Kompetenz. Das Schulsystem selbst spielt ebenfalls eine Rolle bei der sozialen Auslese.
Welche besonderen Herausforderungen bestehen für Kinder mit Migrationshintergrund?
Die Arbeit hebt hervor, dass Kinder mit Migrationshintergrund mit zusätzlichen Bildungsbarrieren konfrontiert sind, die zu einer Differenzierung in ihren Bildungswegen führen. Die Ursachen hierfür sind komplex und umfassen wahrscheinlich eine Kombination verschiedener Benachteiligungen.
Wie definiert die Seminararbeit soziale Ungleichheit?
Soziale Ungleichheit wird als Ergebnis unterschiedlicher Bewertungen von beruflichem Status, Einkommen und Vermögen definiert. Unterschiedliche Zugänge zu ökonomischen Ressourcen und Bildungsmöglichkeiten werden hervorgehoben. Der historische Wandel des Verständnisses von sozialer Ungleichheit wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Rolle spielt das Kapitel zur Bildungsexpansion?
Das Kapitel 3 (Bildungsexpansion und ihre Folgen) fehlt im Ausgangstext und muss aus dem Kontext erschlossen werden. Es soll die Auswirkungen der Bildungsexpansion auf die soziale Ungleichheit beschreiben, z.B. ob sie zu einer Reduzierung oder Verstärkung der Ungleichheit geführt hat.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Seminararbeit?
Das Fazit und die vorgeschlagenen Bildungsreformziele werden im letzten Kapitel präsentiert. (Der genaue Inhalt des Fazits ist im gegebenen Text nicht detailliert beschrieben).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Bildungsungleichheit, soziale Ungleichheit, Chancengleichheit, Migrationshintergrund, sozioökonomischer Status, kulturelles Kapital, Bildungssystem, soziale Auslese, Bildungsreform.
- Quote paper
- Anna-Lisa Esser (Author), 2003, Bildungsungleichheit. Dringende Notwendigkeiten einer Reform, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47467