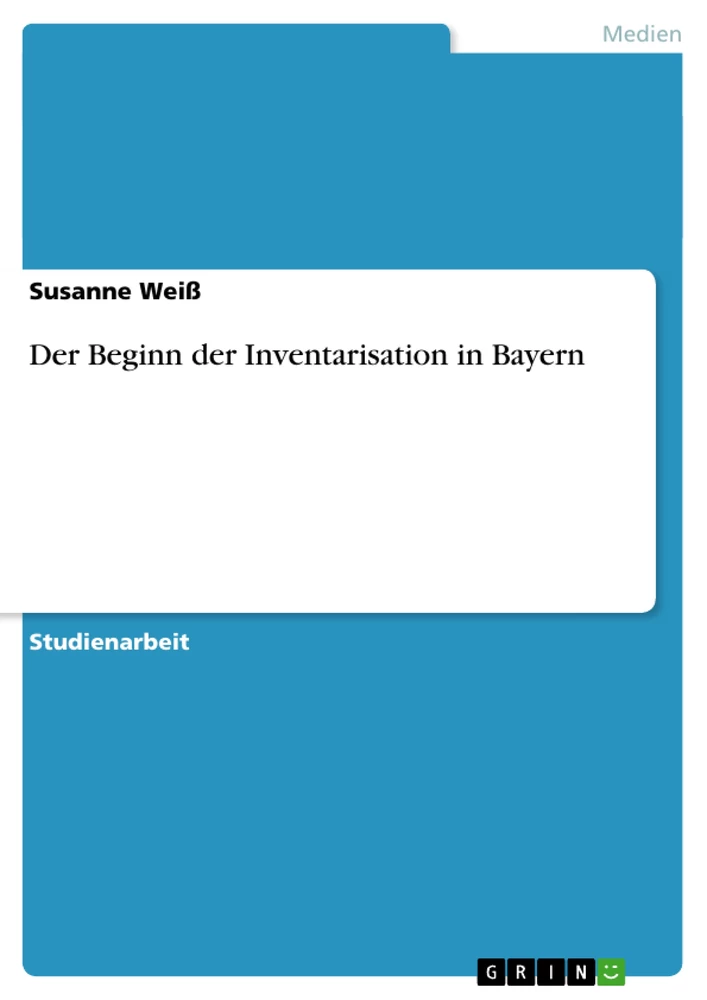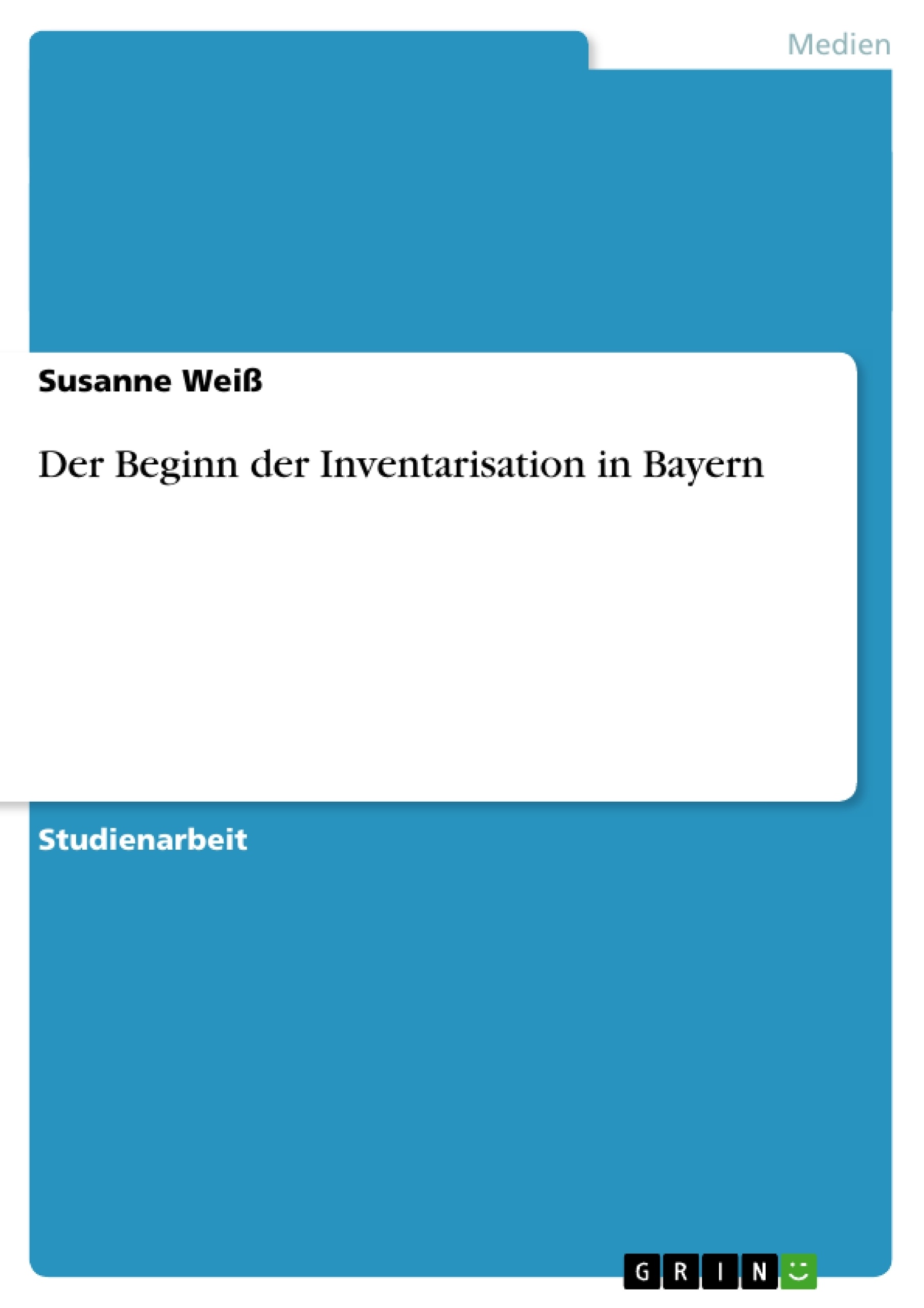Das Aufnehmen eines Bestandes, womit die Inventarisation am Einfachsten übersetzt werden kann, ist uns heute in seinen frühen Formen schon seit dem zweiten Jahrhundert vor Christus bekannt. Auch wenn das Verständnis für eine Inventarisation, so wie wir den Begriff heute verwenden und verstehen, nicht genau übereinstimmend mit damals ist, so wussten doch einige wenige Menschen um ihre Kultur und deren Erhaltungswert für die Nachwelt. Der Historiker Pausanias beschreibt in seinem Führer über Griechenland vor allem die Kunstwerke des Landes und ihrer damit verbundenen Mythologien.
Eine Weiterentwicklung erfährt diese Art der Inventarisation durch den visuellen Beitrag von Zeichnungen und Kupferstichen, in denen die Repräsentation des eigenen Hab und Gutes im Vordergrund stand und die selbst aber heute schon wieder als Inventare gelten, da sie uns tiefere Einblicke geben können, als wofür sie damals geschaffen wurden.
Nun inventarisieren wir Objekte um deren Existenz, ihren Erhaltungszustand und unsere eigene damit verbundene Kultur und Geschichte zu dokumentieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Beginn der Inventarisation in Bayern
- Die ersten Landbeschreibungen
- Die Inventarisation rückt ans Licht
- Georg Hager und seine Grundsätze der Inventarisation
- Beispiele für die Inventarisation nach der Zeit Hagers
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Abbildungen
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beleuchtet die Anfänge der Inventarisation von Kunstdenkmalen in Bayern. Sie verfolgt die Entwicklung von frühen Landbeschreibungen bis hin zu systematischen Bestandsaufnahmen im 19. Jahrhundert.
- Die Entwicklung der Inventarisation in Bayern von ihren Anfängen bis zum 19. Jahrhundert
- Die Bedeutung von Landbeschreibungen und visuellen Darstellungen als Vorläufer der systematischen Inventarisation
- Die Rolle von Georg Hager und seine Grundsätze für die Inventarisation
- Beispiele für die Inventarisation im Königreich Bayern nach der Zeit Hagers
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert einen einführenden Überblick über den Begriff der Inventarisation und ihre historische Entwicklung. Kapitel 2 befasst sich mit den ersten Landbeschreibungen in Bayern, die als Vorläufer der systematischen Inventarisation betrachtet werden können. Dazu zählen unter anderem die Werke von Philipp Apian, Hans Thonauer und Matthäus Merian d. Ä. Kapitel 2.1 widmet sich dem "Churbayrischen Atlas" von Anton Wilhelm Ertl und analysiert seine Beschreibungen von Orten wie Rosenheim und Schrobenhausen. Die Historicotopographica Descriptio von Michael Wening wird ebenfalls in diesem Kontext vorgestellt.
Kapitel 3.2 beleuchtet die beginnende Institutionalisierung der Inventarisation unter Kurfürst Maximilian Emanuel. Das Kapitel 3.3 widmet sich Georg Hager und seinen Grundsätzen für die Inventarisation.
Schlüsselwörter
Inventarisation, Kunstdenkmäler, Landbeschreibungen, Bayern, Georg Hager, Churbayrischer Atlas, Historicotopographica Descriptio, Michael Wening, Philipp Apian, Hans Thonauer, Matthäus Merian d. Ä., Anton Wilhelm Ertl, Kurfürst Maximilian Emanuel
- Arbeit zitieren
- Susanne Weiß (Autor:in), 2005, Der Beginn der Inventarisation in Bayern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47551