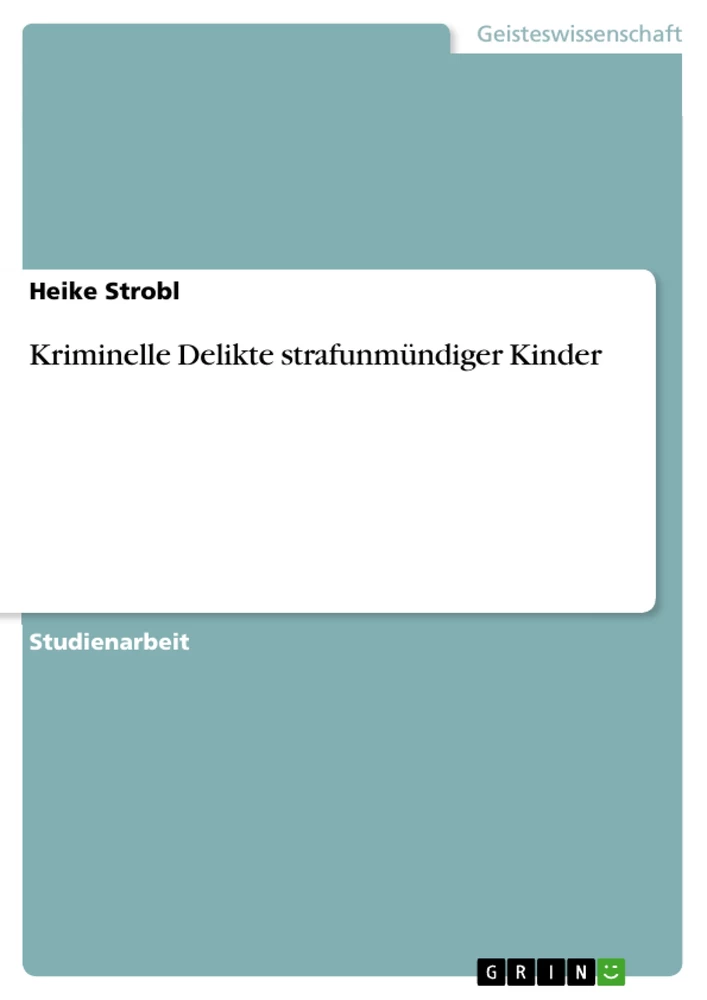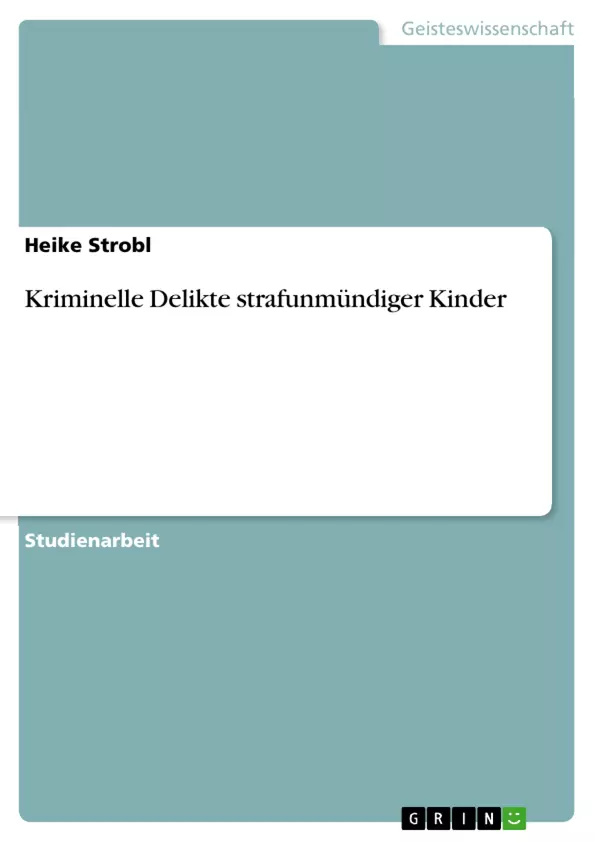Vorwort
Während in Teil I des Referates von Frau Böker aktuelles Datenmaterial über Umfang und Ausmaß delinquenten Handelns von Kindern gesammelt und kritisch beleuchtet wurde, möchte ich mich im zweiten Teil mit den Ergebnissen der Ursachenforschung auseinandersetzen.
Die Entstehung von (Kinder-) Kriminalität wird seit vielen Jahren mit unterschiedlichsten Mitteln und Herangehensweisen wissenschaftlich untersucht. Sind die Entstehungstheorien noch so unterschiedlich oder gar widersprüchlich, so kommen doch alle seriösen Studien zu dem Ergebnis, daß delinquentes Verhalten im Kindesalter in den allermeisten Fällen nicht als Kriminalität zu werten ist. Meist verfügen die Kinder noch nicht über ein entsprechendes Normenbewußtsein und sind zum Zeitpunkt der Tat noch nicht in der Lage diese als Unrecht zu erkennen. Der größte Teil aller, von Kindern begangenen Straftaten befinden sich im Bereich der Bagatelldelikte und können als „normaler Entwicklungsschritt“ eines Kindes gewertet werden. (vgl. Kapitel 1) Desweiteren ist ein bestimmter Anteil der Delikte auf eine Gruppe von Kindern zurückzuführen, die systematisch zu kriminellen Handlungen gezwungen werden. (vgl. Deutsches Jugendinstitut e. V.1999, 30 - 31)
Allerdings läßt sich durchaus auch eine kleine Gruppe von Kindern feststellen, die gehäuft schwere Straftaten begehen (sogenannte Mehrfach- bzw. Intensivtäter). Dieses Verhalten ist Ausdruck schwerwiegender Dissozialität. Während oben beschriebenes delinquentes Verhalten selten eine Fortführung im Jugend- oder gar Erwachsenenalter findet, sind Mehrfach- und Intensivtäter stark gefährdet auch in ihrer weiteren Entwicklung kriminelle Handlungen zu begehen. In der folgenden Arbeit befasse ich mich mit eben dieser Gruppe.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Kriminelle Delikte strafunmündiger Kinder
- Ursachen delinquenten Verhaltens von Kindern
- Vier Theorien zur Entstehung delinquenten Verhaltens
- Biologisches Modell
- Anomietheorien
- Sozialisationstheorien
- Selektionstheorien
- Hypothetische Wechselwirkung von Sozialisation und Selektion
- Vier Theorien zur Entstehung delinquenten Verhaltens
- Erfahrungsberichte aus der Praxis
- Verantwortungsebenen für die Verhinderung von Kinderdelinquenz
- Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Ursachen kriminellen Verhaltens strafunmündiger Kinder, insbesondere der Gruppe der Mehrfach- und Intensivtäter. Sie analysiert verschiedene Theorien zur Entstehung von Delinquenz und beleuchtet die Problematik der Datenerfassung im Bereich der Kinderkriminalität. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit bestehenden Erklärungsmodellen und der Einordnung von abweichendem Verhalten im Kindesalter.
- Analyse verschiedener Theorien zur Entstehung delinquenten Verhaltens bei Kindern (biologische, anomie-, sozialisationstheoretische Ansätze).
- Kritik an der Datenerfassung und der Interpretation von Kriminalstatistiken im Kontext von Kinderkriminalität.
- Untersuchung des Einflusses sozialer und familiärer Faktoren auf die Entwicklung delinquenten Verhaltens.
- Betrachtung der Mehrfach- und Intensivtäter als besondere Gruppe.
- Überlegungen zu präventiver Arbeit und Reaktionen auf Kinderkriminalität (allgemein, ohne detaillierte Lösungsansätze).
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Dieses Vorwort führt in die Arbeit ein und beschreibt den Fokus des zweiten Teils des Referats, welcher sich mit den Ursachen der Kinderkriminalität auseinandersetzt. Es wird betont, dass delinquentes Verhalten im Kindesalter meist nicht als Kriminalität im eigentlichen Sinne zu werten ist und häufig als normaler Entwicklungsschritt angesehen werden kann. Der Fokus dieser Arbeit liegt jedoch auf der kleinen Gruppe von Mehrfach- und Intensivtätern, deren Verhalten Ausdruck schwerwiegender Dissozialität ist und ein höheres Risiko für zukünftige kriminelle Handlungen darstellt.
1. Ursachen delinquenten Verhaltens von Kindern: Dieses Kapitel behandelt die Schwierigkeiten bei der Erfassung von Daten im Bereich der Kinderkriminalität. Es wird deutlich gemacht, dass Kriminalstatistiken lediglich das „Hellfeld“ abbilden und eine hohe Dunkelziffer besteht. Der Text argumentiert, dass Kinder aufgrund von gesellschaftlicher Toleranz und informellen Konfliktregelungen seltener angezeigt werden als Jugendliche oder Erwachsene. Es wird auf die Bedeutung von Faktoren wie die Siedlungsdichte und die Verfügbarkeit von Spielräumen für das kindliche Verhalten hingewiesen. Abschließend werden vier Modelle zur Erklärung delinquenten Verhaltens – biologische, Anomie-, Sozialisations- und Selektionstheorien – angekündigt.
1.1 Vier Theorien zur Entstehung delinquenten Verhaltens: Dieses Kapitel stellt vier Theorien zur Entstehung delinquenten Verhaltens vor, die sich auf die Gruppe der Mehrfach- und Intensivtäter beziehen. Das biologische Modell wird vorsichtig diskutiert, wobei die Grenzen biologischer Erklärungen hervorgehoben werden und der Einfluss von Umweltfaktoren betont wird. Das Beispiel des Klinefelter-Syndroms veranschaulicht die Interaktion von biologischen und sozialen Faktoren. Die Anomietheorie wird als soziologischer Ansatz erklärt, der gesellschaftliche Widersprüche und die daraus resultierenden Dissonanzen als Ursachen für delinquentes Verhalten beschreibt. Es wird der Unterschied zwischen reaktiver und innovativer Delinquenz erläutert. Abschließend wird auf die Sozialisationstheorien eingegangen, die Defizite in der sozioökonomischen Situation, der außerfamilialen Interaktion und der familiären Kommunikation als Risikofaktoren für delinquentes Verhalten hervorheben.
Schlüsselwörter
Kinderkriminalität, Delinquenz, Mehrfach- und Intensivtäter, Kriminalstatistik, Dunkelziffer, Biologische Modelle, Anomietheorien, Sozialisationstheorien, Prävention, Risikofaktoren, familiäre Strukturen, gesellschaftliche Faktoren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ursachen kriminellen Verhaltens strafunmündiger Kinder
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Ursachen kriminellen Verhaltens bei strafunmündigen Kindern, insbesondere bei Mehrfach- und Intensivtätern. Sie analysiert verschiedene Theorien zur Entstehung von Delinquenz und beleuchtet die Herausforderungen der Datenerfassung im Bereich der Kinderkriminalität. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit bestehenden Erklärungsmodellen und der Einordnung abweichenden Verhaltens im Kindesalter.
Welche Theorien zur Entstehung von Delinquenz werden behandelt?
Die Arbeit betrachtet vier Haupttheorien: biologische Modelle (mit Betonung der Interaktion von biologischen und sozialen Faktoren), Anomietheorien (die gesellschaftliche Widersprüche als Ursache für Delinquenz sehen), Sozialisationstheorien (die Defizite in der Sozialisation als Risikofaktoren hervorheben) und Selektionstheorien (die einen Zusammenhang zwischen individuellen Merkmalen und Delinquenz postulieren). Der Text diskutiert diese kritisch und beleuchtet deren Grenzen und Stärken im Kontext von Kinderkriminalität.
Wie wird die Problematik der Datenerfassung in der Kinderkriminalität dargestellt?
Die Arbeit betont die Schwierigkeiten bei der Erfassung von Daten im Bereich der Kinderkriminalität. Kriminalstatistiken bilden nur das „Hellfeld“ ab und die Dunkelziffer ist hoch. Kinder werden aufgrund von gesellschaftlicher Toleranz und informellen Konfliktregelungen seltener angezeigt als Jugendliche oder Erwachsene. Faktoren wie Siedlungsdichte und die Verfügbarkeit von Spielräumen beeinflussen das kindliche Verhalten und die Wahrscheinlichkeit einer Anzeige.
Welche Rolle spielen soziale und familiäre Faktoren?
Soziale und familiäre Faktoren spielen eine entscheidende Rolle. Die Sozialisationstheorien heben Defizite in der sozioökonomischen Situation, der außerfamiliären Interaktion und der familiären Kommunikation als Risikofaktoren hervor. Die Arbeit untersucht den Einfluss dieser Faktoren auf die Entwicklung delinquenten Verhaltens, insbesondere bei Mehrfach- und Intensivtätern.
Wie werden Mehrfach- und Intensivtäter behandelt?
Mehrfach- und Intensivtäter werden als besondere Gruppe betrachtet, deren Verhalten Ausdruck schwerwiegender Dissozialität ist und ein höheres Risiko für zukünftige kriminelle Handlungen darstellt. Die Arbeit analysiert die Ursachen ihres Verhaltens im Kontext der verschiedenen Theorien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Vorwort, Kriminelle Delikte strafunmündiger Kinder, Ursachen delinquenten Verhaltens von Kindern (inkl. vier Theorien: biologisches Modell, Anomietheorien, Sozialisationstheorien, Selektionstheorien und die hypothetische Wechselwirkung von Sozialisation und Selektion), Erfahrungsberichte aus der Praxis, Verantwortungsebenen für die Verhinderung von Kinderdelinquenz und Literaturangaben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kinderkriminalität, Delinquenz, Mehrfach- und Intensivtäter, Kriminalstatistik, Dunkelziffer, Biologische Modelle, Anomietheorien, Sozialisationstheorien, Prävention, Risikofaktoren, familiäre Strukturen, gesellschaftliche Faktoren.
Gibt es Lösungsansätze oder konkrete Präventionsmaßnahmen in der Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Ursachen von Kinderkriminalität und die kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Erklärungsmodellen. Konkrete detaillierte Lösungsansätze und Präventionsmaßnahmen werden nicht im Detail behandelt, jedoch werden Überlegungen zu präventiver Arbeit und Reaktionen auf Kinderkriminalität angesprochen.
- Quote paper
- Heike Strobl (Author), 2000, Kriminelle Delikte strafunmündiger Kinder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/476