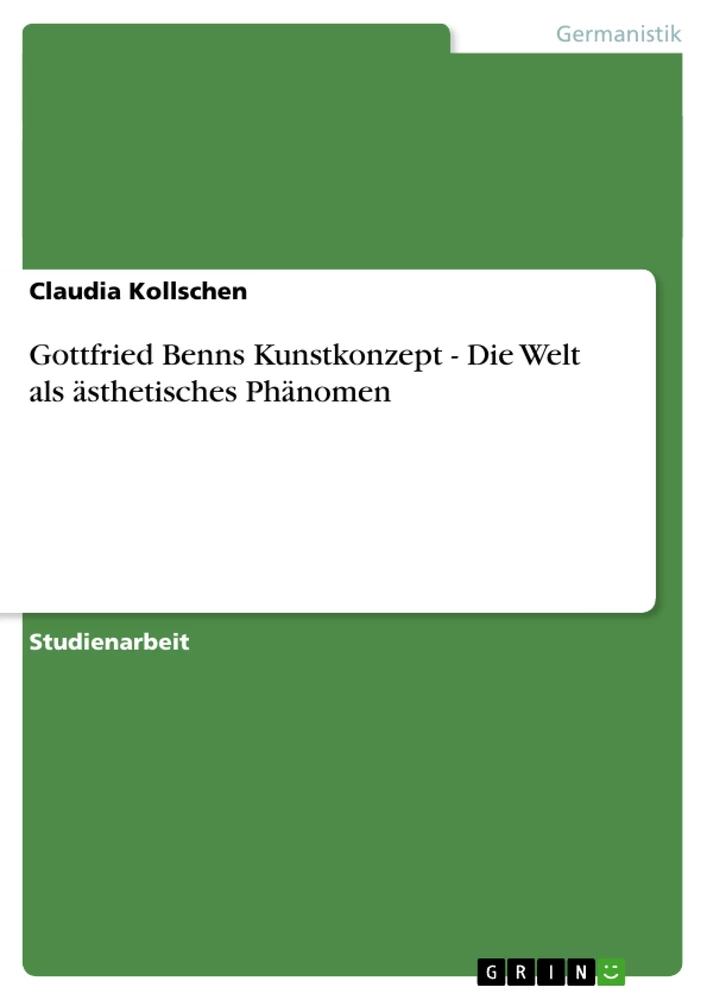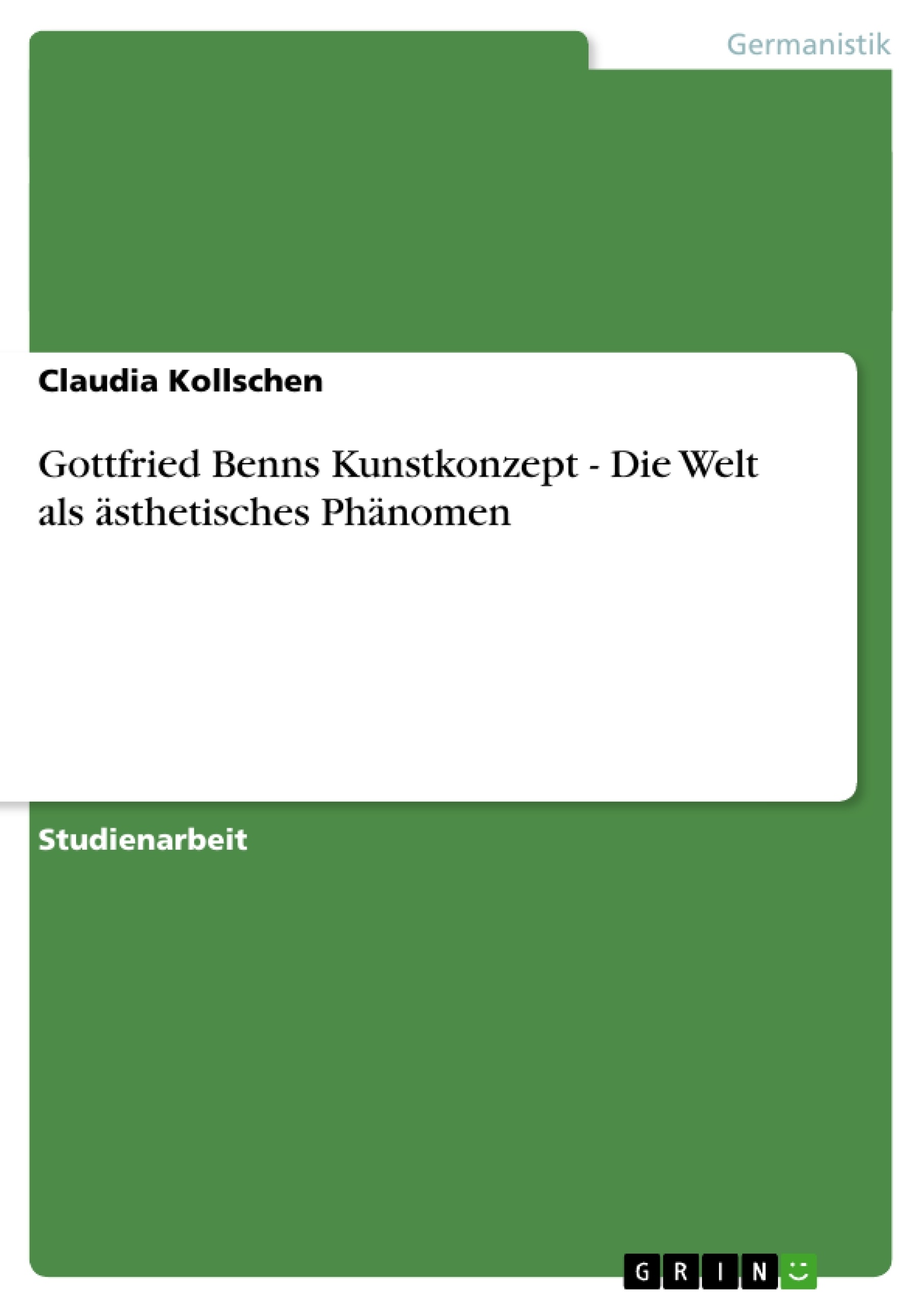Gottfried Benn hat sich im Laufe seines Lebens oft und ausgiebig mit dem Künstler und der Kunst an sich beschäftigt, so ab 1930 mit Person und Psyche des Künstlers, ab 1931 in erster Linie mit der Sache und der Leistung der Kunst. In der vorliegenden Arbeit wird Gottfried Benns Verständnis von Kunst und Künstler untersucht, vorrangig anhand seiner Essays, Reden und Vorträge und nur am Rande anhand literarischer Werke.
Benns Entwicklung führte zunehmend zu einer Kunst- und auch Lebensauffassung, die auf Form und Stil, eine ausgeprägte Ästhetik gerichtet war, nicht nur im Kontrast zu einem Inhalt, sondern auch in Bezug auf Menschen und Gesellschaft sowie Politik und Geschichte. Auch die aktive Teilhabe an Fragen der Zeit, gar im Sinne des Anstrebens von Veränderungen, war bis auf eine kurze Phase zu Beginn der Herrschaft des Nationalsozialismus 1933/34 nicht in Benns Sinne. Jegliche Wirkungsabsichten wurden negiert, die Zweckfreiheit von Kunst propagiert und ebendiese Kunst absolut gesetzt; ein Rückzug aus dem sozialen Feld zugunsten der Ästhetik, was schließlich darin gipfelte, die Welt als ästhetisches Phänomen zu betrachten – in Anlehnung an Friedrich Nietzsche – und diese Interpretation mit allen Konsequenzen als alleinige Realität zu akzeptieren. Die Welt wird Kunst und Kunst wird Lebensinhalt und Sinn. Um diese Aspekte soll es gehen.
Zugleich wird kritisch beleuchtet werden, wie Benn das Setzen der Alleingültigkeit von Form und Stil in Bezug zur benannten Zweckfreiheit und Wirkungslosigkeit möglicherweise – bewusst oder unbewusst – nutzt, um sich politisch und gesellschaftlich zu entlasten, was seine unrühmliche Rolle zu Beginn des Nationalsozialismus betrifft.
Die vorliegende Arbeit orientiert sich primär am Aufbau des Textes „Probleme der Lyrik“ (1951) (IV, 1058-1096) von Gottfried Benn selbst. Hier finden sich als Essenz die vollständig entwickelten ästhetischen Ansichten Benns – ausgeführt anhand der Lyrik, aber ebenso auf andere Bereiche übertragbar – gegen Ende seines Lebens, somit zum Abschluss seiner Entwicklungen. Wesentliche Ansichten zu oben genannten Themen können extrahiert, entwickelt und kritisch beleuchtet werden unter Zuhilfenahme weiterer Texte.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Das Wort statt „Stimmung“
- 2. Friedrich Nietzsche
- 3. Die Aufgaben der Kunst und des Künstlers
- 4. Das Monologische
- 5. Die Wirklichkeit
- 5.1 Der Lyriker - ein Realist?
- 5.2 Der Mimesis-Begriff und die ästhetische Eigenwelt
- 6. Die Form
- 6.1 Die Statik
- 6.2 Die absolute Kunst
- 6.3 Benn – ein Ästhetizist?
- 7. Die Bedeutung des Inhalts
- 8. Die Autarkie
- 9. Das Wesen des Künstlers
- 10. Der Künstler im Gegensatz
- 10.1 Der Staat und Kunst & Kultur
- 10.2 Die „Mitte“ und der Künstler als „Kranker“
- 10.3 Asozialität von Dichtung“ - Benn und soziale Bezüge
- 11. Kommunikation und Rezeption
- 12. Die Wirkungslosigkeit
- 13. Die Zweckfreiheit der Kunst
- 13.1 Politische Zweckfreiheit
- 13.2 Moralische Zweckfreiheit
- 14. Das Zurückweisen von Verantwortung und das Verwerfen von Handeln
- III. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Gottfried Benns Kunstverständnis, insbesondere seine Auffassung von Kunst und Künstler anhand seiner Essays, Reden und Vorträge. Der Fokus liegt auf Benns Entwicklung hin zu einer auf Form und Stil ausgerichteten Ästhetik, die im Kontrast zu Inhalt, Gesellschaft und Politik steht. Die Arbeit beleuchtet Benns Ablehnung jeglicher Wirkungsabsichten, seine Propagierung der Zweckfreiheit von Kunst und seinen Rückzug aus dem sozialen Feld zugunsten der Ästhetik.
- Benns ästhetische Theorie und ihre Entwicklung
- Der Einfluss Friedrich Nietzsches auf Benns Kunstverständnis
- Benns Konzept der Zweckfreiheit der Kunst
- Die Rolle des Künstlers in Gesellschaft und Politik nach Benn
- Benns Verhältnis von Form und Inhalt in der Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Fokus der Arbeit auf Gottfried Benns Verständnis von Kunst und Künstler. Sie skizziert Benns Entwicklung hin zu einer stark ästhetisch ausgerichteten Kunstauffassung, die sich von gesellschaftlichen und politischen Engagements abgrenzt und die Zweckfreiheit der Kunst betont. Die Einleitung benennt die zentralen Fragestellungen und den methodischen Ansatz der Arbeit, der sich an Benns eigenem Text „Probleme der Lyrik“ orientiert.
II. Hauptteil: Der Hauptteil analysiert detailliert Benns ästhetische Theorie. Er untersucht Benns Abgrenzung von emotionalen und thematischen Aspekten in der Lyrik und betont die Bedeutung des Wortes an sich. Der Einfluss von Friedrich Nietzsche auf Benns Denken wird behandelt, ebenso wie die Rolle des Künstlers im gesellschaftlichen Kontext und seine Ablehnung von Verantwortung und Handlung.
Schlüsselwörter
Gottfried Benn, Ästhetik, Kunst, Künstler, Zweckfreiheit, Form, Inhalt, Lyrik, Nietzsche, Wirkungslosigkeit, Gesellschaft, Politik, Verantwortung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Gottfried Benns Kunstverständnis
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Gottfried Benns Kunstverständnis, insbesondere seine Auffassung von Kunst und Künstler anhand seiner Essays, Reden und Vorträge. Der Fokus liegt auf Benns Entwicklung hin zu einer auf Form und Stil ausgerichteten Ästhetik, die im Kontrast zu Inhalt, Gesellschaft und Politik steht. Die Arbeit beleuchtet Benns Ablehnung jeglicher Wirkungsabsichten, seine Propagierung der Zweckfreiheit der Kunst und seinen Rückzug aus dem sozialen Feld zugunsten der Ästhetik.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Benns ästhetische Theorie und deren Entwicklung, den Einfluss Friedrich Nietzsches auf Benns Kunstverständnis, Benns Konzept der Zweckfreiheit der Kunst, die Rolle des Künstlers in Gesellschaft und Politik nach Benn und das Verhältnis von Form und Inhalt in Benns Kunst.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil mit detaillierten Analysen zu verschiedenen Aspekten von Benns Kunstverständnis (z.B. das Wort statt „Stimmung“, Nietzsche's Einfluss, die Aufgaben der Kunst, Wirklichkeit und Mimesis, Form und absolute Kunst, das Wesen des Künstlers, der Künstler im Gegensatz zu Staat und Gesellschaft, Kommunikation und Rezeption, Zweckfreiheit der Kunst etc.) und eine Schlussbemerkung.
Wie ist der Hauptteil strukturiert?
Der Hauptteil untersucht detailliert Benns ästhetische Theorie. Er analysiert Benns Abgrenzung von emotionalen und thematischen Aspekten in der Lyrik, betont die Bedeutung des Wortes an sich, behandelt den Einfluss Friedrich Nietzsches, die Rolle des Künstlers im gesellschaftlichen Kontext und Benns Ablehnung von Verantwortung und Handlung. Die Struktur ist in nummerierte Abschnitte und Unterabschnitte unterteilt, die verschiedene Aspekte von Benns Kunstverständnis systematisch behandeln.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter, die die Arbeit prägnant beschreiben, sind: Gottfried Benn, Ästhetik, Kunst, Künstler, Zweckfreiheit, Form, Inhalt, Lyrik, Nietzsche, Wirkungslosigkeit, Gesellschaft, Politik, Verantwortung.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Der methodische Ansatz orientiert sich an Benns eigenem Text „Probleme der Lyrik“ und analysiert Benns Schriften, um sein Kunstverständnis zu rekonstruieren und zu interpretieren.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These ist, dass Gottfried Benns Kunstverständnis durch eine starke Betonung von Form und Stil über Inhalt und gesellschaftliche Relevanz geprägt ist und sich durch eine konsequente Ablehnung jeglicher Zweckbindung und einen Rückzug in die Autarkie der Kunst auszeichnet.
- Quote paper
- Claudia Kollschen (Author), 2003, Gottfried Benns Kunstkonzept - Die Welt als ästhetisches Phänomen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47617