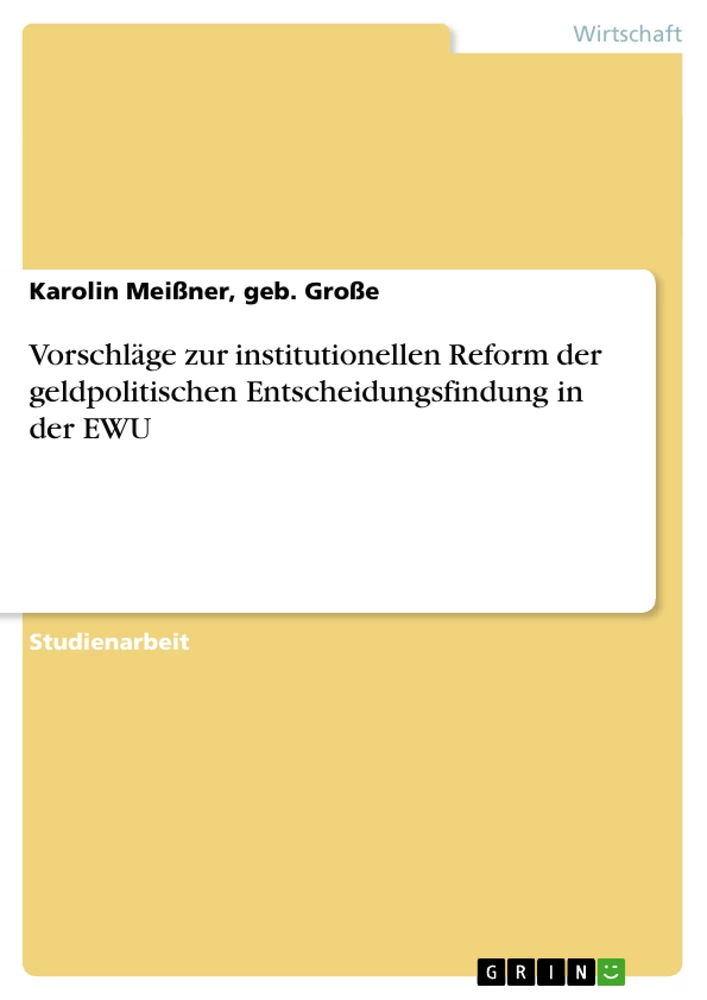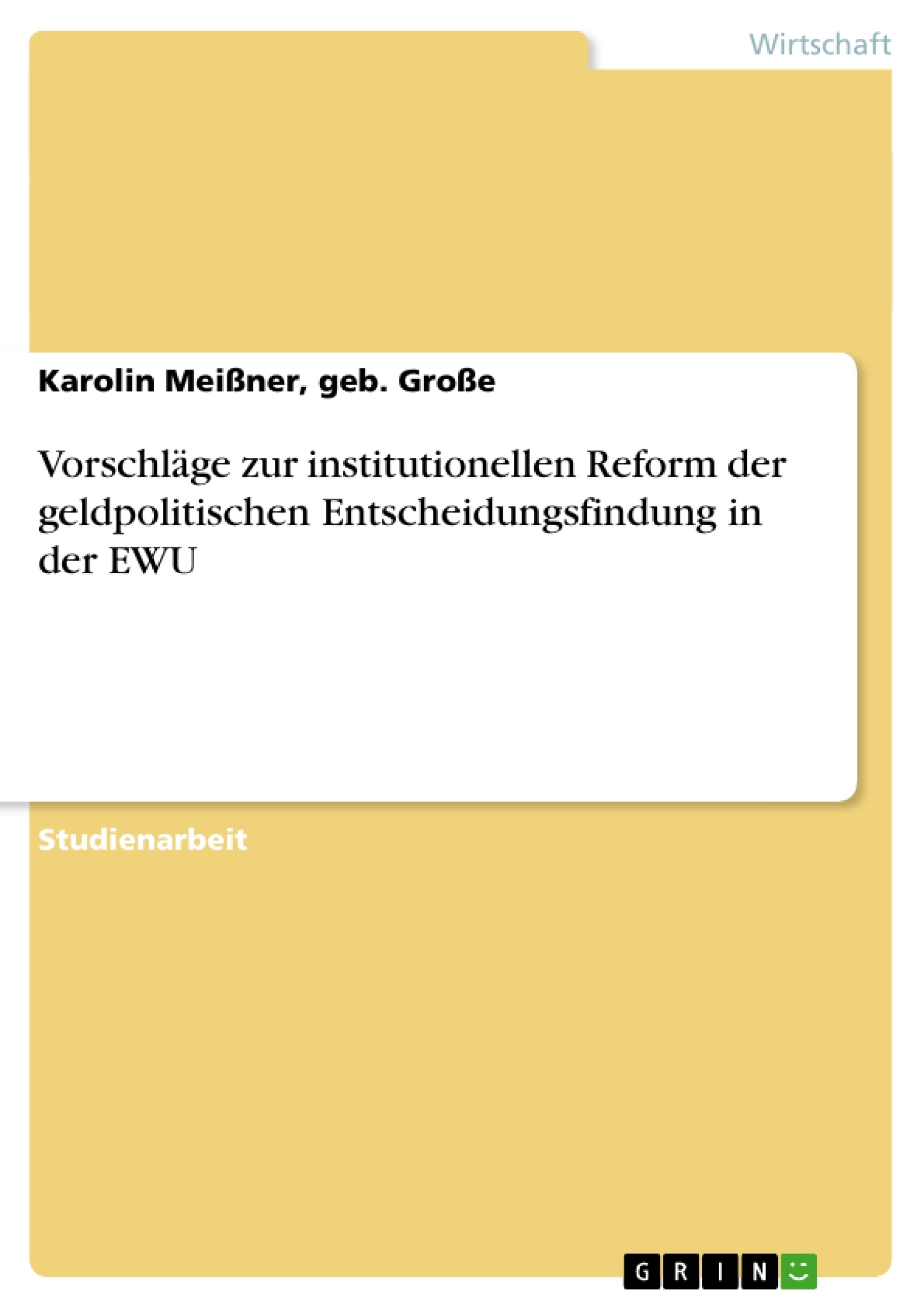Seit dem 1. Januar 1999 ist die Europäische Zentralbank (EZB) für die Geldpolitk des Euro-Währungsgebiets verantwortlich. Für diese Aufgabe der Vorbereitung und Umsetzung der Geldpolitik besitzt die EZB zwei Beschlussorgane, den EZB-Rat und das EZB-Direktorium. Das EZB-Direktorium besteht aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten der EZB sowie vier weiteren Mitgliedern, die alle einvernehmlich von den Staats- und Regierungsschefs der Länder des Euroraums ernannt werden. Demgegenüber setzt sich der EZB-Rat aus dem EZB-Dirketorium und den Präsidenten der nationalen Zentralbanken (NZB-Präsidenten) des Euro-Währungsgebietes zusammen). Während das EZB-Direktorium aus konstant sechs Mitgliedern besteht, wird die Zahl der EZB-Rats-Mitglieder von derzeit 18 auf bis zu 33 Mitglieder ansteigen. Ursache dieses voraussichtlich ab 2006 beginnenden Mitgliederanstiegs ist die geplante Euroraum-Erweiterung um Zypern, Malta und zehn mittel- und osteuropäische Staaten (MOELs), sowie um die bereits seit längerem der Europäischen Union angehörenden Staaten Schweden, Dänemark und Großbritannien. Da sich die Anzahl an NZB-Präsidenten mehr als verdoppelt, wird die Entscheidungsfindung im EZB-Rat erheblich behindert, was seine institutionelle Reform zwingend notwendig macht. Doch welcher Reformvorschlag ist für den EZB-Rat geeignet, damit die EZB auch künftig die ihr übertragenen Aufgaben optimal erfüllen kann? Ziel dieser Arbeit ist es, auf diese Frage eine Antwort zu geben. Zu diesem Zweck werden in einem ersten Schritt die durch die Erweiterung zu erwartenden Probleme im EZB-Rat und die rechtlichen Rahmenbedingungen der Reform aufgezeigt. In einem zweiten Schritt werden die vier in Frage kommenden grundsätzlichen Konstruktionsvorschläge vorgestellt und kritisch beurteilt. Anschließend wird der vom Europäschien Rat beschlossene Vorschlag in seinen Vor- und Nachteilen diskutiert. Im letzten Schritt werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Reformgründe und Reformgrundlagen
- Probleme der Entscheidungsfindung
- Effizienzverlust - "large number problem"
- Einflussverlust des Direktoriums
- Diskrepanz des politischen und ökonomischen Gewichts
- Rechtliche Grundlagen
- Probleme der Entscheidungsfindung
- Reformvarianten
- Zentralisierung
- Stimmgewichtung
- Repräsentation
- Rotation
- Rotationsmodell der EZB
- Die fünf Grundsätze
- Das Abstimmungssystem
- Bewertung
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Herausforderungen, die die Erweiterung des Euro-Währungsgebiets für die Entscheidungsfindung im EZB-Rat mit sich bringt. Sie untersucht die Gründe für eine institutionelle Reform des EZB-Rates und beleuchtet verschiedene Reformvorschläge.
- Effizienzverlust und das "large number problem" durch die Erweiterung des EZB-Rates
- Reduzierter Einfluss des Direktoriums im Vergleich zu den nationalen Zentralbanken
- Diskrepanz zwischen dem ökonomischen und politischen Gewicht der Mitgliedsstaaten
- Rechtliche Grundlagen und Möglichkeiten einer Reform des EZB-Rats
- Bewertung verschiedener Reformmodelle, insbesondere des Rotationsmodells der EZB
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Europäische Zentralbank (EZB) und ihre Aufgaben in der Geldpolitik des Euro-Währungsgebiets vor. Sie hebt die Notwendigkeit einer institutionellen Reform des EZB-Rats aufgrund der bevorstehenden Euroraum-Erweiterung hervor.
Kapitel 2 beleuchtet die Probleme der Entscheidungsfindung im EZB-Rat, die sich aus der Erweiterung ergeben, sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Reform. Es analysiert den Effizienzverlust, den Einflussverlust des Direktoriums und die Diskrepanz zwischen politischem und ökonomischem Gewicht der Mitgliedsstaaten.
Kapitel 3 präsentiert verschiedene Reformvorschläge, darunter Zentralisierung, Stimmgewichtung, Repräsentation und Rotation.
Kapitel 4 konzentriert sich auf das Rotationsmodell der EZB, das vom Europäischen Rat beschlossen wurde. Es erläutert die fünf Grundsätze des Modells, das Abstimmungssystem und analysiert dessen Vor- und Nachteile.
Schlüsselwörter
EZB-Rat, Euroraum-Erweiterung, Entscheidungsfindung, Effizienzverlust, Einflussverlust, Stimmgewichtung, Rotation, Reform, Geldpolitik, nationale Zentralbanken, Direktorium.
Häufig gestellte Fragen
Warum muss die Entscheidungsfindung im EZB-Rat reformiert werden?
Durch die Erweiterung des Euroraums steigt die Zahl der Mitglieder im EZB-Rat auf bis zu 33, was die Effizienz gefährdet („large number problem“).
Was ist das Rotationsmodell der EZB?
Es ist ein System, bei dem nicht mehr alle Zentralbankpräsidenten gleichzeitig stimmberechtigt sind, sondern die Stimmrechte nach einem festgelegten Turnus rotieren.
Wie werden die Länder im Rotationsmodell gruppiert?
Die Länder werden nach ihrer wirtschaftlichen und finanziellen Bedeutung in Gruppen eingeteilt, wobei größere Länder häufiger stimmberechtigt sind als kleinere.
Was bleibt für das EZB-Direktorium unverändert?
Die sechs Mitglieder des EZB-Direktoriums behalten im Gegensatz zu den nationalen Präsidenten ihr permanentes Stimmrecht im EZB-Rat.
Welche anderen Reformvarianten wurden diskutiert?
Diskutiert wurden auch die Zentralisierung der Macht beim Direktorium, eine Stimmgewichtung nach Kapitalanteilen oder Repräsentationsmodelle (Wahlgruppen).
- Quote paper
- Karolin Meißner, geb. Große (Author), 2004, Vorschläge zur institutionellen Reform der geldpolitischen Entscheidungsfindung in der EWU, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47639