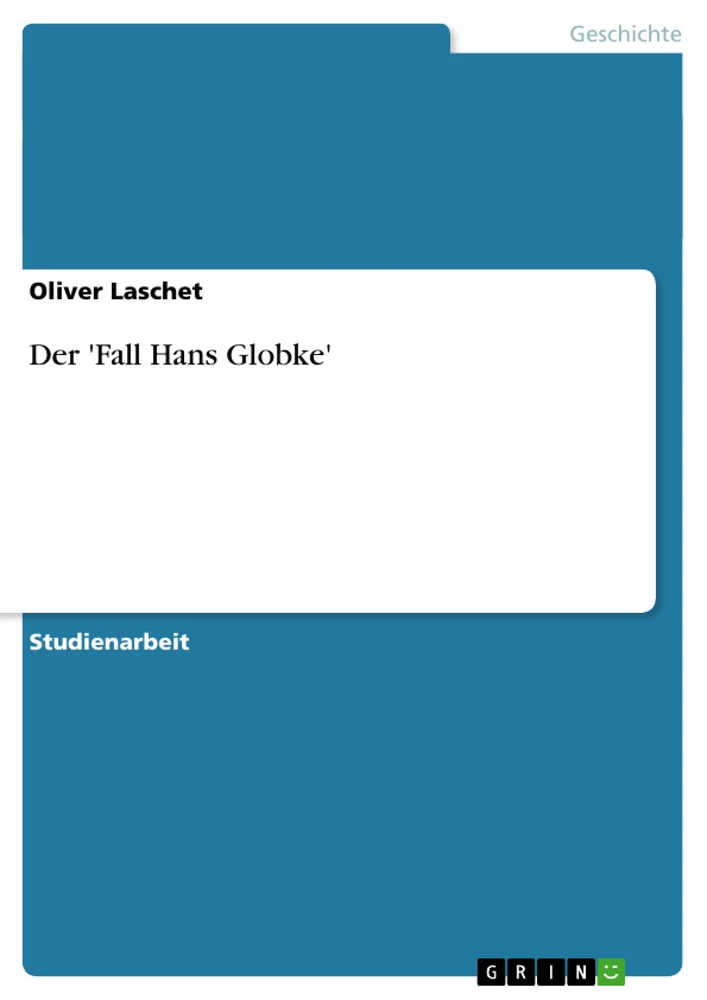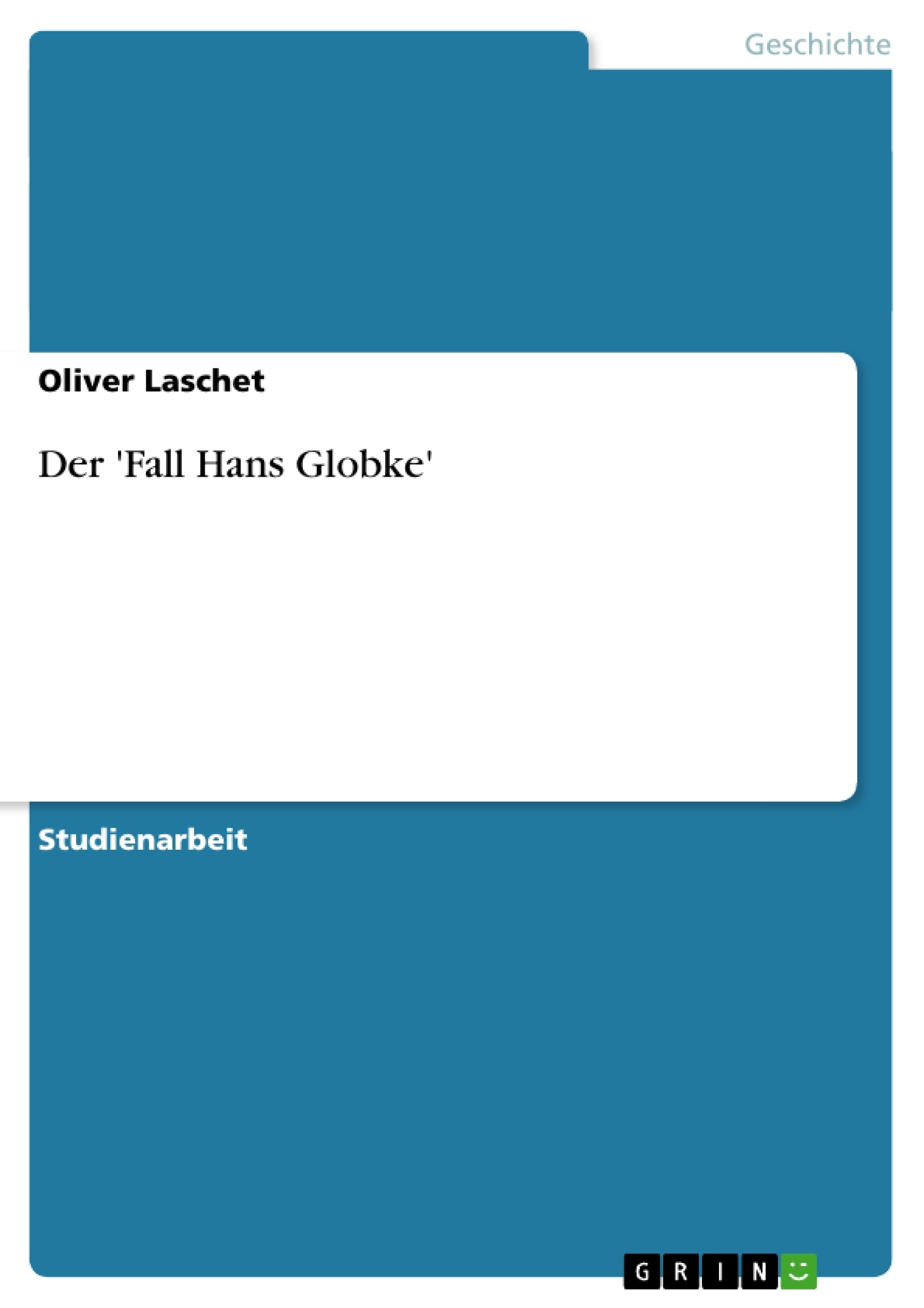Der Skandal um die Person Hans Globkes, der in der vorliegenden Arbeit untersucht werden soll, beginnt um das Jahr 1950 und setzt sich mit unterschiedlicher Akzentuierung bis zu dessen Pensionierung im Jahre 1963 fort. Aber auch nach seiner Dienstzeit behielt der Name Globke einen Symbolwert, auf den Bezug genommen wurde.
Nur wenige Personen der Bonner politischen Szene waren während der vierzehn- jährigen Kanzlerschaft Konrad Adenauers wegen ihrer Tätigkeit im Dritten Reich so heftigen Angriffen ausgesetzt wie sein Staatssekretär Hans Globke. Den Haupt- vorwurf bildete während des gesamten Konfliktverlaufs sein Verbleiben im Reichsinnenministerium nach 1933 sowie insbesondere seine Autorenschaft eines Kommentars zu den „Nürnberger Gesetzen“ . Wie noch zu zeigen sein wird, hatte er sich dadurch in den Augen vieler Zeitgenossen in einer Weise mit dem Nationalsozialismus identifiziert, die ihn für eine herausragende Tätigkeit in der Verwaltung der Bundesrepublik disqualifizierte. Erweitert wurde dieser Vorwurf im Laufe der Jahre zum einen durch die Beschuldigung, diese Gesetze mitverfasst zu haben, zum anderen durch zahlreiche Nebenvorwürfe.
Hierbei spielte seit 1956 die SED, namentlich das für Propaganda zuständige Politbüromitglied Albert Norden, eine herausragende Rolle durch mehrfache Weitergabe und Veröffentlichung von Dokumenten, welche einzelne Vorwürfe untermauern sollten. Als Koordinationszentrum hierfür diente ihm ein „Ausschuß für deutsche Einheit“, dem er, mit weitgehenden Vollmachten der Parteiführung versehen, vorstand.
Nicht zuletzt durch diese „sukzessive Veröffentlichungstaktik“ und ‚Instrumentalisierung’ der Angriffe gegen Globke seitens der DDR lebte dieser „längste aller NS-Konflikte“ immer wieder von Neuem auf. Gleichzeitig situierte er sich dadurch quasi zwangsläufig innerhalb des Ost/West-Konfliktes.
Auch heute noch fällt es schwer, der Persönlichkeit Hans Globkes gerecht zu werden. Die Schwierigkeit, ein objektives Urteil über sein politisches Wirken zu fällen, spiegelt sich deutlich auch in der dieser Arbeit zugrundegelegten Fachliteratur zu Globke wider, die teilweise selbst zum Bestandteil der Auseinandersetzung wurde . Sie umfasst ein vielfältiges Spektrum an zum Teil sich widersprechenden Interpretationsmöglichkeiten, die es in den nachfolgenden Ausführungen herauszuarbeiten und gegeneinander abzuwägen gilt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Der Skandalierte - ein biographischer Überblick
- 2. Der „Fall Globke“ - Chronologische Darstellung eines NS-Skandals
- 2.1 Globke als Charakteristikum einer insgesamt als verfehlt angesehenen Personalpolitik Adenauers (1950-1951)
- 2.2 Die Erkrankung Adenauers und der Bruch der Regierungskoalition durch die FDP als Auslöser der Angriffe 1956
- 2.3 Der „Fall Globke“ wird ab 1960 Teil des Ost/West-Konflikts
- 2.3.1 Die Angriffe des „Ausschusses für deutsche Einheit“ ab Mitte 1960
- 2.3.2 Ausweitung der Berichterstattung ab Anfang 1961
- 2.3.3 Der Prozess gegen Globke in Ostberlin im Juli 1963
- 3. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Skandal um Hans Globke, der sich von 1950 bis zu seiner Pensionierung 1963 erstreckte und auch danach symbolische Bedeutung behielt. Das Hauptziel ist die Darstellung des Skandals als Medienereignis und die Analyse der verschiedenen Vorwürfe gegen Globke, insbesondere seine Rolle im Reichsinnenministerium und seine Autorenschaft eines Kommentars zu den Nürnberger Gesetzen. Die Arbeit beleuchtet die komplexen politischen und ideologischen Hintergründe des Konflikts.
- Globkes biographischer Hintergrund und seine Karriere vor 1945
- Die chronologische Entwicklung des Skandals und die Rolle der Medien
- Die Instrumentalisierung des "Falls Globke" im Ost-West-Konflikt
- Die unterschiedlichen Interpretationen und die Schwierigkeit, ein objektives Urteil zu fällen
- Die politischen und ideologischen Dimensionen des Skandals
Zusammenfassung der Kapitel
1. Der Skandalierte - ein biographischer Überblick: Dieses Kapitel zeichnet einen detaillierten biographischen Überblick über Hans Globkes Leben, beginnend mit seiner Geburt bis zu seiner Tätigkeit im Preußischen Innenministerium. Es beleuchtet seine familiäre Herkunft, seine Ausbildung, seine Mitgliedschaft in der Zentrumspartei und seinen beruflichen Werdegang, der ihn schließlich nach Berlin führte. Der Fokus liegt auf den Ereignissen und Entscheidungen, die sein späteres Leben und den Ausbruch des Skandals prägten, jedoch ohne die späteren Vorwürfe direkt zu bewerten.
2. Der „Fall Globke“ - Chronologische Darstellung eines NS-Skandals: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung des Skandals um Hans Globke chronologisch, beginnend mit den ersten Angriffen um 1950. Es untersucht verschiedene Phasen, wie Globkes Rolle in der Adenauerschen Personalpolitik, die Auswirkungen der Erkrankung Adenauers und den Bruch der Regierungskoalition, sowie die spätere Instrumentalisierung des Falls durch die SED im Kontext des Ost-West-Konflikts. Das Kapitel beleuchtet die Strategien der SED, die Rolle des Ausschusses für deutsche Einheit und die Ausweitung der Berichterstattung in den Medien. Die verschiedenen Vorwürfe werden hier in ihren zeitlichen Kontext gesetzt und die Eskalation des Skandals detailliert dargestellt.
Schlüsselwörter
Hans Globke, Adenauer, NS-Vergangenheit, Nürnberger Gesetze, Ost-West-Konflikt, Personalpolitik, Medien, Skandal, SED, Propaganda, deutsche Einheit.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Der Fall Globke
Was ist der Inhalt des Textes "Der Fall Globke"?
Der Text ist eine umfassende Darstellung des Skandals um Hans Globke, der sich von 1950 bis 1963 erstreckte. Er beinhaltet einen biographischen Überblick über Globke, eine chronologische Analyse des Skandals, die Zielsetzung und die wichtigsten Themenschwerpunkte der Arbeit sowie eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die folgenden Themen: Globkes Biographie und Karriere vor 1945; die chronologische Entwicklung des Skandals und die Rolle der Medien; die Instrumentalisierung des "Falls Globke" im Ost-West-Konflikt; die unterschiedlichen Interpretationen und die Schwierigkeit, ein objektives Urteil zu fällen; die politischen und ideologischen Dimensionen des Skandals; Globkes Rolle im Reichsinnenministerium und seine Autorenschaft eines Kommentars zu den Nürnberger Gesetzen; die Adenauersche Personalpolitik und deren Auswirkungen; die Strategien der SED und die Rolle des Ausschusses für deutsche Einheit.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text umfasst drei Kapitel: 1. Der Skandalierte - ein biographischer Überblick; 2. Der „Fall Globke“ - Chronologische Darstellung eines NS-Skandals (unterteilt in 2.1, 2.2 und 2.3 mit Unterpunkten); 3. Schlussbetrachtung (diese ist im vorliegenden Auszug nicht detailliert).
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Die Hauptzielsetzung des Textes ist die Darstellung des Skandals um Hans Globke als Medienereignis und die Analyse der verschiedenen Vorwürfe gegen ihn. Es soll die komplexe politische und ideologischen Hintergründe des Konflikts beleuchtet werden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Hans Globke, Adenauer, NS-Vergangenheit, Nürnberger Gesetze, Ost-West-Konflikt, Personalpolitik, Medien, Skandal, SED, Propaganda, deutsche Einheit.
Wie wird der Skandal chronologisch dargestellt?
Kapitel 2 bietet eine chronologische Darstellung, beginnend mit den ersten Angriffen um 1950, über Globkes Rolle in der Adenauerschen Personalpolitik und die Auswirkungen der Erkrankung Adenauers und des Bruchs der Regierungskoalition bis hin zur Instrumentalisierung des Falls durch die SED im Kontext des Ost-West-Konflikts. Die Entwicklung der Berichterstattung in den Medien und die Eskalation des Skandals werden detailliert beschrieben.
Wie wird Globkes Biographie dargestellt?
Kapitel 1 bietet einen detaillierten biographischen Überblick über Hans Globkes Leben, von seiner Geburt bis zu seiner Tätigkeit im Preußischen Innenministerium. Es beleuchtet seine familiäre Herkunft, seine Ausbildung, seine Mitgliedschaft in der Zentrumspartei und seinen beruflichen Werdegang, ohne die späteren Vorwürfe direkt zu bewerten.
- Citar trabajo
- Oliver Laschet (Autor), 2002, Der 'Fall Hans Globke', Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47677