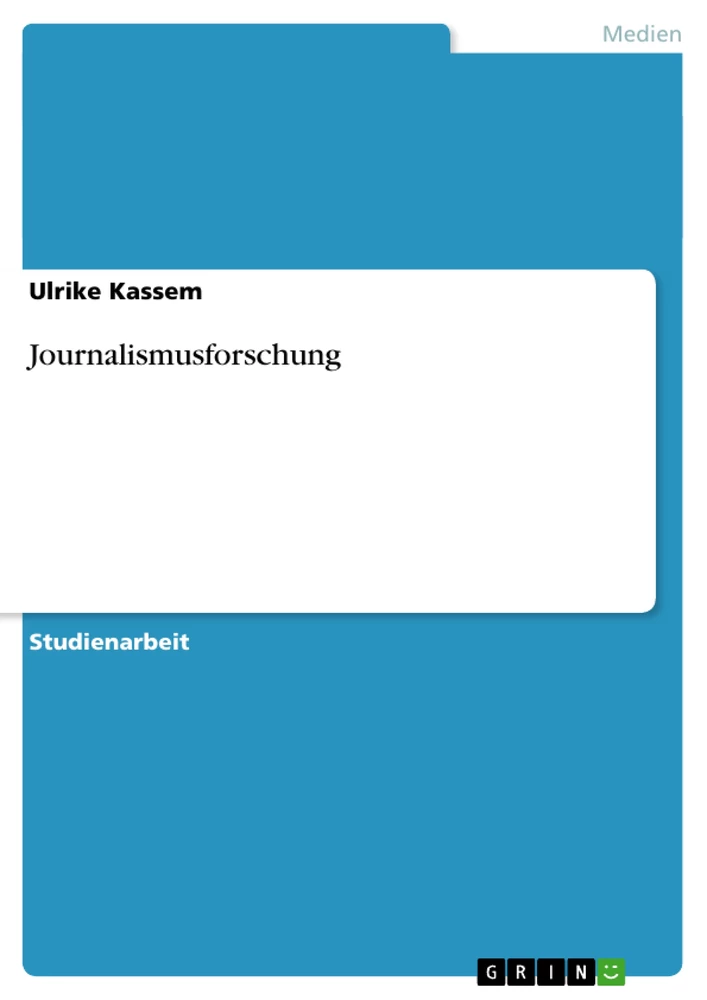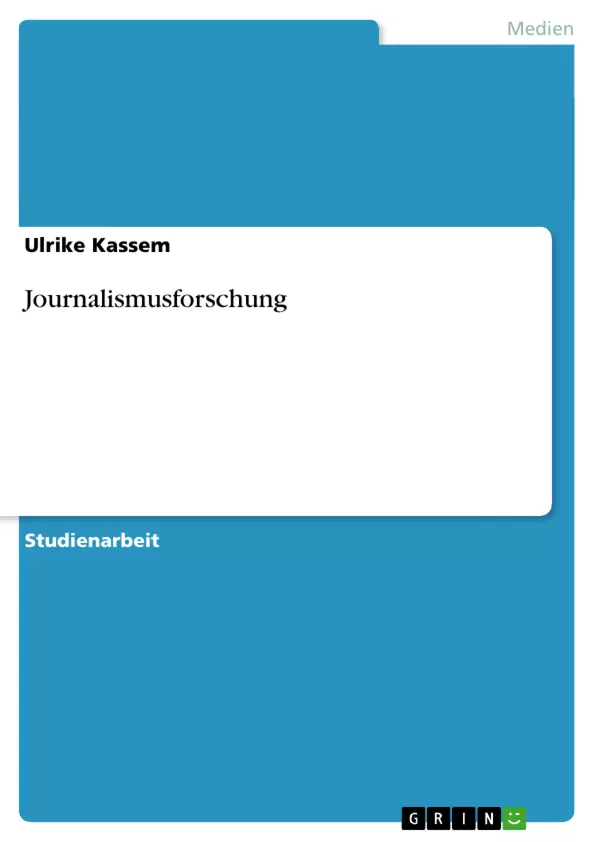"Der geschickte Journalist hat eine Waffe: das Totschweigen – und von dieser Waffe macht er oft genug Gebrauch.“ So stand es bereits 1921 in einem Essay der "Weltbühne". Dem Autoren, Kurt Tucholsky, ging es um die Frage nach Wahrhaftigkeit in den Medien, darum, ob Journalisten die Welt darstellen wie sie ist oder ob sie die Realität verändern – nach Belieben oder sogar ohne es zu wissen. Fragen, die sich Wissenschaftler tatsächlich schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts stellen. Zahlreiche normative und auch empirische Studien beschäftigen sich seitdem mit der Rolle des Journalisten im journalistischen System und der Wahrhaftigkeit von Medien. Tucholsky kam übrigens zu folgendem Schluss: "Was da steht, das ist nicht die Welt. (...) Man sollte sich lieber an das Original halten."
Die vorliegende Hausarbeit wird die Entwicklung der Journalismusforschung aufzeigen. Ausgangspunkt dabei sind drei Grundebenen, die sich mehr oder weniger parallel zueinander entwickelt haben: Die Mesoebene, die eine eher untergeordnete Rolle spielt, die Mikroebene, zu der alle Handlungs- und Akteurstheorien zählen und die ihren Blick in erster Linie auf die Journalisten richtet sowie die Makroebene, die Ebene der Institutionen, die der Mikroebene die Systemtheorie entgegensetzt, welche sich zum zweifellos wichtigsten Ansatz in der Journalismusforschung entwickelt hat.
Wichtige Forschungskonzepte und -strömungen werden in dieser Arbeit, im Rahmen des Möglichen, genauer beschrieben. Zu ihnen gehören: die „Gatekeeper“-Forschung, das Konzept der Professionalisierung, die Autopoiesis, das Zwiebelmodell, die Distinktionstheorie sowie die News-Bias-Forschung. Aus Platzgründen ist es jedoch weder möglich, alle nennenswerten Theorien und Ansätze in der Journalismusforschung zu erwähnen oder gar zu beschreiben, noch die beiden großen, äußerst komplexen Forschungsströmungen, System- und Akteurstheorie, bis ins Detail zu beleuchten. Unberücksichtigt müssen in dieser Arbeit auch Forschungen bleiben, die sich mit besonderen Problemfeldern beschäftigen, Journalismus im Zusammenhang mit Ethik oder Qualität zum Beispiel.
Wichtig ist, zu erwähnen, dass alle angeführten Konzepte und Richtungen der Journalistenforschung mehr oder weniger parallel zueinander existieren, wobei es durchaus Bemühungen gibt, einzelne untereinander zu koppeln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Überblick
- Theorie
- Definition des Begriffs „Journalismus“
- Die Anfänge der Forschung
- Forschung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
- Forschung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
- Empirie
- Vorwort
- Entwicklungen
- Die Studie „Journalismus in Deutschland“
- Einstellung deutscher Journalisten
- Einstellung deutscher Journalisten im internationalen Vergleich
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beleuchtet die Entwicklung der Journalismusforschung, indem sie drei zentrale Ebenen untersucht: die Mesoebene (mit untergeordneter Rolle), die Mikroebene (fokussiert auf Journalisten und Handlungstheorien) und die Makroebene (Institutionen und Systemtheorie als dominanter Ansatz).
- Entwicklung der Journalismusforschung auf drei Ebenen (Meso-, Mikro- und Makroebene)
- Analyse wichtiger Forschungskonzepte und -strömungen wie Gatekeeper-Forschung, Professionalisierung, Autopoiesis, Zwiebelmodell, Distinktionstheorie und News-Bias-Forschung
- Vergleich des Rollenverständnisses von Journalisten in deutschen und internationalen Studien, insbesondere der Studie "Journalismus in Deutschland"
- Diskussion der Definition des Begriffs "Journalismus" und unterschiedlicher wissenschaftlicher Ansätze
- Einfluss von wirtschaftlichen Zwängen und soziologischen Aspekten auf die Nachrichtenbeschaffung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung und Überblick
Der Text beginnt mit einem Zitat von Kurt Tucholsky, das die Frage nach der Wahrhaftigkeit in den Medien aufwirft. Es wird betont, dass die Hausarbeit die Entwicklung der Journalismusforschung aufzeigen wird, wobei drei Ebenen im Fokus stehen: die Mesoebene, die Mikroebene und die Makroebene.
Theorie
Definition des Begriffs „Journalismus“
Der Text beleuchtet verschiedene Definitionen des Begriffs "Journalismus", von der einfachen Vorstellung "Journalismus ist, was Journalisten machen" bis hin zu komplexeren Ansätzen, die Journalismus als sozialen Prozess oder als Ergebnis von Kommunikationsprozessen begreifen.
Die Anfänge der Forschung
Die frühen Forschungsansätze zum Journalismus im 17. Jahrhundert beschäftigten sich mit dem Nutzen und der Moral von Publikationen und untersuchten publizistische Merkmale wie Aktualität, Periodizität und Universalität. Mitte des 18. Jahrhunderts kamen Fragen des Presserechts und der wirtschaftlichen Zwänge hinzu.
Forschung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Der Text stellt fest, dass die Forschung nach den frühen Ansätzen von Eduard Prutz einen Rückschritt machte und Journalismus wieder auf das Werk einzelner Personen reduzierte.
Empirie
Vorwort
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit dem Rollenverständnis von Journalisten und vergleicht deutsche mit internationalen Studien, insbesondere der Studie "Journalismus in Deutschland".
Entwicklungen
Der Text beleuchtet die Entwicklung des Rollenverständnisses von Journalisten, ohne jedoch auf konkrete Ergebnisse einzugehen.
Die Studie „Journalismus in Deutschland“
Der Text hebt die Studie "Journalismus in Deutschland" als die bisher umfassendste deutsche Studie zum Rollenverständnis von Journalisten hervor.
Einstellung deutscher Journalisten
Dieser Abschnitt behandelt die Einstellung deutscher Journalisten, ohne jedoch konkrete Inhalte zu verraten.
Einstellung deutscher Journalisten im internationalen Vergleich
Dieser Abschnitt befasst sich mit dem internationalen Vergleich der Einstellung von Journalisten, ohne jedoch konkrete Ergebnisse preiszugeben.
Schlüsselwörter
Wichtige Schlagwörter der Arbeit sind Journalismusforschung, Theorie, Empirie, Rollenverständnis, Gatekeeper-Forschung, Professionalisierung, Autopoiesis, Zwiebelmodell, Distinktionstheorie, News-Bias-Forschung, Systemtheorie, Akteurstheorie, Medien, Wahrhaftigkeit, Wirtschaftliche Zwänge, Soziologische Aspekte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Journalismusforschung?
Sie untersucht die Rolle von Journalisten, die Entstehung von Nachrichten sowie die Strukturen und Funktionen des Mediensystems in der Gesellschaft.
Was beschreibt die „Gatekeeper“-Forschung?
Diese Forschung analysiert die Auswahlprozesse in Redaktionen: Wer entscheidet nach welchen Kriterien, welche Informationen zur Nachricht werden und welche „draußen“ bleiben?
Was ist der Unterschied zwischen Mikro- und Makroebene in der Forschung?
Die Mikroebene fokussiert auf das Handeln einzelner Akteure (Journalisten), während die Makroebene den Journalismus als gesellschaftliches Teilsystem oder Institution betrachtet.
Was besagt das Zwiebelmodell von Weischenberg?
Das Modell beschreibt Journalismus in verschiedenen Schichten: von den Mediensystemen (außen) über Institutionen und Redaktionen bis hin zu den Akteuren und ihren Rollen (innen).
Wie hat sich das Rollenverständnis deutscher Journalisten entwickelt?
Studien wie „Journalismus in Deutschland“ zeigen einen Wandel vom „neutralen Berichterstatter“ hin zu Rollen wie dem „Kritiker/Kontrolleur“ oder dem „Dienstleister“ für das Publikum.
Was ist News-Bias?
News-Bias bezeichnet eine systematische Einseitigkeit oder Verzerrung in der Berichterstattung, die durch politische Einstellungen, wirtschaftliche Zwänge oder redaktionelle Linien entstehen kann.
- Quote paper
- Ulrike Kassem (Author), 2003, Journalismusforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47685