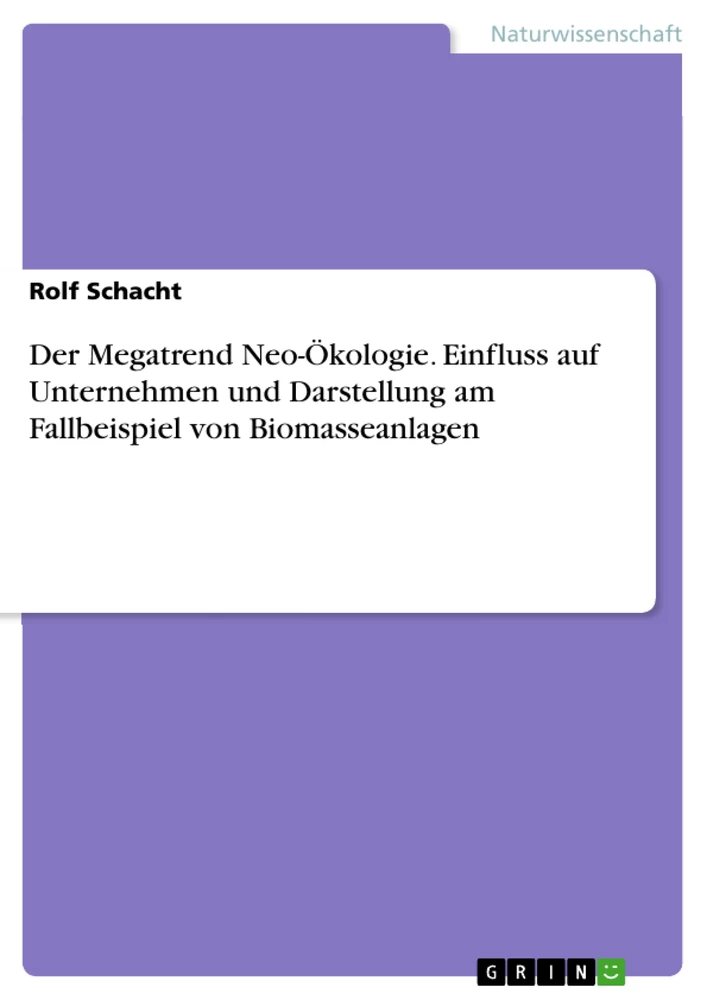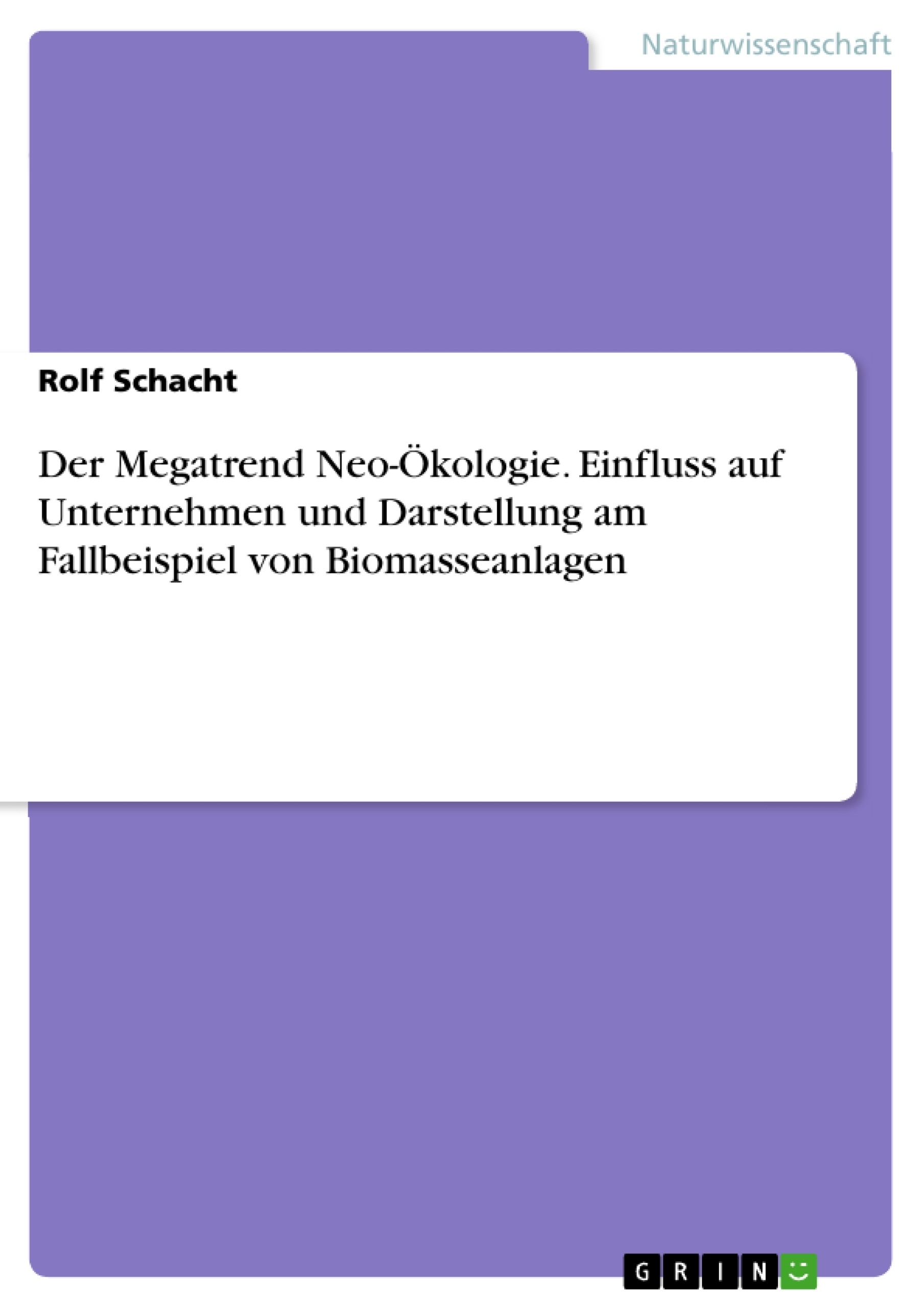Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Einfluss des Megatrends Neo-Ökologie auf Unternehmen, dabei wird dieses Phänomen zum einen theoretisch beleuchtet und mögliche Beeinflussungen dargestellt. Im Weiteren sollen an Hand des Beispiels der Energiegewinnung durch Biomassenanlagen die Fehlentwicklung bezüglich der ökologischen Reinheit zur Verfügung gestellter Ressourcen beschrieben werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- theoretische Vorannahme
- historische Entwicklung der Neo-Ökologie
- Definition Neo-Ökologie / ökologische Nachhaltigkeit
- Zusammenhang ökologische Nachhaltigkeit und ökonomische Performance
- Funktionen der Umwelt
- die natürliche Umwelt als Rohstoff- und Energielieferant
- die natürliche Umwelt als Aufnahmemedium
- Relevanz für die Gesellschaft
- Auswirkungen zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und ökonomischer Performance
- Relevanz für Unternehmen
- Funktionen der Umwelt
- Neo Ökologie im Rahmen der Corporate Social Responsibility
- Neo Ökologie im unternehmerischen Zielsystem
- neo ökologische Herausforderungen im Unternehmen
- ökologische Produktentwicklung
- ökologische Produktionsverfahren
- weitere technische Maßnahmen
- ökologische Investitionsrechnung
- ökologisches Marketing
- ökologisches Controlling
- neo ökologische Herausforderungen im Unternehmen
- produktionsintegrierter Umweltschutz
- Fehlentwicklung bezüglich der ökologischen Reinheit von Biomasseanlagen – Beispiel
- geschichtlicher Abriss
- EEG Förderinstrument der Bioenergie
- Biomasseanlagen
- halmartige Biomasse
- flüssige Biomasse
- holzartige Biomasse
- Umweltfolgen der ökologischen Energie aus Biomasse
- halmartige Biomasse
- flüssige Biomasse
- holzartige Biomasse
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Einfluss des Megatrends Neo-Ökologie auf Unternehmen und beleuchtet dabei sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die konkreten Auswirkungen. Im Fokus steht die Analyse von Fehlentwicklungen bezüglich der ökologischen Reinheit von Biomasseanlagen als Beispiel für die Herausforderungen der nachhaltigen Energiegewinnung.
- Die historische Entwicklung und Definition von Neo-Ökologie und ökologischer Nachhaltigkeit
- Der Zusammenhang zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und ökonomischer Performance
- Die Rolle der Neo-Ökologie im Rahmen der Corporate Social Responsibility
- Die Integration von Neo-Ökologie in unternehmerische Zielsysteme
- Die Analyse von Fehlentwicklungen bei Biomasseanlagen in Bezug auf ökologische Reinheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Neo-Ökologie ein und beleuchtet die Bedeutung des Themas für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Außerdem wird die Relevanz nachhaltiger Entwicklungen im Kontext des Klimawandels und der Ressourcenverknappung dargestellt.
- theoretische Vorannahme: Dieses Kapitel analysiert den Zusammenhang zwischen Ökologie und Wohlbefinden der Gesellschaft sowie den Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen und Strategien. Es beleuchtet die Herausforderungen der Transformation von Geschäftsmodellen hin zu nachhaltigen Ansätzen.
- historische Entwicklung der Neo-Ökologie: Die historische Entwicklung des Konzepts der ökologischen Nachhaltigkeit wird dargestellt, beginnend mit den Anfängen der „Nachhaltigkeit erster Generation" bis hin zur modernen Definition im Rahmen der UN-Umweltkonferenz 1992.
- Definition Neo-Ökologie / ökologische Nachhaltigkeit: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe Neo-Ökologie und ökologische Nachhaltigkeit und beleuchtet deren Relevanz in aktuellen Kontexten.
- Zusammenhang ökologische Nachhaltigkeit und ökonomische Performance: Der Zusammenhang zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und ökonomischer Performance wird analysiert, wobei die Funktionen der Umwelt, die Relevanz für die Gesellschaft sowie die Auswirkungen auf Unternehmen beleuchtet werden.
- Neo Ökologie im Rahmen der Corporate Social Responsibility: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung der Neo-Ökologie im Kontext der Corporate Social Responsibility und beleuchtet den Einfluss auf Unternehmensethik und nachhaltiges Wirtschaften.
- Neo Ökologie im unternehmerischen Zielsystem: Das Kapitel analysiert die Integration von Neo-Ökologie in unternehmerische Zielsysteme, wobei die Herausforderungen bei der Umsetzung von ökologischen Maßnahmen in Bereichen wie Produktentwicklung, Produktionsverfahren, Marketing und Controlling betrachtet werden.
- produktionsintegrierter Umweltschutz: Dieses Kapitel behandelt den produktionsintegrierten Umweltschutz als Ansatz zur Minimierung von Umweltbelastungen während des Produktionsprozesses.
- Fehlentwicklung bezüglich der ökologischen Reinheit von Biomasseanlagen – Beispiel: Das Kapitel analysiert Fehlentwicklungen bei Biomasseanlagen in Bezug auf die ökologische Reinheit und beleuchtet die Herausforderungen bei der nachhaltigen Energiegewinnung aus Biomasse.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themenbereiche der Seminararbeit sind: Neo-Ökologie, ökologische Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung, Corporate Social Responsibility, Biomasseanlagen, Energiegewinnung, Umweltschutz, Klimawandel, Ressourcenknappheit, Fehlentwicklungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Megatrend Neo-Ökologie?
Neo-Ökologie beschreibt die Verbindung von Ökonomie und Ökologie, bei der Nachhaltigkeit zum zentralen Wirtschaftsfaktor und gesellschaftlichen Wert wird.
Welchen Einfluss hat Neo-Ökologie auf Unternehmen?
Unternehmen müssen ökologische Nachhaltigkeit in ihre Zielsysteme integrieren, von der Produktentwicklung über das Marketing bis hin zum Controlling.
Sind Biomasseanlagen immer ökologisch rein?
Die Arbeit analysiert Fehlentwicklungen bei Biomasseanlagen und zeigt auf, dass die Gewinnung von Ressourcen nicht immer den hohen ökologischen Standards entspricht.
Was bedeutet CSR im Kontext der Neo-Ökologie?
Corporate Social Responsibility (CSR) umfasst die unternehmerische Verantwortung für soziale und ökologische Belange, die durch den Megatrend Neo-Ökologie verstärkt wird.
Welche Umweltfolgen können durch Bioenergie entstehen?
Die Arbeit untersucht Umweltfolgen von halmartiger, flüssiger und holzartiger Biomasse und hinterfragt die tatsächliche Nachhaltigkeit dieser Energiequellen.
- Quote paper
- Rolf Schacht (Author), 2019, Der Megatrend Neo-Ökologie. Einfluss auf Unternehmen und Darstellung am Fallbeispiel von Biomasseanlagen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/477496