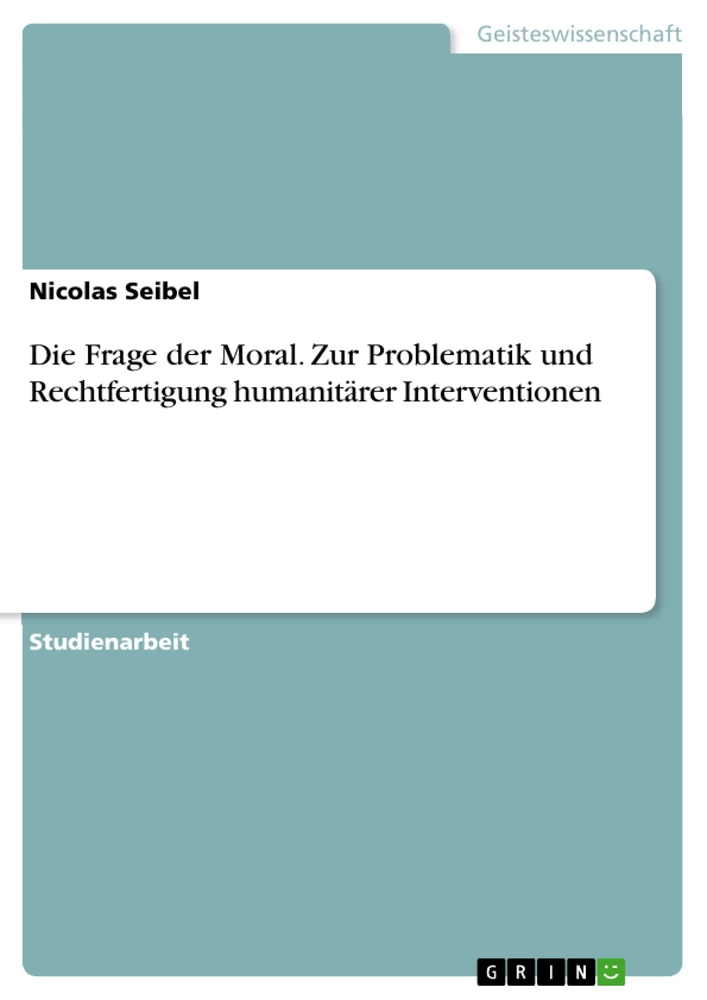Es stellt sich die Frage, ob die Definition von Gewalt vom Kontext abhängig gemacht werden kann. Wann geht man Gefahr, selbst ein Verbrechen gegen die Menschenrechte zu begehen, wann ist der Einsatz solcher Gewalt legitim?
„Auf seine Freiheit verzichten, heißt auf seine Menschenwürde, Menschenrechte, selbst auf seine Pflichten verzichten.“ Beginnend mit Völkermorden an den Armeniern zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts und aufbauend auf den abscheulichen Verbrechen der Nationalsozialisten zwischen 1933 und 1945 wurden die „Verbrechen gegen die Menschlichkeit und gegen die Zivilisation“ 1946 erstmals juristisch definiert und verfolgt. Bis heute werden grauenhafte Verbrechen dieser Art aufgedeckt und verfolgt und vor dem internationalen Gerichtshof behandelt. Verbrechen gegen die Menschlichkeit verjähren nicht.
In Zeiten, die von Konflikten geprägt sind, sind organisierte Präventionsmaßnahmen unabdingbar, um den Frieden gewährleisten und aufrechterhalten zu können. Angesichts schwerer Menschenrechtsverletzungen, die leider auch heute noch in erschreckendem Maße festzustellen sind, kann und darf die Weltgemeinschaft nicht untätig bleiben und sich hinter den Prinzipien der Souveränität und Neutralität verstecken.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problem- und Fragestellung
- 1.2. Aufbau der Arbeit
- 2. Menschenrechte
- 3. Intervention - Eine Definition
- 3.1. Die humanitäre Intervention
- 4. Rechtliche Grundlagen
- 4.1. Souveränitätsprinzip
- 4.2. Interventionsverbot
- 4.3. Gewaltverbot
- 5. Problematik humanitärer Interventionen
- 6. Die Frage der Moral
- 7. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Problematik humanitärer Interventionen mit Blick auf den Widerspruch zwischen der Notwendigkeit zum Schutz von Menschenrechten und dem Prinzip der staatlichen Souveränität. Sie untersucht die rechtlichen und moralischen Aspekte des Eingreifens in souveräne Staaten zum Schutz von Menschen in Not.
- Das Spannungsverhältnis zwischen staatlicher Souveränität und dem Schutz von Menschenrechten
- Die Rechtmäßigkeit und Legitimität humanitärer Interventionen
- Die ethische Frage der Gewaltanwendung im Rahmen humanitärer Interventionen
- Die Rolle internationaler Organisationen bei der Prävention und Reaktion auf Menschenrechtsverletzungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Arbeit stellt die Problem- und Fragestellung sowie den Aufbau der Arbeit dar. Sie beleuchtet die Geschichte von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Prävention und zum Schutz vor Menschenrechtsverletzungen.
- Kapitel 2: Menschenrechte: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Menschenrechte und deren Bedeutung als grundlegende Rechte, die jedem Menschen zustehen. Es beleuchtet die Verantwortung der Staaten für den Schutz von Menschenrechten und die Herausforderungen, die sich aus der Einhaltung dieser Rechte ergeben.
- Kapitel 3: Intervention - Eine Definition: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Intervention und insbesondere der humanitären Intervention. Es beleuchtet die unterschiedlichen Motive für Interventionen und die damit verbundenen Begriffe wie Souveränität, Gewaltverbot und Interventionsverbot.
- Kapitel 4: Rechtliche Grundlagen: Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Grundlagen von Interventionen, insbesondere die Grundsätze des Souveränitätsprinzips, des Interventionsverbots und des Gewaltverbots. Es untersucht, wie diese Prinzipien mit dem Schutz von Menschenrechten vereinbar sind.
- Kapitel 5: Problematik humanitärer Interventionen: Dieses Kapitel beleuchtet die Herausforderungen und Probleme, die mit humanitären Interventionen verbunden sind. Es betrachtet die unterschiedlichen Perspektiven auf diese Interventionen und die potenziellen Folgen für die beteiligten Staaten und Akteure.
- Kapitel 6: Die Frage der Moral: Dieses Kapitel setzt sich mit der ethischen Dimension von humanitären Interventionen auseinander. Es untersucht die Frage, ob die Anwendung von Gewalt im Rahmen solcher Interventionen moralisch vertretbar ist und welche Kriterien für die moralische Rechtfertigung solcher Handlungen gelten können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der humanitären Intervention, der Problematik von Gewaltanwendung, der Verantwortung der Staaten gegenüber ihren Bürgern und der Einhaltung von Menschenrechten. Weitere wichtige Konzepte sind Souveränitätsprinzip, Interventionsverbot, Gewaltverbot, Menschenrechtsverletzungen, Prävention und Friedenserhaltung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine humanitäre Intervention?
Es handelt sich um ein Eingreifen in die Angelegenheiten eines souveränen Staates, um schwere Menschenrechtsverletzungen wie Völkermord zu verhindern.
Wann ist der Einsatz von Gewalt legitim?
Dies ist eine zentrale ethische Frage; oft wird die Legitimität an den Schutz der Menschenwürde und die Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit geknüpft.
Was besagt das Souveränitätsprinzip?
Es besagt, dass jeder Staat das Recht hat, seine inneren Angelegenheiten ohne Einmischung von außen zu regeln.
Gibt es ein völkerrechtliches Gewaltverbot?
Ja, das Gewaltverbot ist ein Grundpfeiler der UN-Charta, der jedoch im Falle humanitärer Katastrophen oft in Konflikt mit der Schutzverantwortung gerät.
Seit wann sind "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" juristisch definiert?
Erstmals wurden diese Verbrechen im Jahr 1946 im Rahmen der Nürnberger Prozesse juristisch definiert und verfolgt.
Dürfen Staaten neutral bleiben, wenn Menschenrechte verletzt werden?
Die Arbeit argumentiert, dass sich die Weltgemeinschaft angesichts schwerer Verbrechen nicht hinter Neutralität verstecken darf.
- Quote paper
- Bachelor of Arts (B.A.) Nicolas Seibel (Author), 2015, Die Frage der Moral. Zur Problematik und Rechtfertigung humanitärer Interventionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/478160