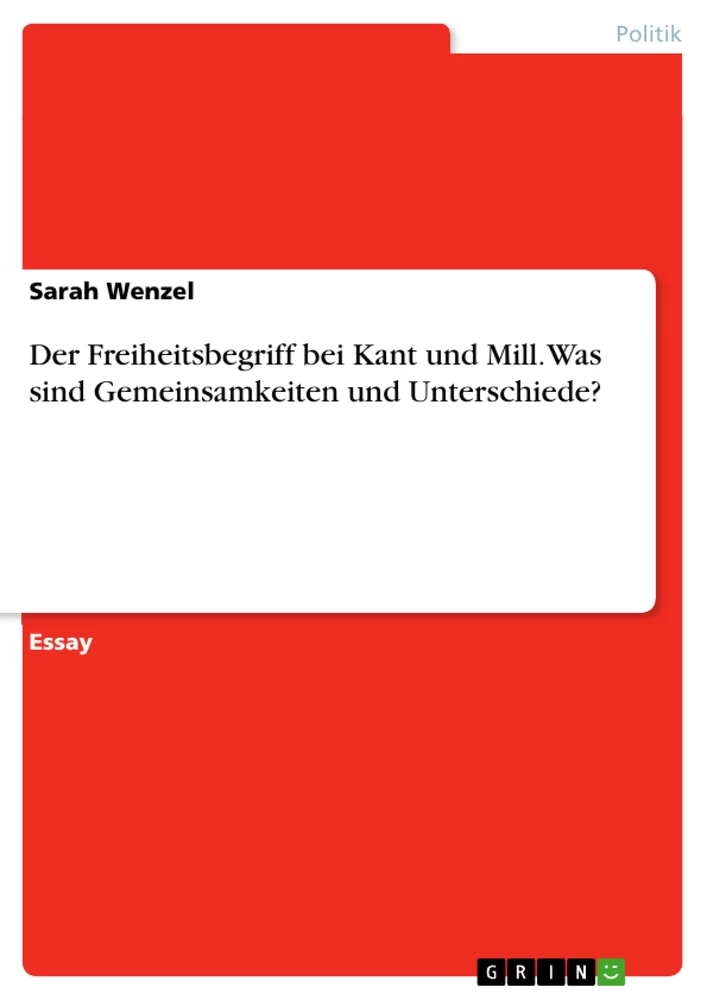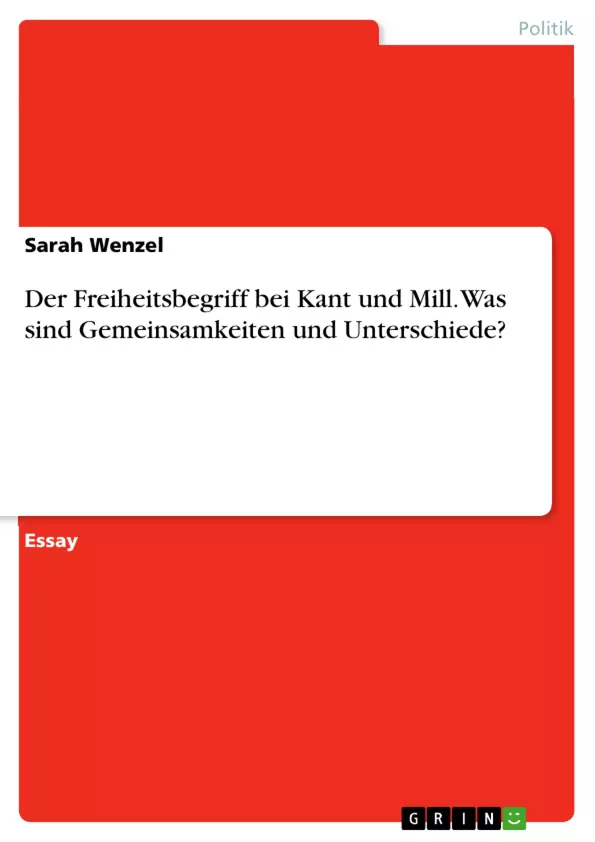Wie weit darf der Staat gehen, um den Bürgern Freiräume zu schaffen und ab wann greift der Staat zu weit in das Privatleben seiner Bürger ein? Mit der Frage der individuellen Selbstbestimmung und Freiheit setzen sich die Philosophen Immanuel Kant und John Stuart Mill in ihren Werken intensiv auseinander. Im folgenden Aufsatz sollen zunächst ihre Vorstellungen von Freiheit knapp dargestellt werden. Anschließend werden auf dieser Grundlage Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet, um abschließend abzuwägen inwieweit Kants und Mills Vorstellungen von Freiheit miteinander übereinstimmen, sich ergänzen oder voneinander abweichen.
Freiheit und Politik stehen in engem Zusammenhang miteinander. Durch politisches Handeln werden verbindliche Entscheidungen herbeigeführt, die die Bürger zu befolgen haben. Dies scheint auf den ersten Blick gerade nichts mit Freiheit zu tun zu haben. Auf der anderen Seite jedoch schaffen politische Entscheidungen überhaupt erst die Sicherheit, damit Menschen sich frei entfalten können.
Grundlegend wichtig für das Verständnis von Kants Vorstellung der Freiheit ist die Ausstattung des Menschen mit Vernunft. Macht der Mensch von seiner Vernunft Gebrauch, so ist er keiner naturgesetzlichen Kausalität unterworfen. Dies macht die Würde des Menschen aus und verleiht ihm das Menschenrecht der Freiheit. Für Kant bedeutet Freiheit, dass Ereignisse aus Regeln erfolgen, die der Mensch sich selbst auferlegt.
Der einflussreichste britische Philosoph John Stuart Mill (1806 – 1873) schreibt rund 70 Jahre nach Immanuel Kant. Mills Sorge gilt besonders der Demokratie, da er Gefahren bezüglich der politischen und sozialen Freiheit des Individuums in einer Demokratie sieht. Dies begründet er durch zwei Überlegungen. Zum einen sieht er die Gefahr der Unterdrückung von Minderheiten. Die Demokratie wird von vielen für eine gefahrlose Regierungsform gehalten, weil sie denken ein Volk könne nicht gegen sich selbst regieren. Dies ist jedoch nicht der Fall, da in einer Demokratie nicht jeder nur über sich selbst regiert, sondern sich die Menschen unter den politischen Willen der Mehrheit fügen müssen, auch wenn sie abweichender Meinung sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff der Freiheit
- Immanuel Kant
- John Stuart Mill
- Vergleich
- Gemeinsamkeiten
- Unterschiede
- Schlussbetrachtung
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz vergleicht die Freiheitskonzepte von Immanuel Kant und John Stuart Mill und untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Ansichten. Ziel ist es, die unterschiedlichen Perspektiven auf Freiheit in der politischen Philosophie aufzuzeigen.
- Die Rolle der Vernunft und des Willens in der Freiheitskonzeption
- Die Unterscheidung zwischen negativer und positiver Freiheit
- Die Bedeutung von Gesetzen und der Staatsgewalt für die Freiheit
- Die Gefahren der Tyrannei der Mehrheit und die Bedeutung der individuellen Freiheit
- Die Beziehung zwischen Freiheit und Selbstbestimmung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik von Freiheit und Politik dar und führt die beiden Philosophen Immanuel Kant und John Stuart Mill ein. Kapitel 2 befasst sich mit den Freiheitskonzepten beider Denker. Kants Vorstellung von Freiheit basiert auf der menschlichen Vernunft und der Fähigkeit, sich selbst Gesetze zu geben. Er unterscheidet zwischen innerer und äußerer Freiheit, wobei der Staat nur in die äußere Freiheit eingreifen darf, um die Freiheit aller zu schützen. Mills Freiheitskonzeption konzentriert sich auf die Bedeutung der individuellen Freiheit in einer Demokratie und die Gefahr der Tyrannei der Mehrheit. Er plädiert für eine Kultur des Respekts und der Toleranz, um die Freiheit des Einzelnen zu schützen.
Schlüsselwörter
Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit den Begriffen Freiheit, Vernunft, Wille, negative Freiheit, positive Freiheit, Staat, Tyrannei der Mehrheit, individuelle Freiheit, Selbstbestimmung und Demokratie.
Häufig gestellte Fragen
Worin besteht der Kern von Kants Freiheitsbegriff?
Für Kant ist Freiheit eng mit der menschlichen Vernunft verknüpft. Sie bedeutet Autonomie – die Fähigkeit, sich selbst Gesetze aufzuerlegen, unabhängig von bloßer natürlicher Kausalität.
Welche Gefahr sah John Stuart Mill für die Freiheit in der Demokratie?
Mill warnte vor der "Tyrannei der Mehrheit", bei der Minderheiten unterdrückt werden und der soziale Druck zur Konformität die individuelle Entfaltung einschränkt.
Was ist der Unterschied zwischen negativer und positiver Freiheit?
Negative Freiheit bezeichnet die Abwesenheit von äußeren Hindernissen (Mill), während positive Freiheit die Fähigkeit zur Selbstbestimmung durch Vernunft (Kant) betont.
Darf der Staat laut Kant in die Freiheit der Bürger eingreifen?
Ja, aber nur in die äußere Freiheit, um sicherzustellen, dass die Freiheit des Einzelnen mit der Freiheit aller anderen nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann.
In welchem historischen Kontext schrieben Kant und Mill?
Kant schrieb Ende des 18. Jahrhunderts im Geist der Aufklärung, während Mill etwa 70 Jahre später im 19. Jahrhundert die Auswirkungen der industriellen Gesellschaft und frühen Demokratie analysierte.
- Quote paper
- Sarah Wenzel (Author), 2012, Der Freiheitsbegriff bei Kant und Mill. Was sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/478232