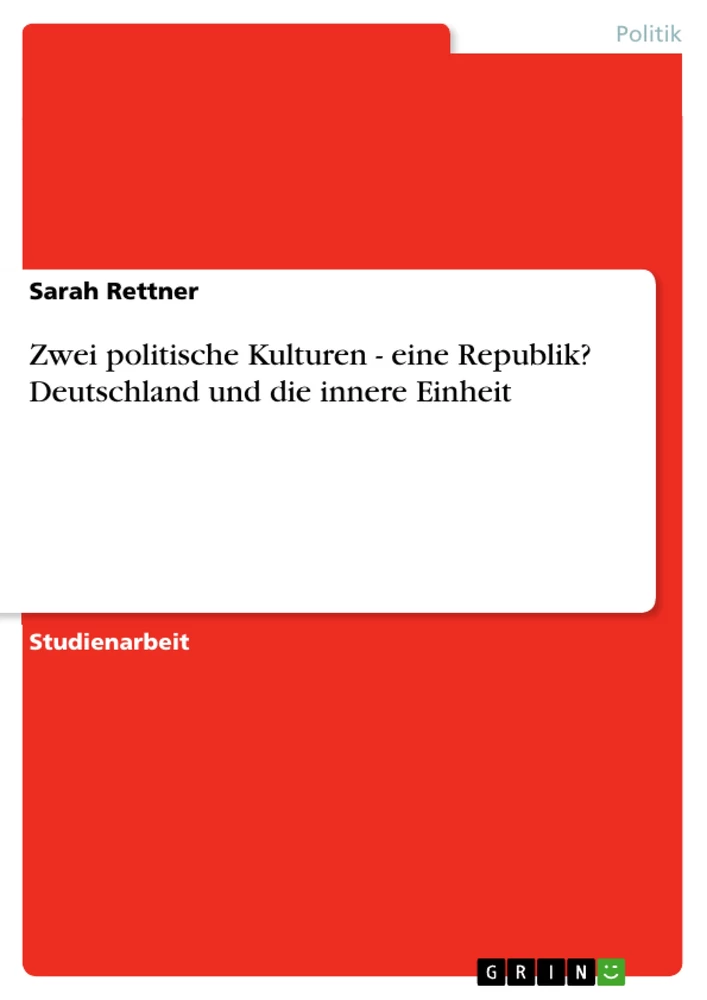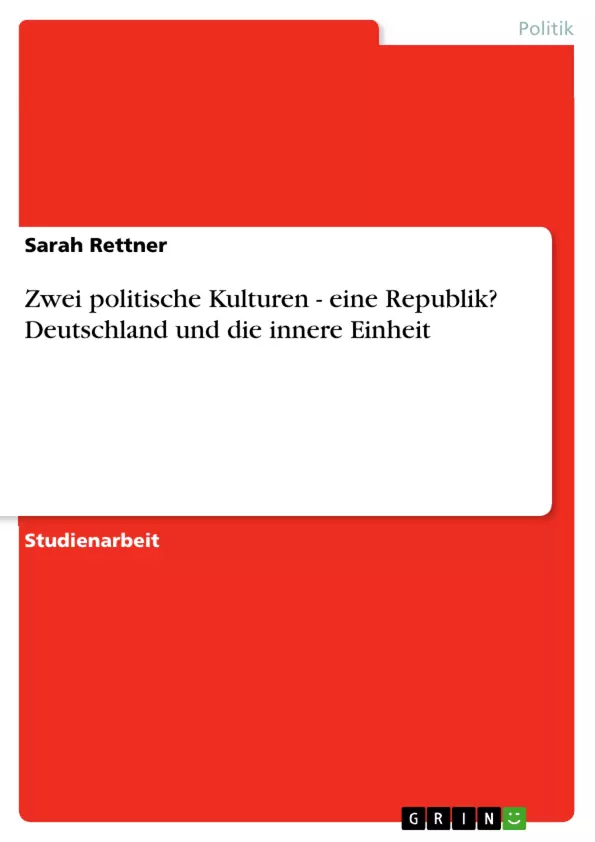„Der Einigungsprozess in Deutschland vollzog sich in einer nüchternen, gleichsam geschäftsmäßigen Form, weit von so genanntem Hurra-Nationalismus entfernt“ (Jesse 2008: 180). Diese These Eckhard Jesses scheint in erster Linie auf die äußere Wirkung der Wiedervereinigung der DDR und der BRD Bezug zu nehmen. Doch wie sieht es in den Bürgern selbst aus? Wie gehen sie mit der Wiedervereinigung um? Wird durch die äußere Einheit die Innere nach sich gezogen?
Um diesen Fragen nachzugehen beschäftigt sich diese Seminararbeit mit dem Themenbereich der politischen Kultur in der Bundesrepublik Deutschland nach der Wiedervereinigung. Die politische Kultur ist zur Untersuchung dieser Fragen deshalb besonders geeignet, da sie „vornehmlich die subjektive Dimension der Politik“ (Jesse 2008: 169) betrifft und somit das Individuum auf der Mikroebene näher betrachtet. Unter dem Begriff der politischen Kultur sollen „Verhaltensweisen, Wertvorstellungen, politisch-gesellschaftliche Orientierungen, […] ungeschriebene Ideen und ´Befindlichkeiten`“ (Jesse 2008:169) aufgefasst werden, durch die wiederrum Rückschlüsse auf die Stabilität des politischen Systems gezogen werden können.
Inwieweit hat heute, nach mehr als 20 Jahren nach dem Mauerfall, die vielzitierte „Mauer in den Köpfen“ (Tuchscheerer 2010: 158) immer noch Bestand? Oder anders formuliert: Inwieweit können wir von einer gesamtdeutschen politischen Kultur in Deutschland sprechen oder muss von zwei Teilgesellschaften bzw. zwei politischen Kulturen die Rede sein? Mit dieser zentralen Frage setzen sich die folgenden Kapitel auseinander. Dabei sollen zunächst die wichtigsten Teilbereiche der politischen Kultur mit ihren Unterschieden oder Gemeinsamkeiten in Ost und West herausgearbeitet werden, um anschließend eine fundierte Basis für unterschiedliche Interpretationen aufzubauen, welche in einem zweiten Teil analysiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Eine gesamtdeutsche politische Kultur?
- 2. Politische Kultur in Deutschland
- 2.1 Nationalbewusstsein
- 2.2 Systemakzeptanz
- 2.3 Vertrauen in politische Institutionen
- 2.4 Soziale Marktwirtschaft
- 2.5 Einstellungen zur DDR und zur Einheit
- 3. Interpretationen zur politischen Kultur
- 3.1 Eine politische Kultur in Deutschland
- 3.2 Zwei politische Kulturen in Deutschland
- 4. Schluss: Interpretation der Ergebnisse - zwei politische Kulturen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit untersucht die politische Kultur in Deutschland nach der Wiedervereinigung, insbesondere die Frage, ob eine gesamtdeutsche politische Kultur entstanden ist oder ob zwei Teilgesellschaften bzw. zwei politische Kulturen bestehen.
- Entwicklung des Nationalbewusstseins in Ost und West
- Systemakzeptanz und Einstellung zur Demokratie in beiden Teilen Deutschlands
- Vertrauen in politische Institutionen
- Haltungen zur Sozialen Marktwirtschaft
- Wahrnehmung der DDR und der Wiedervereinigung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Gibt es eine gesamtdeutsche politische Kultur oder sind zwei politische Kulturen in Deutschland festzustellen? Kapitel 2 analysiert die politische Kultur anhand von fünf Schlüsselbereichen: Nationalbewusstsein, Systemakzeptanz, Vertrauen in politische Institutionen, Soziale Marktwirtschaft und Einstellungen zur DDR und zur Einheit. Dabei werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Ost und West beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema der politischen Kultur in Deutschland nach der Wiedervereinigung. Im Mittelpunkt stehen die Analyse von Nationalbewusstsein, Systemakzeptanz, Vertrauen in politische Institutionen, Soziale Marktwirtschaft und Einstellungen zur DDR und zur Einheit in Ost und West. Die Arbeit untersucht, ob eine gesamtdeutsche politische Kultur existiert oder ob zwei politische Kulturen bestehen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die "Mauer in den Köpfen"?
Dieser Begriff beschreibt die fortbestehenden Unterschiede in den Mentalitäten, Werten und politischen Einstellungen zwischen Ost- und Westdeutschen nach der Wiedervereinigung.
Gibt es eine gesamtdeutsche politische Kultur?
Die Arbeit untersucht, ob Deutschland nach über 20 Jahren Einheit eine einheitliche Kultur besitzt oder ob weiterhin zwei Teilgesellschaften existieren.
Wie unterscheidet sich das Vertrauen in politische Institutionen?
Studien zeigen oft, dass das Vertrauen in staatliche Institutionen in den neuen Bundesländern skeptischer ausgeprägt ist als in den alten Bundesländern.
Was ist politische Kultur nach Eckhard Jesse?
Sie umfasst die subjektive Dimension der Politik, also Verhaltensweisen, Wertvorstellungen und Orientierungen der Bürger gegenüber dem politischen System.
Wie wird die DDR heute in Ost und West wahrgenommen?
Es existieren unterschiedliche Sichtweisen auf die DDR-Vergangenheit, die von nostalgischer Verklärung bis hin zur strikten Ablehnung als Unrechtsstaat reichen.
- Quote paper
- Sarah Rettner (Author), 2012, Zwei politische Kulturen - eine Republik? Deutschland und die innere Einheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/478234