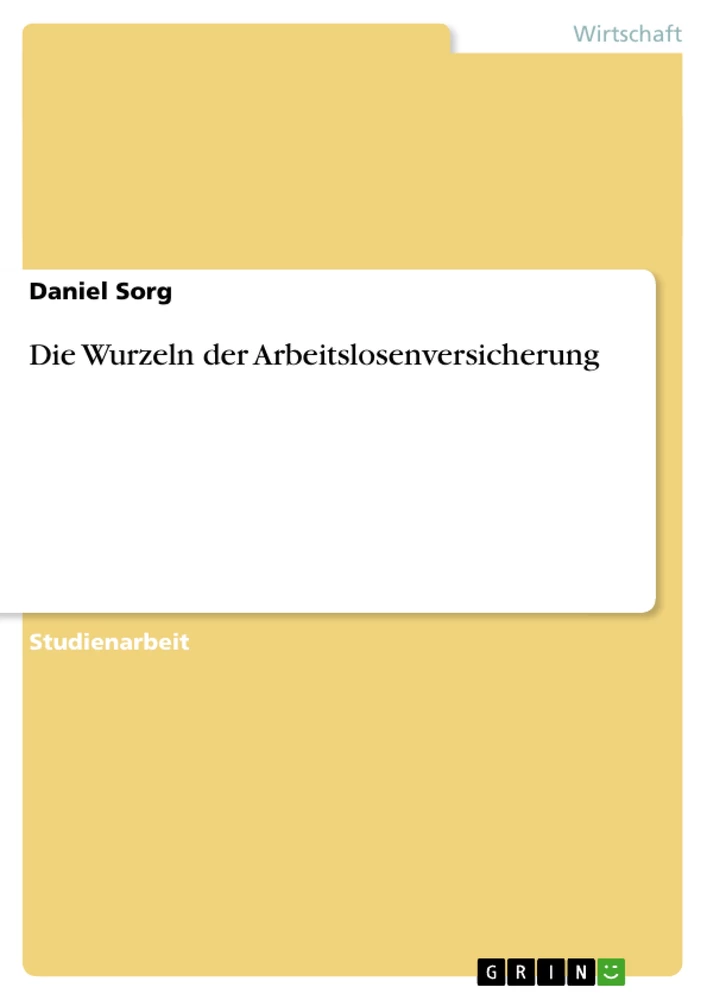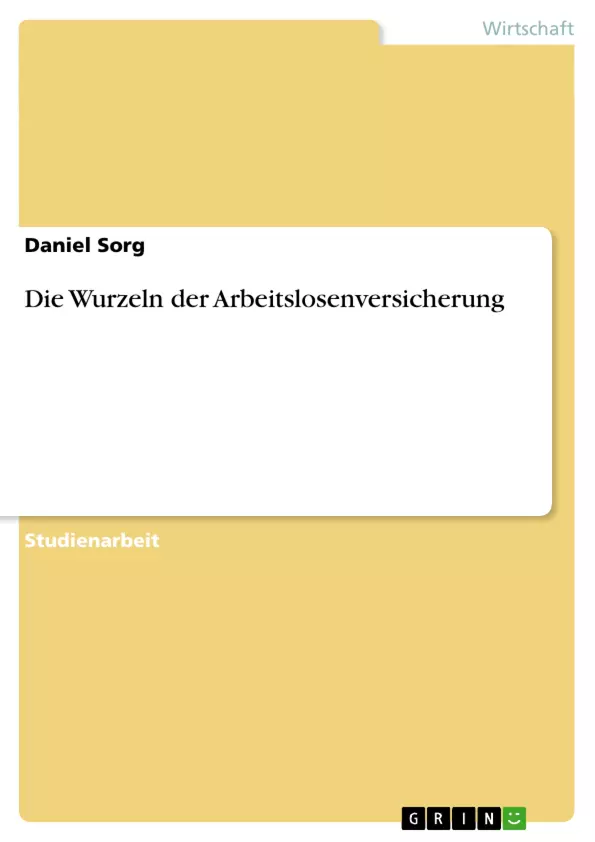Die Arbeitslosenversicherung ist in unserer heutigen Zeit ein fester Bestandteil unseres Sozialsystems und praktisch unmöglich weg zu denken. Aber wie kam es in Deutschland dazu, dass solch eine soziale Leistung überhaupt erst entstanden ist? Die Arbeitslosigkeit war ein elementarer Teil der Weimarer Republik und begleitete sie in den 14 Jahren ihres Bestehens, wie es zuvor, und in diesem Umfang, in Deutschland nicht vorgekommen ist. Ausgangspunkt und Vorraussetzung für die Notwendigkeit eines neuen Sozialsystems waren die Folgen des Ersten Weltkrieges und die völlige Fehleinschätzung des Arbeitsmarktes sowie die Annahme, dass Deutschland als Sieger aus diesem Krieg hervor gehen würde. Um das Überleben von Gesellschaft und Staat zu sichern war das wirksame Entgegentreten gegen die Arbeitslosigkeit gerade in diesen Jahren von immenser Bedeutung, allein schon um die Weichen für die Zukunft eines Sozialstaates stellen zu können.
Doch gerade in der Geburtsstunde der Erwerbslosenfürsorge bzw. der Kriegserwerbslosenfürsorge kam es zu vermehrten Problemen in der Durchführung der Ziele, begründet in der Unterschiedlichkeit der Meinungen verschiedener Gruppen und Interessenvertreter, der neuen Situation, in der sich die Menschen zu dieser Zeit befanden und in einem Fehleinschätzen der Entwicklung des Arbeitsmarktes seitens der Regierung. H. Jores sagt in seinem Werk „Die bedeutsamsten Versuche“, dass die Vielfalt der Durchführung der Kriegserwerbslosenfürsorge nichts anderes darstellte als „eine systemlose Summe von Einzelmaßnahmen, von Kriegsnotmaßnahmen, bei denen wir vergebens den einheitlichen Gedanken suchen.“ Um es auf den Punkt zu bringen: Die wesentlichen Kennzeichen der Durchführung der Kriegserwerbslosenfürsorge war die Unterschiedlichkeit fast aller Maßnahmen. Ich werde im Folgenden auf die Entstehung und die fortschreitende Entwicklung der Arbeitslosenunterstützung mit dem Schwerpunkt des Zeitraumes von 1914 bis 1918 eingehen, auf die Probleme, die entstanden sind und wie sich die Weigerung der Regierung, mehr finanzielle Leistungen aufzubringen, darstellte und begründete.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erster Weltkrieg als Auslöser der staatlichen Arbeitslosenunterstützung
- Beginn des Wandels
- Gründung der „Reichszentrale der Arbeitsnachweise“ als einziger Schritt
- Ausführungsbestimmungen der Gemeinden
- Die „Zwangsfreiheit“ der Gemeinden
- Die „Sonderfürsorge“
- Die Fehleinschätzung der Situation
- Der vermehrte Druck
- Der Druck auf das Reich
- Zweifel an der Notwendigkeit der Arbeitslosenunterstützung
- Ein Kompromiss des Reichswirtschaftsamts
- Druck auf das RWA und die Gründung des Reichsarbeitsamts
- Kurzer Blick auf die anschließenden Jahre
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung der Arbeitslosenunterstützung in Deutschland zwischen 1914 und 1918. Sie analysiert die Rolle des Ersten Weltkriegs als Katalysator für die Entwicklung eines neuen Sozialsystems und beleuchtet die Herausforderungen und Probleme, die während dieser Phase auftraten. Die Arbeit untersucht die unzureichende Reaktion der Reichsregierung und die unterschiedlichen Interessen der beteiligten Akteure.
- Die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf den deutschen Arbeitsmarkt
- Die Entstehung der staatlichen Arbeitslosenunterstützung als Reaktion auf die Krise
- Die Herausforderungen bei der Umsetzung der Arbeitslosenunterstützung
- Die Rolle der Reichsregierung und anderer Interessengruppen
- Die Fehleinschätzung der Arbeitsmarktsituation durch die Regierung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Entstehung der Arbeitslosenversicherung in Deutschland und betont die Bedeutung des Themas. Sie führt in die Problematik der Arbeitslosigkeit während der Weimarer Republik ein und hebt die Folgen des Ersten Weltkriegs und die Fehleinschätzung der wirtschaftlichen Lage als zentrale Ursachen hervor. Die Einleitung formuliert die Forschungsfrage und den Fokus auf den Zeitraum von 1914 bis 1918.
Erster Weltkrieg als Auslöser der staatlichen Arbeitslosenunterstützung: Dieses Kapitel analysiert den Ersten Weltkrieg als entscheidenden Auslöser für die Notwendigkeit staatlicher Arbeitslosenunterstützung. Die Umstellung der Wirtschaft auf Rüstungsindustrie führte zu Massenarbeitslosigkeit, die das bestehende Sozialsystem überforderte. Der große Bedarf an Arbeitskräften in Landwirtschaft und Industrie, bedingt durch die Einberufung von Männern, verschärfte die Situation. Das Kapitel zeigt die Grenzen der bisherigen „passiven“ Arbeitslosenpolitik auf und unterstreicht die Notwendigkeit staatlichen Handelns.
Beginn des Wandels: Dieses Kapitel beschreibt die ersten Schritte der Reichsregierung in Richtung Arbeitslosenunterstützung. Die Gründung der „Reichszentrale der Arbeitsnachweise“ wird als unzureichende Maßnahme dargestellt, die die grundlegenden Probleme nicht löste. Das Kapitel erläutert die Ausführungsbestimmungen der Gemeinden, die eine zwar beabsichtigte, aber faktisch nicht verpflichtende, Erwerbslosenfürsorge vorsahen, wobei das Reich nur ein Drittel der Kosten übernahm. Die große Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit wird deutlich gemacht, was die unzureichende Reaktion der Regierung aufzeigt.
Die Fehleinschätzung der Situation: Dieses Kapitel befasst sich mit der grundlegenden Fehleinschätzung der Situation durch die Reichsregierung. Die Annahme eines deutschen Sieges im Ersten Weltkrieg und die Unterschätzung des Ausmaßes der Arbeitslosigkeit wird als zentrale Ursache für das unzureichende Handeln der Regierung hervorgehoben. Die daraus resultierenden Probleme und der wachsende Druck auf die Regierung werden im nächsten Kapitel detailliert beschrieben.
Der vermehrte Druck: Der zunehmende Druck auf die Reichsregierung, wirksame Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit zu ergreifen, wird in diesem Kapitel detailliert dargestellt. Zweifel an der Notwendigkeit der Arbeitslosenunterstützung konfrontierten die Regierung mit weiteren Herausforderungen. Ein Kompromiss des Reichswirtschaftsamts und der anschließende Druck auf das Amt führten schließlich zur Gründung des Reichsarbeitsamts. Dieses Kapitel beschreibt die komplexen politischen und wirtschaftlichen Faktoren, die zu diesem Wandel führten.
Kurzer Blick auf die anschließenden Jahre: Dieser Abschnitt bietet einen kurzen Überblick über die Entwicklungen nach 1918, ohne jedoch ins Detail zu gehen oder die Ereignisse nach 1918 zu analysieren. Er dient als Brücke zum Fazit.
Schlüsselwörter
Arbeitslosenversicherung, Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, Arbeitslosigkeit, Sozialpolitik, Reichsregierung, Reichsarbeitsamt, Kriegserwerbslosenfürsorge, soziale Leistungen, wirtschaftliche Krise.
FAQ: Entstehung der Arbeitslosenunterstützung in Deutschland (1914-1918)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung der staatlichen Arbeitslosenunterstützung in Deutschland zwischen 1914 und 1918. Sie analysiert den Ersten Weltkrieg als Katalysator für die Entwicklung eines neuen Sozialsystems und beleuchtet die Herausforderungen und Probleme dieser Phase.
Welche Rolle spielte der Erste Weltkrieg?
Der Erste Weltkrieg wird als entscheidender Auslöser für die Notwendigkeit staatlicher Arbeitslosenunterstützung dargestellt. Die Umstellung der Wirtschaft auf Rüstungsindustrie und die Einberufung von Männern führten zu Massenarbeitslosigkeit, die das bestehende System überforderte.
Welche ersten Maßnahmen wurden ergriffen?
Die Gründung der „Reichszentrale der Arbeitsnachweise“ erwies sich als unzureichende Maßnahme. Die Ausführungsbestimmungen der Gemeinden sahen eine faktisch nicht verpflichtende Erwerbslosenfürsorge vor, wobei das Reich nur ein Drittel der Kosten übernahm. Die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit zeigt die unzureichende Reaktion der Regierung.
Wie wurde die Situation von der Reichsregierung eingeschätzt?
Die Reichsregierung fehleinschätzte die Situation grundlegend. Die Annahme eines deutschen Sieges und die Unterschätzung des Ausmaßes der Arbeitslosigkeit führten zu unzureichendem Handeln. Der wachsende Druck auf die Regierung resultierte daraus.
Welcher Druck wurde auf die Regierung ausgeübt?
Zunehmender Druck zwang die Reichsregierung, wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Zweifel an der Notwendigkeit der Arbeitslosenunterstützung und Kompromisse des Reichswirtschaftsamts führten schließlich zur Gründung des Reichsarbeitsamts.
Was geschah nach 1918?
Die Arbeit gibt einen kurzen Überblick über die Entwicklungen nach 1918, ohne detaillierte Analysen der Ereignisse nach diesem Jahr.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Arbeitslosenversicherung, Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, Arbeitslosigkeit, Sozialpolitik, Reichsregierung, Reichsarbeitsamt, Kriegserwerbslosenfürsorge, soziale Leistungen, wirtschaftliche Krise.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, dem Ersten Weltkrieg als Auslöser, dem Beginn des Wandels, der Fehleinschätzung der Situation, dem vermehrten Druck, einem kurzen Blick auf die folgenden Jahre und einem Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung detailliert beschrieben.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Entstehung der Arbeitslosenunterstützung in Deutschland zwischen 1914 und 1918, die Rolle des Ersten Weltkriegs und die Herausforderungen und Probleme während dieser Phase, sowie die unzureichende Reaktion der Reichsregierung und die Interessen der beteiligten Akteure.
- Citation du texte
- Daniel Sorg (Auteur), 2004, Die Wurzeln der Arbeitslosenversicherung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47953