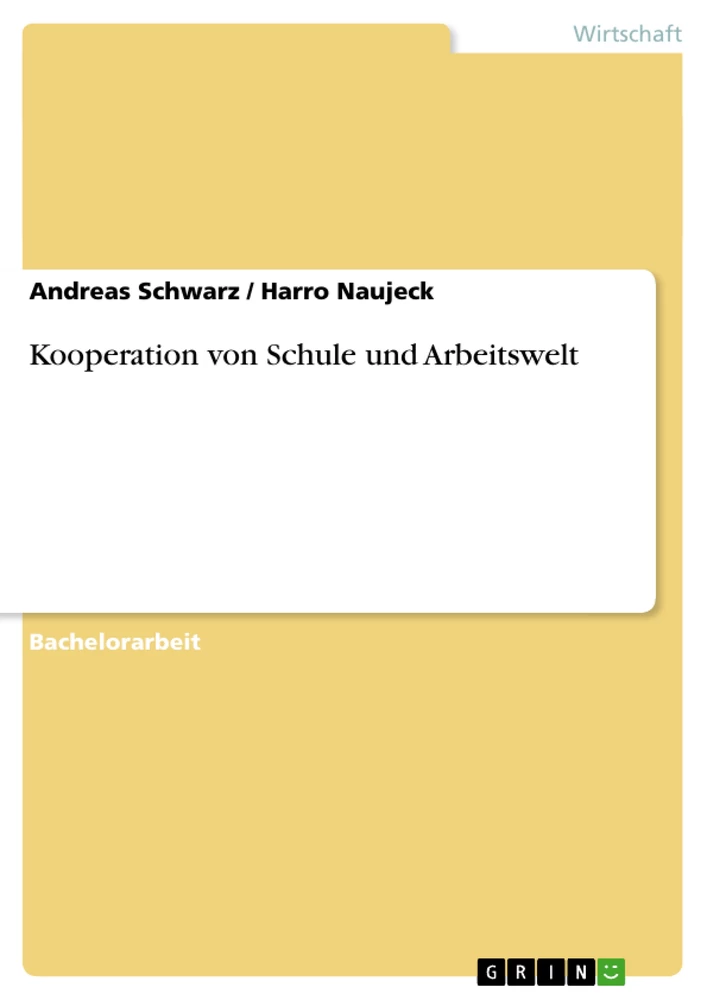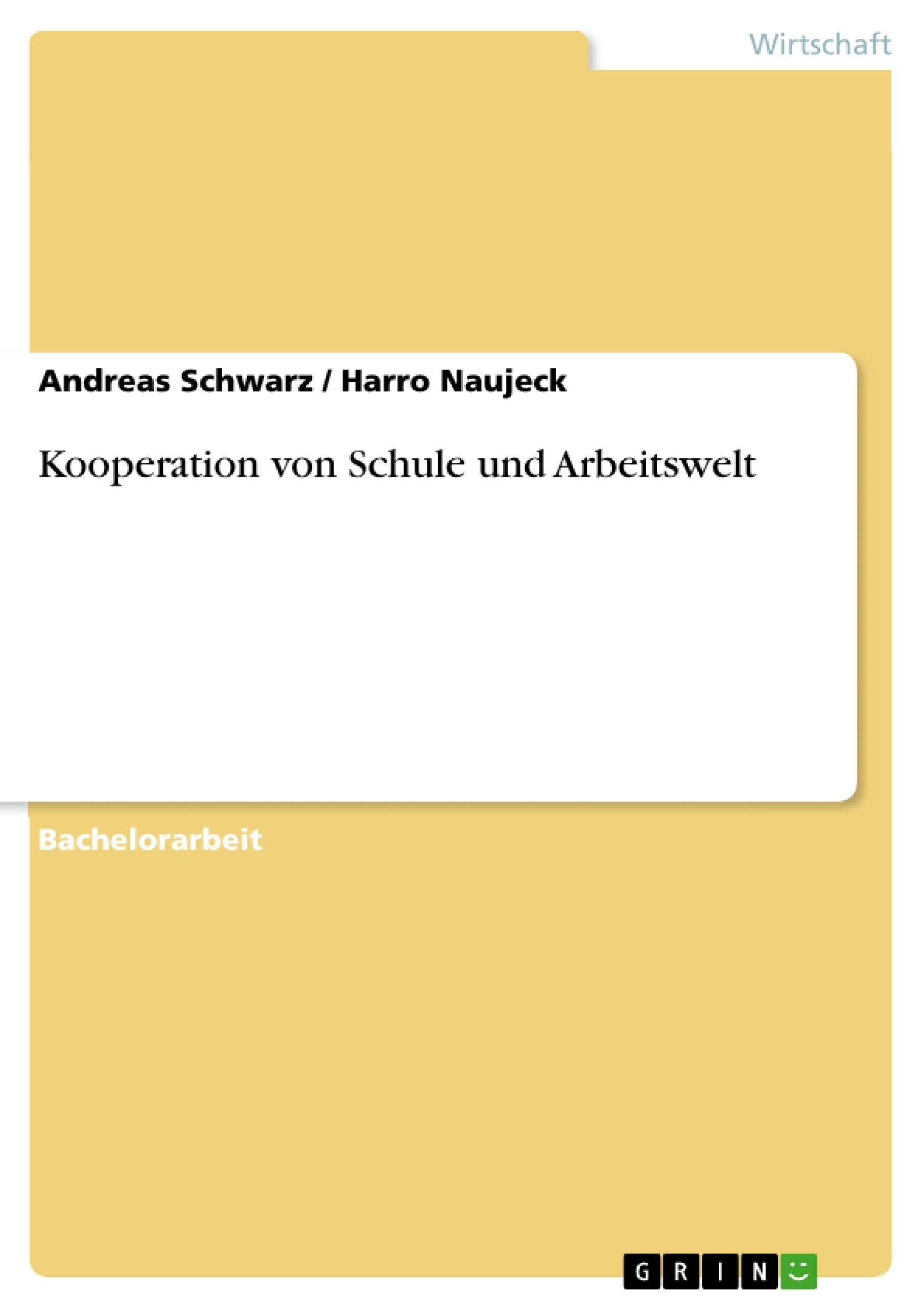The project deals with the cooperation between schools and the professional world. Due to the topical discussion on the PISA 1 -examination, which imputes, the German school system would suffer from elementary educational deficits concerning the pupils’ preparation for the professional world, we wondered, whether the reproaches towards the schools can be confirmed or not. To delimitate the subject, we set the goal to examine the present extent of cooperation between schools and the professional world in Schleswig-Holstein. A further delimitation refers to the cooperating institutes, where we merely focus on the cooperation between the representatives of the private economy on the one hand and (classical) secondary schools and comprehensive schools on the other hand. The reason for this delimitation is, that especially the private economy has to face the increasing demands of dynamically changing circumstances in the competition on the global market. Hence, there can be imputed, that the private economy has a growing interest in the educational qualification of its future employees. Originally, the secondary schools and the equivalent tracks of the comprehensive schools prepare for the attendance of academies and universities, but nowadays a lot of candidates for the matriculation step into the labour market directly, without having attended a university or academy inbetween. So especially these pupils are in need of an education that fits the demands of the professional world. As a reaction to the demands of the private economy, the educational goals of the schools and the individual desires and expectations of the pupils, there may exist a certain degree of cooperation beween these parties to cope with the goals in common. Yet, this cooperation can only take place within the legal boundaries, which in German schools are determined by the governments of the federal states like Schleswig-Holstein. The wide range of cooperation types can be summarized in three major categories. Profession-oriented measures focus on the mediation of professional skills and activities, that support the pupils’ choice of profession. The customary activities within this category are [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung.
- 2 Kooperationsbedarf...
- 2.1 Bedarf der Privatwirtschaft
- 2.2 Bedarf der Schüler.
- 2.3 Bedarf der Schule.
- 3 Kooperationsformen...
- 3.1 Organisatorische Unterscheidungskriterien.
- 3.1.1 Freiwilligkeit..
- 3.1.2 Teilnehmer
- 3.1.3 Zeitliche Organisation.
- 3.1.4 Örtliche Organisation ..
- 3.1.5 Methodische Organisation
- 3.2 Inhaltliche Unterscheidungskriterien.
- 3.2.1 Berufsorientierte Maßnahmen..
- 3.2.2 Wirtschaftsorientierte Maßnahmen.
- 3.2.3 Sponsoring.......
- 4 Methode der Erhebung
- 4.1 Untersuchungsziele.
- 4.2 Bestimmung der Erhebungsmethode
- 4.2.1 Die Befragung .
- 4.2.2 Die Inhaltsanalyse .
- 4.2.3 Die Beobachtung.
- 4.3 Die Gütekriterien
- 4.3.1 Objektivität.
- 4.3.2 Reliabilität.
- 4.3.3 Validität..
- 4.4 Population und Stichprobe
- 4.5 Konstruktion des Erhebungsinstruments
- 4.5.1 Grundsätzliche Überlegungen.
- 4.5.2 Zum Aufbau des Fragebogens
- 4.5.2.1 Allgemeine Angaben....
- 4.5.2.2 Angaben zu den Kooperationsmaßnahmen.
- 4.5.2.3 Angaben zur Einschätzung der Kooperation.
- 4.6 Zum Befragungsablauf...
- 4.6.1 Vorbereitende Maßnahmen.
- 4.6.1.1 Persönlicher Kontakt.
- 4.6.1.2 Der Prätest.
- 4.6.1.3 Das Begleitschreiben.
- 4.6.2 Bearbeitung des Rücklaufs.
- 4.6.2.1 Datenüberprüfung
- 4.6.2.2 Datenauswertung
- 5 Ergebnisse der Befragung.
- 5.1 Ergebnisse zu den Kooperationsmaßnahmen.
- 5.1.1 Praktika
- 5.1.2 Berufsinformationsveranstaltungen
- 5.1.3 Bewerbungstraining.
- 5.1.4 Training beruflicher Kompetenzen
- 5.1.5 Wirtschaftlicher Unterricht.
- 5.1.6 Unterricht durch externe Experten..
- 5.1.7 Betriebserkundungen...
- 5.1.8 Unternehmenssimulationen..
- 5.1.9 Schülerfirmen .
- 5.1.10 Börsenplanspiele.
- 5.1.11 Lehrerfortbildung
- 5.1.12 Sponsoring….....
- 5.1.13 Übrige Maßnahmen..
- 5.1.14 Zusammenfassende Übersicht..
- 5.2 Vergleich von Gymnasien und Gesamtschulen.
- 5.2.1 Überprüfung der Hypothese 1
- 5.2.2 Die Kooperationsmaßnahmen im Vergleich.
- 5.3 Ergebnisse der Einstellungsfragen
- 5.3.1 Überprüfung der Hypothese 2..
- 5.3.2 Einstellungen......
- 5.3.3 Die Einstellungen im Vergleich.
- 6 Diskussion der Ergebnisse .....
- Der Bedarf der Privatwirtschaft an qualifizierten Nachwuchskräften
- Die Bedürfnisse und Erwartungen der Schüler im Hinblick auf die Berufsvorbereitung
- Die Rolle der Schule bei der Gestaltung der Zusammenarbeit mit der Arbeitswelt
- Die verschiedenen Formen der Kooperation zwischen Schule und Arbeitswelt
- Die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Kooperation zwischen Schule und Arbeitswelt in Schleswig-Holstein
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Zusammenarbeit zwischen Schule und Arbeitswelt in Schleswig-Holstein. Die Arbeit zielt darauf ab, den aktuellen Stand der Kooperation zwischen Schulen und Unternehmen in Schleswig-Holstein zu erforschen, insbesondere die Zusammenarbeit zwischen der Privatwirtschaft und Gymnasien sowie Gesamtschulen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit bietet eine Einleitung in das Thema der Kooperation zwischen Schule und Arbeitswelt. Es werden die wichtigsten Herausforderungen und Chancen dieser Zusammenarbeit erläutert sowie die Relevanz des Themas im Kontext der aktuellen Bildungsreformen hervorgehoben. Das zweite Kapitel beleuchtet den Bedarf an Kooperation aus Sicht der Privatwirtschaft, der Schüler und der Schule. Es werden die unterschiedlichen Bedürfnisse und Erwartungen der beteiligten Akteure betrachtet und die Notwendigkeit einer intensiven Zusammenarbeit betont. Das dritte Kapitel behandelt verschiedene Formen der Kooperation zwischen Schule und Arbeitswelt. Es werden organisatorische und inhaltliche Unterscheidungskriterien vorgestellt und die jeweiligen Vor- und Nachteile der einzelnen Kooperationsformen diskutiert. Das vierte Kapitel beschreibt die Methode der Erhebung, die zur Analyse der Kooperation zwischen Schule und Arbeitswelt in Schleswig-Holstein eingesetzt wurde. Es werden die Untersuchungsziele, die Erhebungsmethode sowie die Gütekriterien der Untersuchung erläutert. Das fünfte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung, die sich auf die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Unternehmen in Schleswig-Holstein konzentriert. Es werden die Ergebnisse zu den verschiedenen Kooperationsmaßnahmen, ein Vergleich zwischen Gymnasien und Gesamtschulen sowie die Ergebnisse der Einstellungsfragen analysiert. Das sechste Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Untersuchung und zieht Schlussfolgerungen für die Praxis. Es werden Empfehlungen für eine nachhaltige und effektive Kooperation zwischen Schule und Arbeitswelt abgeleitet.
Schlüsselwörter
Die Bachelorarbeit befasst sich mit den Themen der Kooperation zwischen Schule und Arbeitswelt, Berufsvorbereitung, Bildungsreformen, empirische Forschung, Schleswig-Holstein, Gymnasium, Gesamtschule, Privatwirtschaft, Kooperationsformen, Befragung, Inhaltsanalyse, Gütekriterien, Hypothesenprüfung, Ergebnisse, Diskussion, Empfehlungen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Kooperation zwischen Schulen und Unternehmen in Schleswig-Holstein.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht die Arbeit zur Kooperation von Schule und Arbeitswelt?
Die Bachelorarbeit erforscht den aktuellen Stand und die Formen der Zusammenarbeit zwischen der Privatwirtschaft und Gymnasien bzw. Gesamtschulen in Schleswig-Holstein.
Welchen Einfluss hatte die PISA-Studie auf dieses Thema?
Die PISA-Ergebnisse lösten eine Diskussion über Bildungsdefizite bei der Vorbereitung von Schülern auf die Berufswelt aus, was den Bedarf an Kooperationen verstärkte.
Welche Kooperationsformen werden in der Praxis genutzt?
Häufige Maßnahmen sind Praktika, Bewerbungstrainings, Betriebserkundungen, Schülerfirmen, Börsenspiele und Sponsoring.
Warum hat die Privatwirtschaft ein Interesse an Schulen?
Unternehmen benötigen qualifizierte Nachwuchskräfte, die den dynamischen Anforderungen des globalen Marktes gewachsen sind.
Gibt es Unterschiede zwischen Gymnasien und Gesamtschulen?
Die Arbeit vergleicht beide Schulformen hinsichtlich der Intensität und der Art der durchgeführten Kooperationsmaßnahmen.
- Arbeit zitieren
- Andreas Schwarz (Autor:in), Harro Naujeck (Autor:in), 2002, Kooperation von Schule und Arbeitswelt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48029