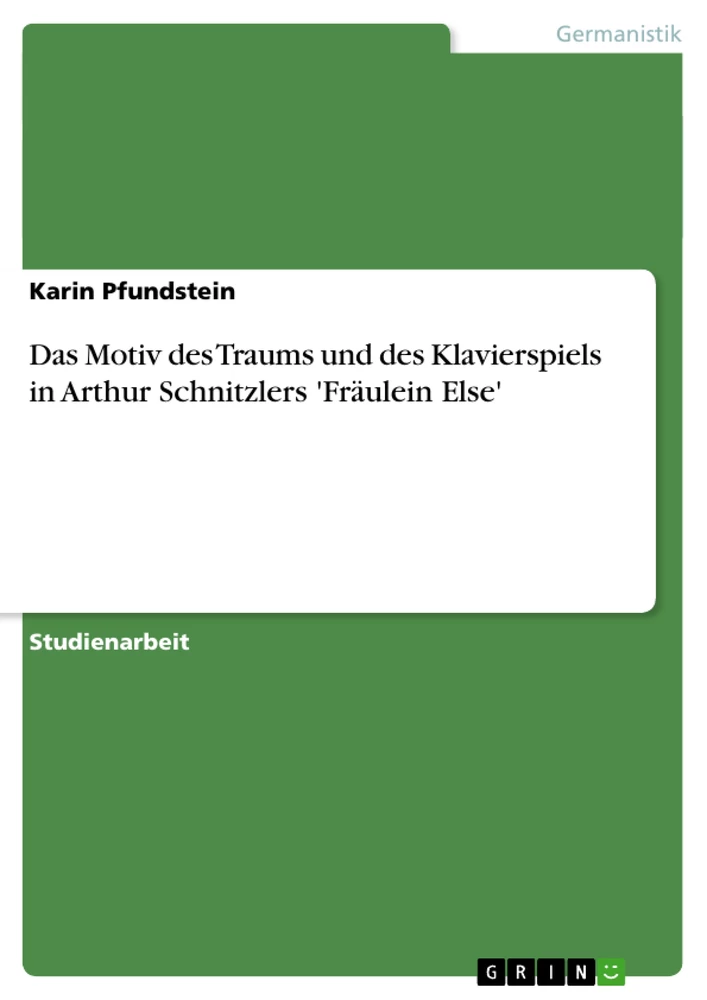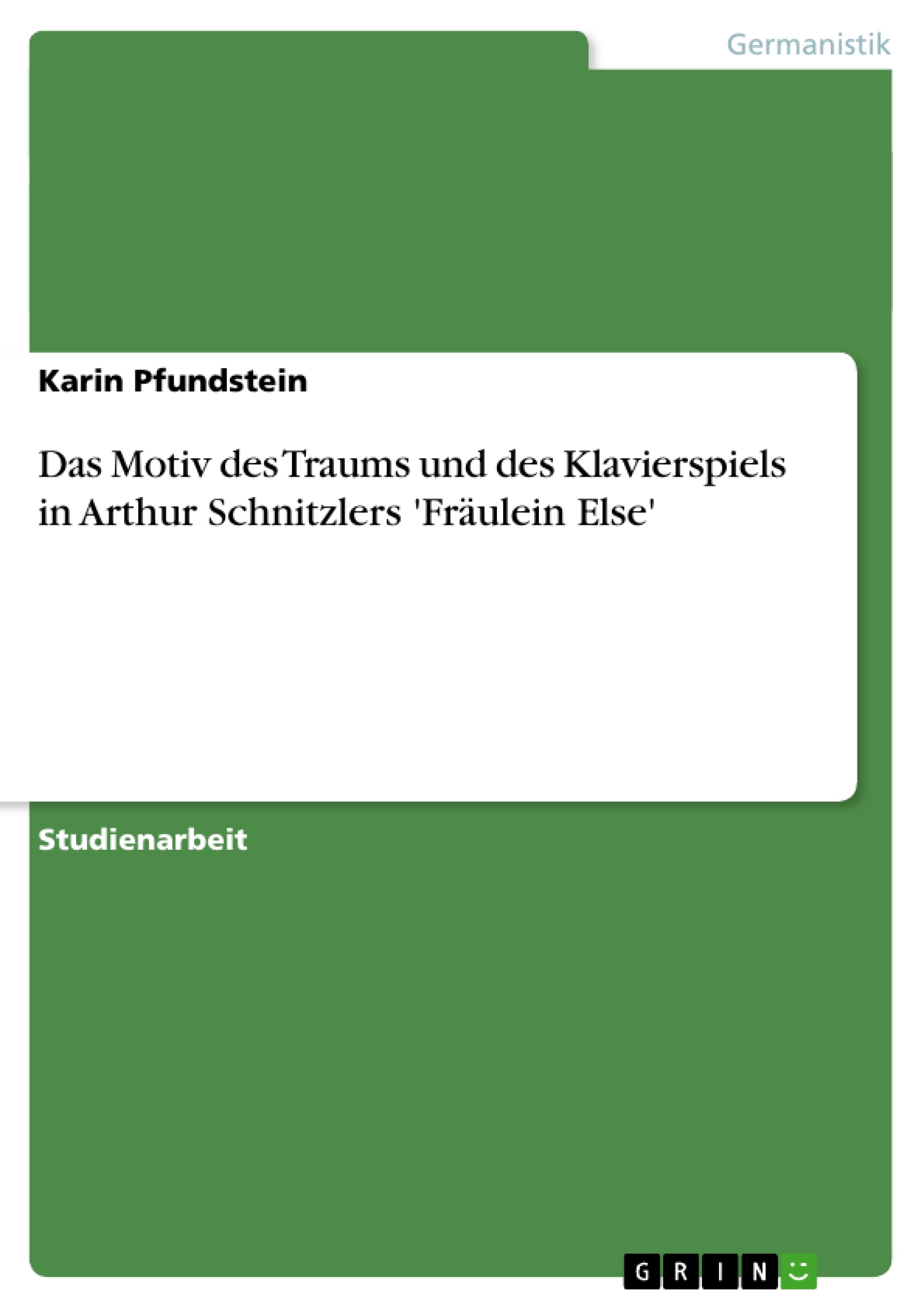Fräulein Else von Arthur Schnitzler erschien 1924 als seine zweite "Monolognovelle", die als Nachfolger des knapp ein Vierteljahrhundert früher erschienenen Leutnant Gustl gesehen werden kann. In der Arbeit wird sowohl auf temporale als auch auf narrative Besonderheiten hingewiesen und darüber hinaus auf die beiden Motive "Traum" und "Klavierspiel" eingegangen. Besondere Aufmerksamkeit wird letzterem geschenkt: Die Arbeit zeigt, inwieweit die Aufnahme von Notenzitaten als Mittel eingesetzt wird, um Elses Zusammenbruch zu "katalysieren.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Thematik
- Zeitlichkeit
- Das Traummotiv und der Tod
- Erzählsituation
- Das Musikzitat
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Analyse von Arthur Schnitzlers "Fräulein Else" und untersucht dabei die zeitlichen und narrativen Besonderheiten der Erzählung. Besonderes Augenmerk wird auf die beiden Motive "Traum" und "Klavierspiel" gelegt, wobei die Bedeutung des Musikzitats für Elses psychischen Zusammenbruch hervorgehoben wird.
- Die Bedeutung des Inneren Monologs und die Darstellung des Bewusstseins
- Das Motiv des Traums und seine Verbindung zum Tod
- Das Klavier als Symbol und die Rolle des Musikzitats
- Die zeitliche Struktur der Erzählung und die Darstellung der erzählten Zeit
- Die gesellschaftlichen Verhältnisse und die problematische finanzielle Situation der Familie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Zur Thematik
Die Novelle "Fräulein Else" wird als Schnitzlers zweite "Monolognovelle" vorgestellt, die als Nachfolger von "Leutnant Gustl" verstanden werden kann. Die Arbeit analysiert sowohl zeitliche als auch narrative Besonderheiten der Erzählung und befasst sich mit den Motiven "Traum" und "Klavierspiel".
2. Zeitlichkeit
Schnitzlers Erzählung schildert die Gedanken der 19jährigen Else während der letzten Stunden ihres Lebens. Die erzählte Zeit lässt sich nicht genau rekonstruieren, doch es lassen sich einige Anhaltspunkte finden. Die Erzählzeit entspricht der chronologischen Abfolge von Elses Bewusstseinsvorgängen, wobei einige gedankliche Analepsen die Chronologie unterbrechen. Die Familie wird als finanziell problematisch dargestellt, trotz der prekären Lage werden gesellschaftliche Verpflichtungen nicht aufgegeben.
2.1. Das Traummotiv und der Tod
Die Traumsequenz in "Fräulein Else" wird mit dem Ende der Erzählung verglichen. Das Motiv des Traums wird als Bewusstseinszustand Elses wiederaufgenommen. Elses Traum von ihrem eigenen Tod und das erlebte Glück im Traum kontrastieren mit ihrer Todessehnsucht und dem realen Tod. Der erlösende Traum, in dem sie selbstbestimmt handeln kann, steht im Gegensatz zur Situation im Leben, in der sie ihrem Vater verpflichtet ist und dem Angebot von Dorsday nachgeben muss.
3. Erzählsituation
Die Erzählsituation ist durch das personale Erzählen gekennzeichnet. Der Leser erlebt die Geschichte aus Elses Perspektive und erhält Einblick in ihre Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen. Schnitzler geht einen Schritt weiter als in "Leutnant Gustl", indem er das Unterbewusstsein Elses auch während des Schlafens weiterlaufen lässt. Dies wird am Ende der Erzählung fortgesetzt, wo Elses Gedanken wie in einem Traum an ihr vorbeiziehen.
Schlüsselwörter
Schnitzlers "Fräulein Else", Innerer Monolog, Bewusstseinsdarstellung, Traummotiv, Tod, Klavier, Musikzitat, zeitliche Struktur, erzählte Zeit, gesellschaftliche Verhältnisse, finanzielle Situation, Selbstmord, Todessehnsucht.
- Arbeit zitieren
- Karin Pfundstein (Autor:in), 2004, Das Motiv des Traums und des Klavierspiels in Arthur Schnitzlers 'Fräulein Else', München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48155