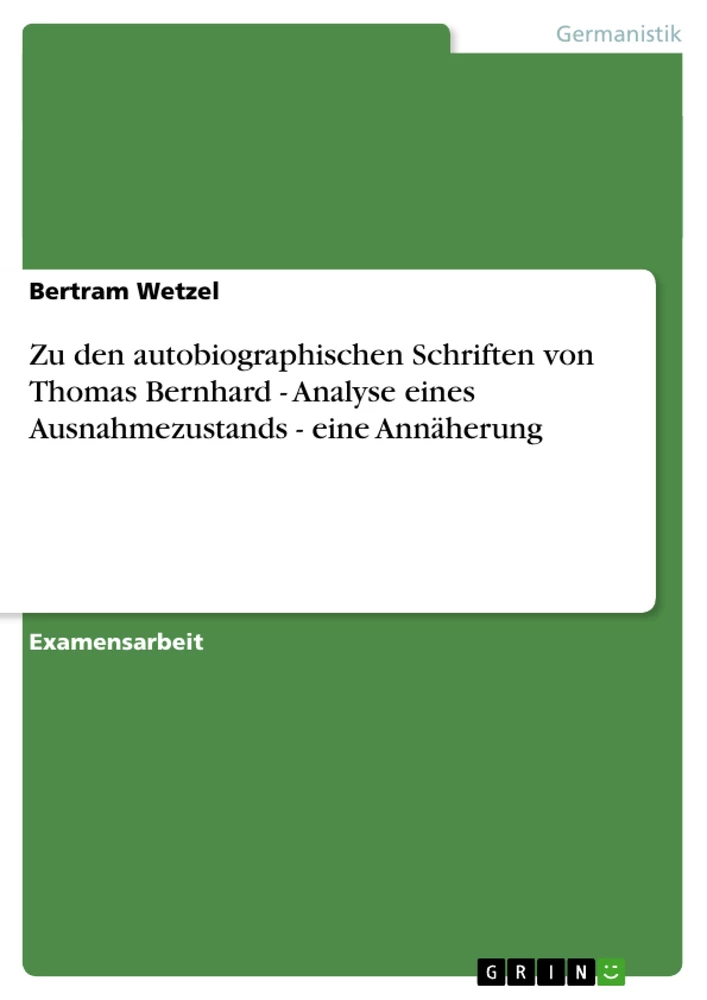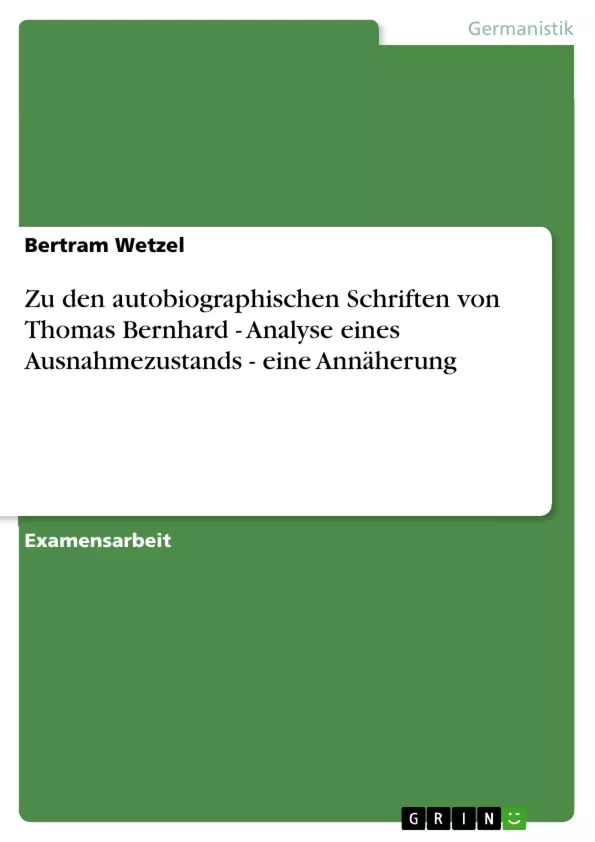I. Einleitung
Viele Kommentare, viele Leserbriefe, viele Empörungen und viele Missverständnisse vor allem - das waren häufig die Reaktionen auf Neu-Erscheinungen von Thomas Bernhard. Die Provokation war quasi vorprogrammiert. Falls im Jahr 2005 beim Lesen und Studieren überhaupt noch etwas nachhaltig zu provozieren und zu irritieren vermag, dabei womöglich auch noch die eigenen Rezeptionsgewohnheiten durcheinander rüttelt, so eignen sich die Werke Bernhards immer noch hervorragend, gleichwohl der Autor seit nunmehr sechzehn Jahren ‚seinen Frieden gefunden’ hat.
Dennoch scheint es gerade bei Bernhard unangemessen, sich voreilig provozieren oder gar abschrecken zu lassen von dem, was man mitunter vorgesetzt bekommt, denn wo die Provoktion sonst oft nur noch effektheischendes Aufflackern ist, da kann sich kein nachhaltiger Widerstand mehr regen, und da ist auch kein Leben mehr.
Nehmen wir schlicht an, was wir vorfinden, betrachten wir es immer wieder gründlich, bevor wir es in uns aufnehmen, mit sämtlichen bitteren Beigeschmäcken, und nehmen wir uns vor allem viel Ruhe beim Verdauen. Seien wir stets wählerisch bei der Wahl unseres Bestecks, denn mit literaturwissenschaftlichen Standardwerkzeugen (Seziermessern, Pinzetten, Mikroskopen, Schraubstöcken, Schablonen und dergleichen) ist dem gesamten Werk dieses Autors ohnehin nicht angemessen zu begegnen, auch nicht seinen autobiographischen Schriften. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Dichtung und Wahrheit
- II.1 Autobiographisches Material in Bernhards Werk
- II.2 Erinnerung als „Selbsterlebensbeschreibung“
- II.3 Von der „Ursache“ zum „Kind“
- III. „Jedes Wort ein Treffer, jedes Kapitel eine Weltanklage, und alles zusammen eine totale Weltrevolution bis zur totalen Auslöschung“
- IV. Absurdität des Daseins
- V. Lachen, Weinen, Brüllen, Kopfschütteln - oder alles auf einmal: Komik und Groteske in Bernhards Kindheits- und Jugenderinnerungen
- VI. Schweigen oder „Herr Bernhard, wir danken Ihnen für das ultimative Gespräch“
- VII. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die autobiographischen Schriften Thomas Bernhards. Ziel ist es, die spezifischen Merkmale seines autobiographischen Schreibens zu analysieren und dessen Stellung innerhalb seines Gesamtwerks zu bestimmen. Die Arbeit beleuchtet die komplexe Beziehung zwischen Fiktion und Realität in Bernhards Texten.
- Die Gattungsfrage des autobiographischen Schreibens bei Bernhard
- Die Beziehung zwischen Erinnerung und Selbstdarstellung
- Stilmittel, Syntax und Rhetorik als Ausdruck von Weltanschauung
- Die Darstellung von Absurdität und Groteske
- Die Frage nach Wahrheit und Interpretation in Bernhards Werk
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die provokative Natur von Bernhards Werk und die Schwierigkeiten, die sich bei dessen Interpretation stellen. Sie argumentiert für eine differenzierte, vorsichtige und emphatische Herangehensweise, die die literaturwissenschaftlichen Standardwerkzeuge hinterfragt und die Komplexität des Autors anerkennt. Der Text betont die Notwendigkeit, die Grenze zwischen Fiktion und Realität in Bernhards autobiographischen Schriften sorgfältig zu untersuchen und die subtile Ironie zu berücksichtigen.
II. Dichtung und Wahrheit: Dieses Kapitel untersucht die Einordnung der autobiographischen Schriften in Bernhards Gesamtwerk. Es analysiert den Gebrauch autobiographischen Materials und die Entwicklung der Darstellung von Kindheit und Jugend in seinen Werken. Der Schwerpunkt liegt auf der Frage, inwieweit die Texte faktisch sind und wie Bernhard Erinnerung literarisch gestaltet. Das Kapitel diskutiert die konzeptionellen und inhaltlichen Entwicklungstendenzen in Bernhards autobiographischen Schriften.
III. „Jedes Wort ein Treffer, jedes Kapitel eine Weltanklage, und alles zusammen eine totale Weltrevolution bis zur totalen Auslöschung“: Dieses Kapitel analysiert die Stilmittel, Syntax und Rhetorik in Bernhards autobiographischen Schriften. Es untersucht, wie diese stilistischen Elemente zur Gesamtwirkung und Aussagekraft der Texte beitragen und wie sie Bernhards Weltanschauung und Kritik ausdrücken. Die Analyse konzentriert sich auf die sprachliche Gestaltung und deren Bedeutung für das Verständnis der Texte.
IV. Absurdität des Daseins: Der vierte Abschnitt befasst sich mit der Ich-Findung und der Existenzanalyse in Bernhards autobiographischen Schriften. Er untersucht die Darstellung der menschlichen Existenz als absurd und die damit verbundenen Themen wie Sinnlosigkeit und Verzweiflung. Das Kapitel analysiert, wie Bernhard diese Themen durch seine Schreibweise und die gewählte Perspektive vermittelt.
V. Lachen, Weinen, Brüllen, Kopfschütteln - oder alles auf einmal: Komik und Groteske in Bernhards Kindheits- und Jugenderinnerungen: Hier wird die Verwendung von Komik und Groteske in Bernhards Darstellung seiner Kindheit und Jugend untersucht. Der Fokus liegt auf der Analyse der Funktionen dieser Stilmittel, wie sie die Lesererfahrung beeinflussen und wie sie die ernsten Themen des Werkes konterkarieren oder verstärken. Das Kapitel untersucht die Verbindung von Humor und tiefer Melancholie in den Texten.
VI. Schweigen oder „Herr Bernhard, wir danken Ihnen für das ultimative Gespräch“: Dieses Kapitel befasst sich mit einem hypothetischen, postumen Interview mit Bernhard über sein Leben und Werk. Es dient als Reflexion über die Bedeutung und Interpretation seiner autobiographischen Schriften und deren Relevanz im Kontext aktueller literarischer und medialer Entwicklungen. Der hypothetische Dialog erlaubt eine zusätzliche Perspektive auf das Thema.
Schlüsselwörter
Thomas Bernhard, Autobiographie, Erzählprosa, Stilanalyse, Erinnerung, Identität, Absurdität, Groteske, Wahrheit, Fiktion, Interpretation, Existenzanalyse, Provokation.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der autobiographischen Schriften Thomas Bernhards
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die autobiographischen Schriften Thomas Bernhards. Sie untersucht die spezifischen Merkmale seines autobiographischen Schreibens, dessen Stellung innerhalb seines Gesamtwerks und die komplexe Beziehung zwischen Fiktion und Realität in seinen Texten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet folgende Themenschwerpunkte: die Gattungsfrage des autobiographischen Schreibens bei Bernhard, die Beziehung zwischen Erinnerung und Selbstdarstellung, Stilmittel, Syntax und Rhetorik als Ausdruck von Weltanschauung, die Darstellung von Absurdität und Groteske, und die Frage nach Wahrheit und Interpretation in Bernhards Werk.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Eine Einleitung, die die Herangehensweise an Bernhards provokatives Werk beschreibt; ein Kapitel zu „Dichtung und Wahrheit“, das die Einordnung der autobiographischen Schriften in Bernhards Gesamtwerk untersucht; ein Kapitel zur Stilistik Bernhards; ein Kapitel zur Absurdität des Daseins in seinen autobiographischen Schriften; ein Kapitel zur Komik und Groteske in seinen Werken; ein hypothetisches Interview mit Bernhard als Reflexion über sein Werk; und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse spezifischer Aspekte von Bernhards autobiographischem Schreiben.
Wie wird die Beziehung zwischen Fiktion und Realität behandelt?
Die Arbeit betont die Notwendigkeit, die Grenze zwischen Fiktion und Realität in Bernhards autobiographischen Schriften sorgfältig zu untersuchen und die subtile Ironie zu berücksichtigen. Sie analysiert, inwieweit die Texte faktisch sind und wie Bernhard Erinnerung literarisch gestaltet.
Welche Rolle spielen Stilmittel und Rhetorik?
Die Arbeit analysiert die Stilmittel, Syntax und Rhetorik in Bernhards autobiographischen Schriften und untersucht, wie diese stilistischen Elemente zur Gesamtwirkung und Aussagekraft der Texte beitragen und Bernhards Weltanschauung und Kritik ausdrücken.
Wie wird die Absurdität des Daseins dargestellt?
Die Arbeit untersucht die Darstellung der menschlichen Existenz als absurd und die damit verbundenen Themen wie Sinnlosigkeit und Verzweiflung in Bernhards autobiographischen Schriften. Sie analysiert, wie Bernhard diese Themen durch seine Schreibweise und die gewählte Perspektive vermittelt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Thomas Bernhard, Autobiographie, Erzählprosa, Stilanalyse, Erinnerung, Identität, Absurdität, Groteske, Wahrheit, Fiktion, Interpretation, Existenzanalyse, Provokation.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für Leser bestimmt, die sich für das Werk Thomas Bernhards, insbesondere seine autobiographischen Schriften, interessieren. Sie richtet sich an Wissenschaftler, Studenten und alle, die sich mit literaturwissenschaftlichen Methoden und der Interpretation komplexer Texte auseinandersetzen möchten.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet literaturwissenschaftliche Methoden zur Analyse von Bernhards Texten. Sie betont eine differenzierte, vorsichtige und emphatische Herangehensweise, die die Standardwerkzeuge hinterfragt und die Komplexität des Autors anerkennt.
- Quote paper
- Bertram Wetzel (Author), 2005, Zu den autobiographischen Schriften von Thomas Bernhard - Analyse eines Ausnahmezustands - eine Annäherung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48169