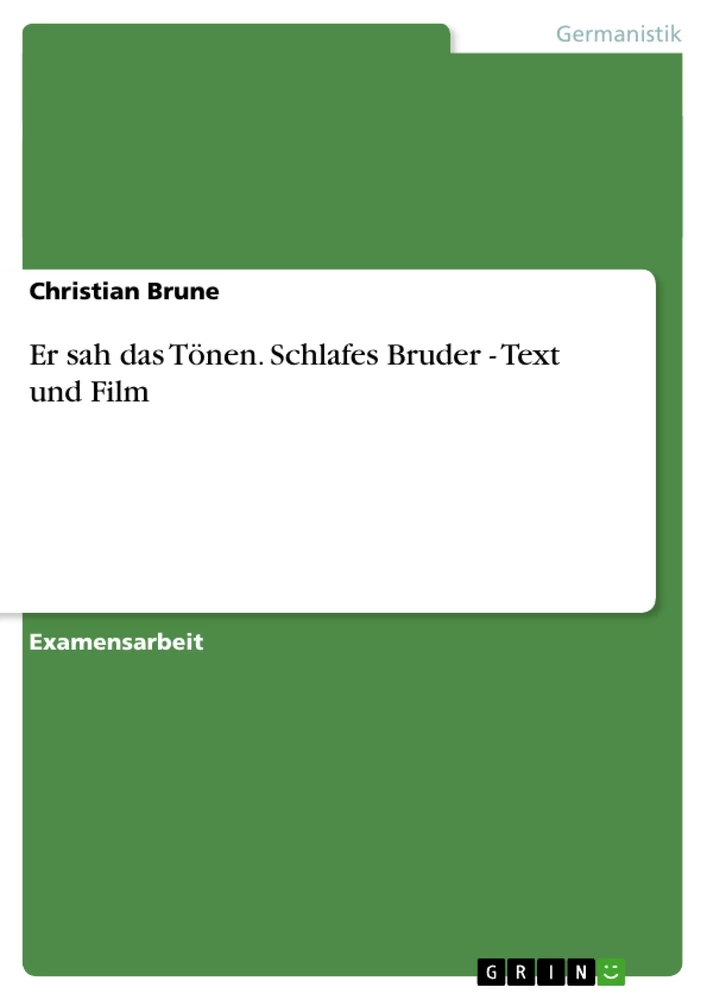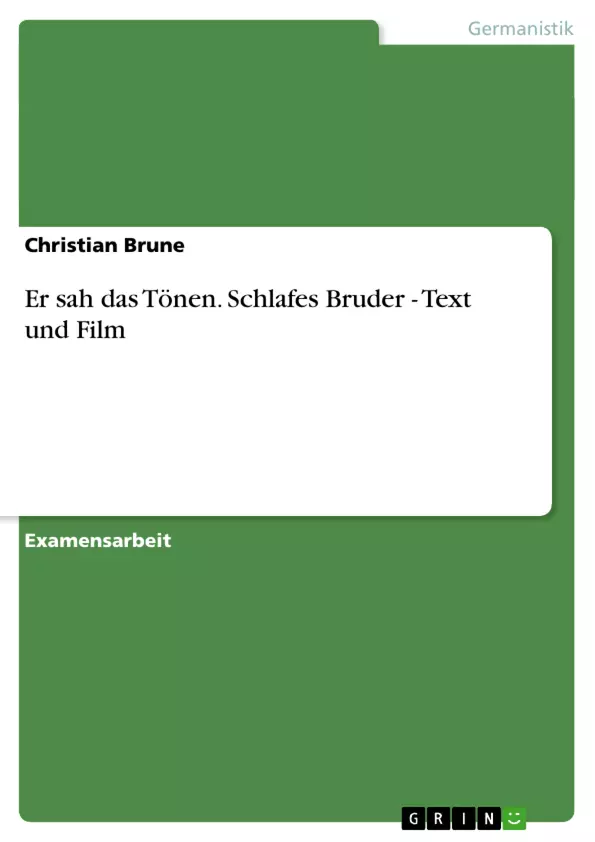In dem Kapitel „Das Wunder seines Hörens“ beschreibt der Erzähler in Robert Schneiders Schlafes Bruder, wie dem fünfjährigen Johannes Elias Alder auf wundersame Weise ein vollkommenes Gehör geschenkt wird. Es wird wortgewaltig ausgeführt, wie er erst seine nächste Umgebung, dann sein Heimatdorf, dann das Gebirge und schließlich alle Geräusche der Welt auf einmal hört, während sich sein Körper auf unvorstellbare Art und Weise deformiert. Immer unwahrscheinlicher, aber auch immer schillernder wird die Schilderung, die der Erzähler abschließt mit dem Ausruf „Was sind Worte!“. Genau hier befindet sich der Ansatz zu dieser Arbeit: Was sind eigentlich Worte? Was bewirken sie? Und was wird daraus von anderen gemacht?
Zuerst einmal ist zu evaluieren, was ich daraus mache: Ein grundlegendes Verständnis des Romans, der Bilder und Leitmotive bildet die unverzichtbare Basis, weshalb im ersten Teil der Arbeit genau dies im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen wird. Nur von einem klar interpretierten Standpunkt aus können die weiteren Untersuchungen überhaupt erst Sinn machen. Die Worte des Romans selbst also geben einen ersten Hinweis auf die vom Erzähler gestellte und von mir aufgenommene Leitfrage.
Im selben Kapitel wird ein besonderes Detail erwähnt, das in seiner einfachen Struktur dennoch eine Menge spannender Fragen beinhaltet. Elias erweitert in der betreffenden Szene nicht einfach sein Gehör, nein „er sah das Tönen“! Auch wir, die Rezipienten des Werkes, können das Tönen sehen, denn es gibt einen Film zum Buch, oder besser gesagt: nach Motiven aus Schlafes Bruder. Hier setzt der zweite Teil der Arbeit an, wieder geleitet von der Frage, was Worte sind und was aus ihnen gemacht wird. Unweigerlich drängt sich spätestens an dieser Stelle ein Begriff auf, der nicht beiseite geschoben werden kann und soll: Intermedialität. Was passiert mit einem Roman, wenn er in einen Film ‚übersetzt‘ wird? Gibt es eine Hierarchisierung, steht der Roman über dem Film oder umgekehrt? In welchem Abhängigkeitsverhältnis stehen die beiden Werke zueinander? Neben einer Begriffsbestimmung werden allgemeine Überlegungen zur Literaturverfilmung im Blickpunkt stehen, die am Praxisbeispiel Schlafes Bruder manifestiert werden sollen. Formen der Intermedialität und Thesen zur Verfilmbarkeit von Literatur und zum Begriff „Literaturverfilmung“ werden anhand des vorliegenden Buches und Films diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erster Teil
- >>Was sind Worte!<<
- Das Buch ,,Schlafes Bruder''
- 1.1 Einleitende Gedanken zum Roman
- 1.1.1 Warum „Schlafes Bruder“?
- 1.1.2 Eine kurze Rezeptionsgeschichte
- 1.1.3 Zu Inhalt und Figurenkonstellation
- 1.2 Die Leitmotive
- 1.2.1 Das Motiv ,,Stein''
- 1.2.2 Das Motiv ,,Feuer''
- 1.2.3 Das Motiv ,,Wasser''
- 1.2.4 Das Motiv ,,Dorf''
- 1.2.5 Sprachlosigkeit vs. Schreien
- 1.2.6 Liebe vs. Musik
- 1.2.7 Liebe vs. Tod
- 1.2.8 Verschiedene Lesarten
- 1.2.9 Die Frage der „Schuld“ an einer gescheiterten Existenz
- 1.3 Das Spiel mit der Sprache als Hauptsache eines literarischen Textes
- 1.3.1 Möglichkeiten, Wirkungen und Grenzen der Sprache in, Schlafes Bruder'
- 1.3.2 Das Verhältnis von Erzähler und Erzählung
- 1.3.3 Das Verhältnis vom Erzähler zum Leser
- 1.3.4 Das Verhältnis vom Leser zur Erzählung
- Zweiter Teil
- >>Er sah das Tönen.<<
- Die Verwandlung des Buches in einen Kinofilm
- 2.1 Allgemeine Gedanken zur Literaturverfilmung
- 2.1.1 Von der Intertextualität zur Intermedialität
- 2.1.2 Die Intermedialitätsformel
- 2.1.3 Es gibt keine Literaturverfilmung! Über die Berechtigung des Begriffs
- 2.1.4 Thesen zur Verfilmbarkeit von Literatur
- 2.2 Der Vilsmaier-Film »Schlafes Bruder<<
- 2.2.1 Allgemeine Informationen zum Film
- 2.2.2 Die Erkennung des Genotextes
- 2.2.3 Die Umsetzung des Genotextes im Film
- 2.3 Analyse einzelner Szenen
- 2.3.1 Intermediale Bedienungsanleitung
- 2.3.2 Die Dorfkulisse und Personen
- 2.3.3 Die Taufe
- 2.3.4 Das Hörwunder
- 2.3.5 Elias' vergeistigte Liebe
- 2.3.6 Die Doppelszene
- 2.3.7 Die Reaktion der Eschberger Bürger
- 2.3.8 Dialoge anstatt Sprachlosigkeit
- 2.4 Zusammenfassung
- Das Verhältnis von Literatur und Film
- Die Bedeutung von Sprache in literarischen und filmischen Texten
- Die Intermedialität, insbesondere in Bezug auf „Schlafes Bruder“
- Die Analyse der Leitmotive des Romans
- Die Umsetzung des Romans in den Film und die daraus entstehenden Veränderungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Roman „Schlafes Bruder“ von Robert Schneider und seine Verfilmung durch Joseph Vilsmaier im Hinblick auf die Frage, wie Sprache in beiden Medien funktioniert und welche Bedeutung sie in den jeweiligen Werken erhält. Dabei wird insbesondere der Frage nach der Intermedialität, dem Verhältnis von Literatur und Film, nachgegangen. Die Arbeit analysiert die Leitmotive des Romans und betrachtet die Umsetzung des Genotextes im Film. Im Fokus stehen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Roman und Film sowie die spezifischen Möglichkeiten und Grenzen beider Medien.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die zentrale Frage nach der Bedeutung von Sprache im Roman „Schlafes Bruder“ und seiner Verfilmung. Im ersten Teil der Arbeit wird der Roman selbst analysiert. Hier werden die Leitmotive des Romans untersucht, wie zum Beispiel das Motiv „Stein“, „Feuer“ und „Wasser“. Weiterhin wird das Verhältnis von Erzähler und Erzählung sowie das Verhältnis von Erzähler und Leser beleuchtet. Im zweiten Teil der Arbeit wird die Verfilmung des Romans behandelt. Hier werden allgemeine Gedanken zur Literaturverfilmung und die Besonderheiten der Vilsmaier-Verfilmung von „Schlafes Bruder“ diskutiert. Die Analyse einzelner Szenen beleuchtet die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Roman und Film sowie die spezifischen Möglichkeiten und Grenzen beider Medien.
Schlüsselwörter
„Schlafes Bruder“, Robert Schneider, Joseph Vilsmaier, Literaturverfilmung, Intermedialität, Sprache, Leitmotive, Romananalyse, Filmanalyse, Genotext, Umsetzung, Intertextualität.
- Quote paper
- Christian Brune (Author), 2004, Er sah das Tönen. Schlafes Bruder - Text und Film, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48199