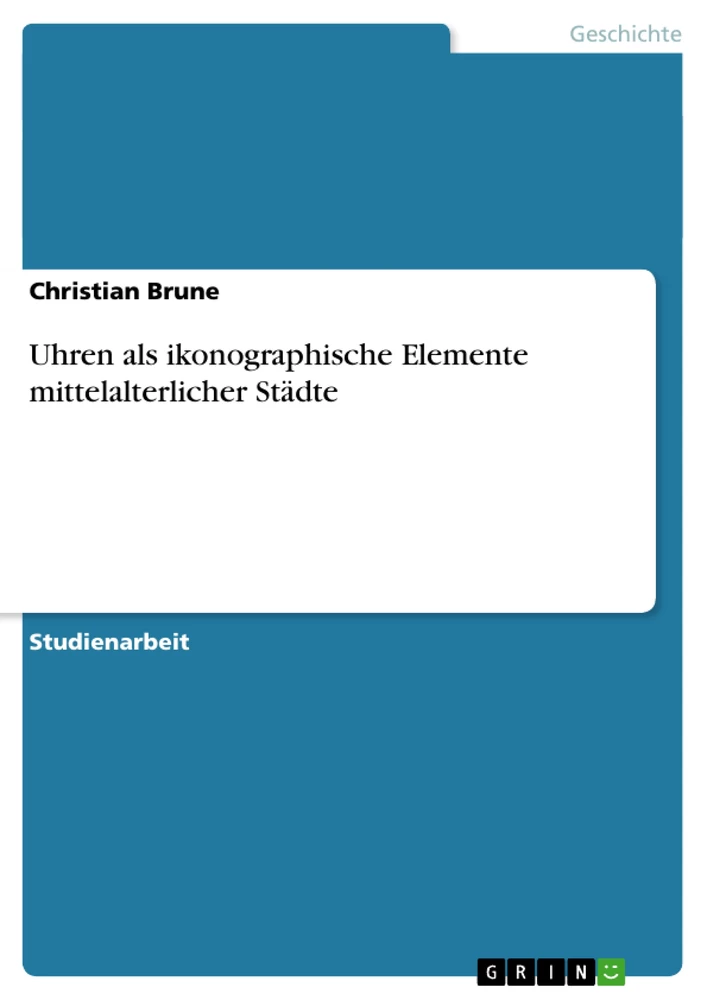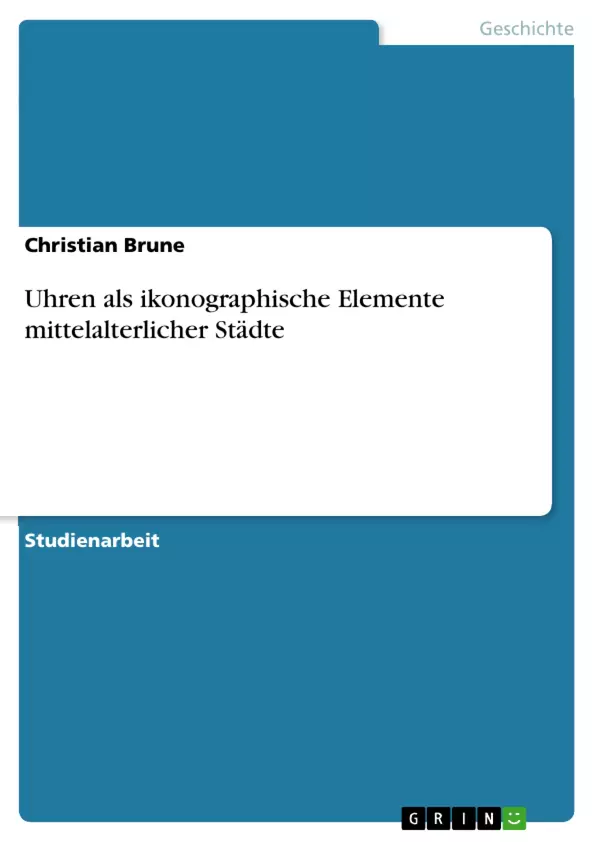In der vorliegenden Arbeit soll es um die Geschichte und die Hintergründe der Einführung von Glocken und - in erster Linie -Uhren in den Städten und Gemeinden des Mittelalters gehen. Ein besonderer Augenmerk soll dabei nicht etwa (wie der Titel evtl. nahelegen könnte) auf den kunsthistorischen Aspekt gelegt werden, sondern vielmehr auf die Veränderung des Stadtbildes im allgemeinen Sinne, also in der Alltagsgeschichte der Menschen.
Wer hatte ein Bedürfnis nach öffentlich gemessener und angezeigter Zeit? Wer waren Förderer von Uhren? Wie stand die Kirche zur Einführung dieser neuen Technologie? Wie veränderte sich der Ablauf des alltäglichen Stadtlebens durch die Uhr? Welche Bedeutung maß der normale Stadtmensch der Uhr bei? Welche Entwicklungen kann man beobachten?
All diese Fragen werden in der Arbeit im Blickpunkt des Interesses stehen. Anhand der wenigen vorliegenden Quellen werde ich versuchen, ein stimmiges Bild zu zeichnen von der Situation, wie sie sich in den mittelalterlichen Städten vor allem im 14. Jahrhundert darstellte.
Abschließend soll kein „Endergebnis“ stehen, sondern ein klareres Verständnis dafür aufgekommen sein, was die Einführung von Uhren und damit von exakt bestimmter Zeit bewirkt haben könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Ikonographische Elemente mittelalterlicher Städte
- Begriffsklärung „ikonographische Elemente“
- Ausstattung der mittelalterlichen Städte
- Öffentliche Uhren und Glocken
- Die ersten öffentlichen Uhren – ein historisch-geographischer Überblick
- Uhren im Alltag
- Zeitempfinden im Mittelalter
- Die Ablösung der Glocke durch die Uhr
- Der praktische Nutzen des Glockenschlags
- Die Bedeutung der Uhren für den Alltag der Menschen
- Erklärungsansätze für den „Uhrenboom“ des 14. Jahrhunderts
- Demographische Überlegungen
- Städtealltag im Wandel
- Die Kirche – Förderer oder Gegner öffentlicher Uhren?
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Geschichte und den Hintergründen der Einführung von Glocken und Uhren in den Städten des Mittelalters. Der Fokus liegt dabei auf der Veränderung des Stadtbildes im Sinne der Alltagsgeschichte und der Bedeutung von Uhren für die Menschen.
- Die Veränderung des Stadtbildes im Mittelalter durch die Einführung von Uhren
- Die Bedeutung von Uhren für den Alltag der Menschen im Mittelalter
- Die Rolle der Kirche bei der Einführung von Uhren
- Die verschiedenen Bedeutungen von Uhren als „ikonographische Elemente“
- Der „Uhrenboom“ des 14. Jahrhunderts und seine Ursachen
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Vorwort stellt die Forschungsfrage nach der Bedeutung von Uhren für das Stadtbild und den Alltag der Menschen im Mittelalter vor.
- Das Kapitel „Ikonographische Elemente mittelalterlicher Städte“ definiert den Begriff „ikonographische Elemente“ und beschreibt die Ausstattung mittelalterlicher Städte.
- Das Kapitel „Öffentliche Uhren und Glocken“ behandelt die Bedeutung öffentlicher Uhren und Glocken im Mittelalter.
- Das Kapitel „Die ersten öffentlichen Uhren – ein historisch-geographischer Überblick“ gibt einen Überblick über die ersten öffentlichen Uhren.
- Das Kapitel „Uhren im Alltag“ untersucht die Bedeutung von Uhren für das Zeitempfinden im Mittelalter, die Ablösung der Glocke durch die Uhr, den praktischen Nutzen des Glockenschlags und die Bedeutung von Uhren für den Alltag der Menschen.
- Das Kapitel „Erklärungsansätze für den „Uhrenboom“ des 14. Jahrhunderts“ untersucht die Ursachen für den „Uhrenboom“ des 14. Jahrhunderts.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Zeitmessung und dem Zeitverständnis im Mittelalter, insbesondere im Kontext der Einführung von Uhren in Städten. Die zentralen Schlüsselwörter sind: Ikonographie, mittelalterliche Städte, öffentliche Uhren, Glocken, Zeitverständnis, Alltagsgeschichte, Stadtbild, „Uhrenboom“, Demographie, Kirche.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurden im Mittelalter öffentliche Uhren eingeführt?
Die Einführung entsprang dem wachsenden Bedürfnis nach einer präzisen, öffentlich messbaren Zeit für Handel, Arbeit und das städtische Zusammenleben.
Wie veränderte die Uhr den Alltag in den Städten?
Die Uhr löste die ungenauere Glocke ab und ermöglichte eine exakte zeitliche Taktung des Alltags, was das Zeitempfinden der Menschen nachhaltig veränderte.
Was versteht man unter dem "Uhrenboom" des 14. Jahrhunderts?
Im 14. Jahrhundert verbreiteten sich mechanische Uhren rasant in europäischen Städten, getrieben durch demografische Veränderungen und den Wandel des städtischen Alltags.
Wie stand die Kirche zur Einführung der mechanischen Uhr?
Die Arbeit untersucht, ob die Kirche die neue Technologie eher förderte (z.B. für Gebetszeiten) oder ihr skeptisch gegenüberstand, da sie die Deutungshoheit über die Zeit verlor.
Was sind "ikonographische Elemente" einer Stadt?
Das sind prägende bauliche Symbole wie Türme, Glocken oder eben Uhren, die das Gesicht einer Stadt prägen und soziale sowie technologische Bedeutungen transportieren.
- Arbeit zitieren
- Christian Brune (Autor:in), 2002, Uhren als ikonographische Elemente mittelalterlicher Städte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48200