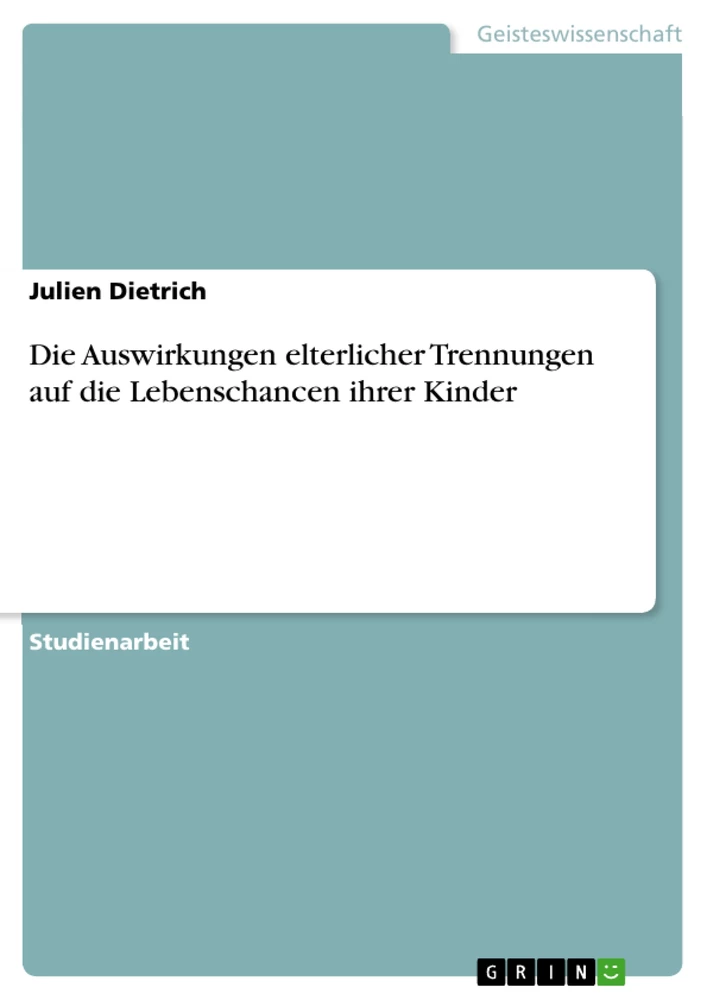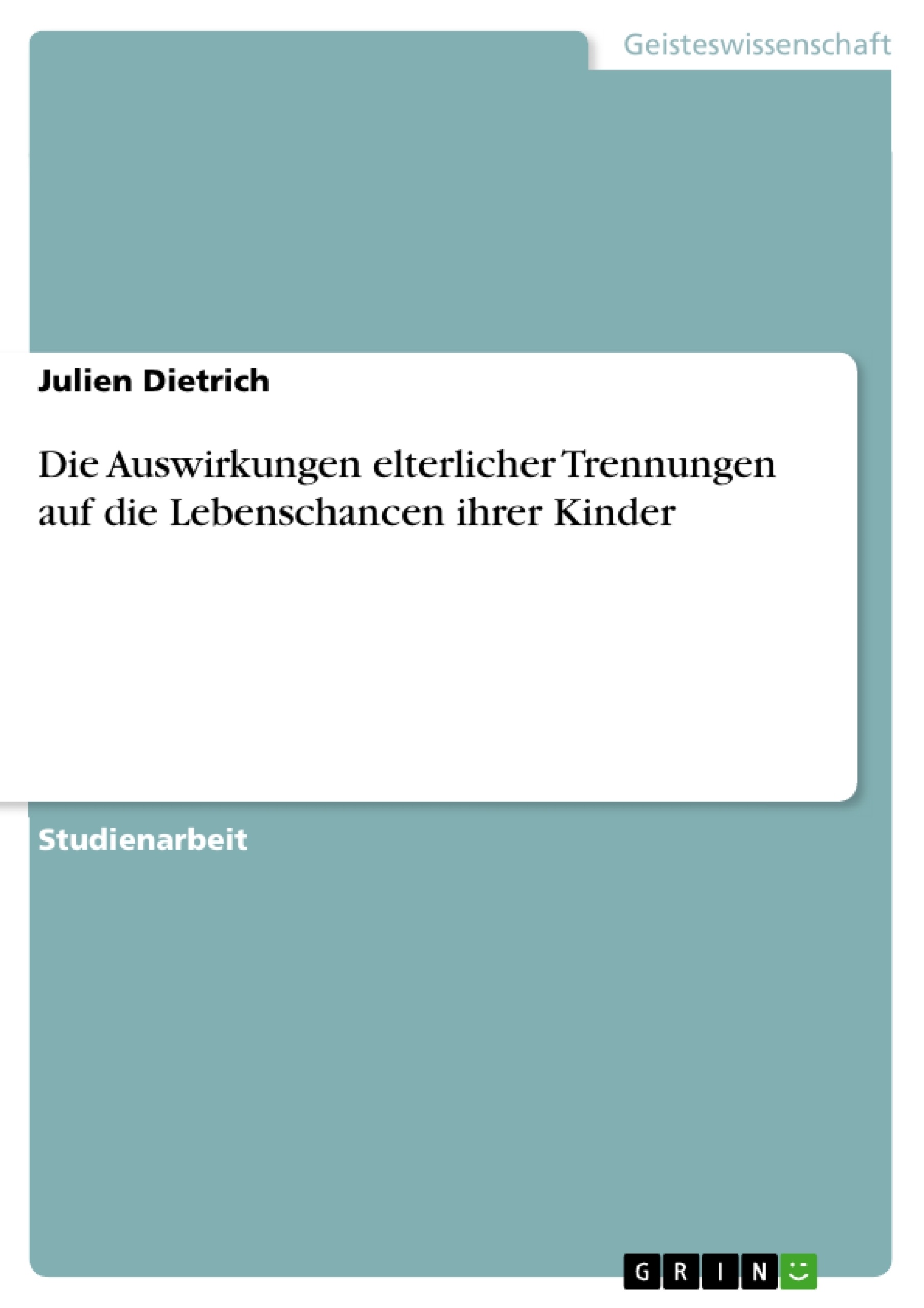In dieser Arbeit wird der Blick auf die Folgen elterlicher Scheidungen für die betroffenen Kinder gerichtet und untersucht, inwiefern diese die späteren Lebensphasen der Kinder beeinflussen. Die Fragestellung dieser Arbeit lautet dabei wie folgt: Wirken sich elterliche Trennungen negativ auf die Lebens- und Bildungschancen ihrer Kinder aus?
In den Sozialwissenschaften herrscht bis heute im Hinblick auf die Bedeutung der Ehe und Familie in Deutschland eine kontroverse Diskussion. Während es Befürworter gibt, die einem Bedeutungsverlust der Familie zustimmen und auf die zunehmenden Scheidungszahlen verweisen, bekräftigen andere die Beständigkeit der Familie. Jedoch zeigt die Scheidungsentwicklung, dass die Anzahl der Eheschließungen zurückgegangen ist und zugleich nichteheliche Lebensgemeinschaft zugenommen haben. Es kam somit zu einer Pluralisierung von Lebensformen, die für die betroffenen Kinder eine mehr oder weniger günstige Ausgangslage bilden. Die Formulierung ‚Lotterie der Geburt‘ bringt es auf den Punkt, da die sozial-ökonomische Ausgangslage von Eltern einen wesentlichen Einfluss auf die späteren Lebens- und Bildungschancen der Kinder bilden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Die Entwicklung der Scheidungsrate in Deutschland ..
- 3. Handlungstheoretische Theorien der Ehestabilität...
- 3.1 Austauschtheorie
- 3.2 Mikroökonomische Theorie .
- 3.3 Bindungstheorie...
- 4. Die Bedeutung der Transmissionshypothese bei Ehescheidungen.
- 4.1 Stresstheoretische Perspektive..
- 4.2 Sozialisationshypothese
- 4.3 Hypothese ökonomischer Deprivation
- 5. Geschlechtsspezifische Unterschiede beim Transmissionseffekt.
- 6. Die Herausforderung Alleinerziehender im Kontext sozialer Ungleichheiten ......
- 7. Schlussbemerkung....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Auswirkungen elterlicher Trennungen auf die Lebenschancen ihrer Kinder. Sie untersucht, inwiefern Scheidungen die späteren Lebensphasen von Kindern beeinflussen und ob elterliche Trennungen einen negativen Einfluss auf die Lebens- und Bildungschancen der Kinder haben.
- Entwicklung der Scheidungsrate in Deutschland
- Handlungstheoretische Theorien der Ehestabilität
- Bedeutung der Transmissionshypothese bei Ehescheidungen
- Geschlechtsspezifische Unterschiede beim Transmissionseffekt
- Herausforderungen Alleinerziehender im Kontext sozialer Ungleichheiten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung diskutiert die kontroverse Debatte in den Sozialwissenschaften über die Bedeutung von Ehe und Familie in Deutschland. Sie stellt die steigende Scheidungsrate und die Pluralisierung von Lebensformen dar und führt die zentrale Fragestellung der Arbeit ein: Wirken sich elterliche Trennungen negativ auf die Lebens- und Bildungschancen ihrer Kinder aus?
2. Die Entwicklung der Scheidungsrate in Deutschland
Dieses Kapitel beleuchtet den Anstieg der Scheidungszahlen in Deutschland seit den 1960er Jahren und erklärt diesen Trend durch verschiedene Faktoren wie die zunehmende Fragilität der Ehe, die individuelle Bereitschaft zur Scheidung, die Modernisierung des Zusammenlebens und den neuen Stellenwert von Beziehungen. Es führt auch die Transmissionshypothese ein, die die Vererbung des Scheidungsrisikos von Eltern auf ihre Kinder beschreibt.
3. Handlungstheoretische Theorien der Ehestabilität
Dieses Kapitel stellt die Austauschtheorie und die mikroökonomische Theorie als zwei wichtige Ansätze zur Erklärung der Beständigkeit und Fragilität von Partnerschaften vor. Beide Ansätze basieren auf dem Methodologischen Individualismus und dem Menschenbild des Homo oeconomicus.
4. Die Bedeutung der Transmissionshypothese bei Ehescheidungen.
Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Transmissionshypothese bei der Scheidungsentwicklung und beleuchtet, ob es in Deutschland eine Vererbung des Scheidungsrisikos gibt. Es beschreibt drei Ansätze zur Transmissionshypothese - die Stresstheoretische Perspektive, die Sozialisationshypothese und die Hypothese ökonomischer Deprivation - und erklärt deren unterschiedliche Ursachen für ein erhöhtes Scheidungsrisiko.
5. Geschlechtsspezifische Unterschiede beim Transmissionseffekt.
Dieses Kapitel beleuchtet, ob der Transmissionseffekt je nach Geschlecht unterschiedlich stark zur Geltung kommt. Es analysiert verschiedene Studien, die sich mit diesem Thema befassen.
6. Die Herausforderung Alleinerziehender im Kontext sozialer Ungleichheiten ......
Dieses Kapitel fokussiert auf die besondere Herausforderung Alleinerziehender, die durch die Scheidungstransmission verschärft wurde. Es untersucht die Auswirkungen elterlicher Trennungen auf die sozialen Ungleichheiten bei den betroffenen Kindern.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind die Entwicklung der Scheidungsrate in Deutschland, die Handlungstheoretischen Theorien der Ehestabilität, die Transmissionshypothese, die Auswirkungen elterlicher Trennungen auf die Lebenschancen ihrer Kinder, geschlechtsspezifische Unterschiede im Transmissionseffekt und die besondere Herausforderung Alleinerziehender im Kontext sozialer Ungleichheiten.
Häufig gestellte Fragen
Verschlechtern elterliche Trennungen die Bildungschancen von Kindern?
Die Arbeit untersucht, wie die sozio-ökonomische Lage nach einer Scheidung die Bildungsbiografien beeinflusst, was oft als „Lotterie der Geburt“ bezeichnet wird.
Was besagt die Transmissionshypothese bei Scheidungen?
Die Hypothese besagt, dass Kinder aus Scheidungsfamilien statistisch gesehen ein höheres Risiko haben, im Erwachsenenalter selbst eine instabile Partnerschaft oder Scheidung zu erleben.
Was ist die Hypothese der ökonomischen Deprivation?
Dieser Ansatz erklärt negative Folgen für Kinder primär durch den sinkenden Lebensstandard und den finanziellen Stress, der oft mit einer Trennung einhergeht.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede beim Transmissionseffekt?
Die Forschung untersucht, ob Söhne oder Töchter unterschiedlich auf die Trennung der Eltern reagieren und wie dies ihre späteren Beziehungsmuster prägt.
Welche Herausforderungen haben Alleinerziehende?
Alleinerziehende stehen oft vor der Herausforderung sozialer Ungleichheit, die sich direkt auf die sozialen und kulturellen Ressourcen der betroffenen Kinder auswirken kann.
- Quote paper
- Julien Dietrich (Author), 2017, Die Auswirkungen elterlicher Trennungen auf die Lebenschancen ihrer Kinder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/482128