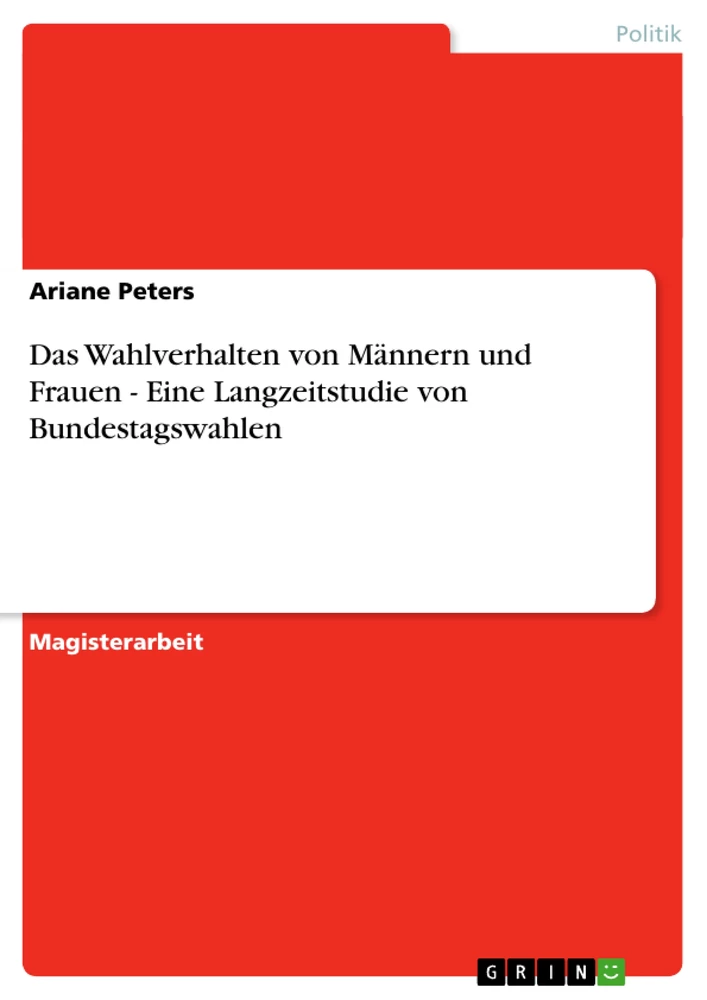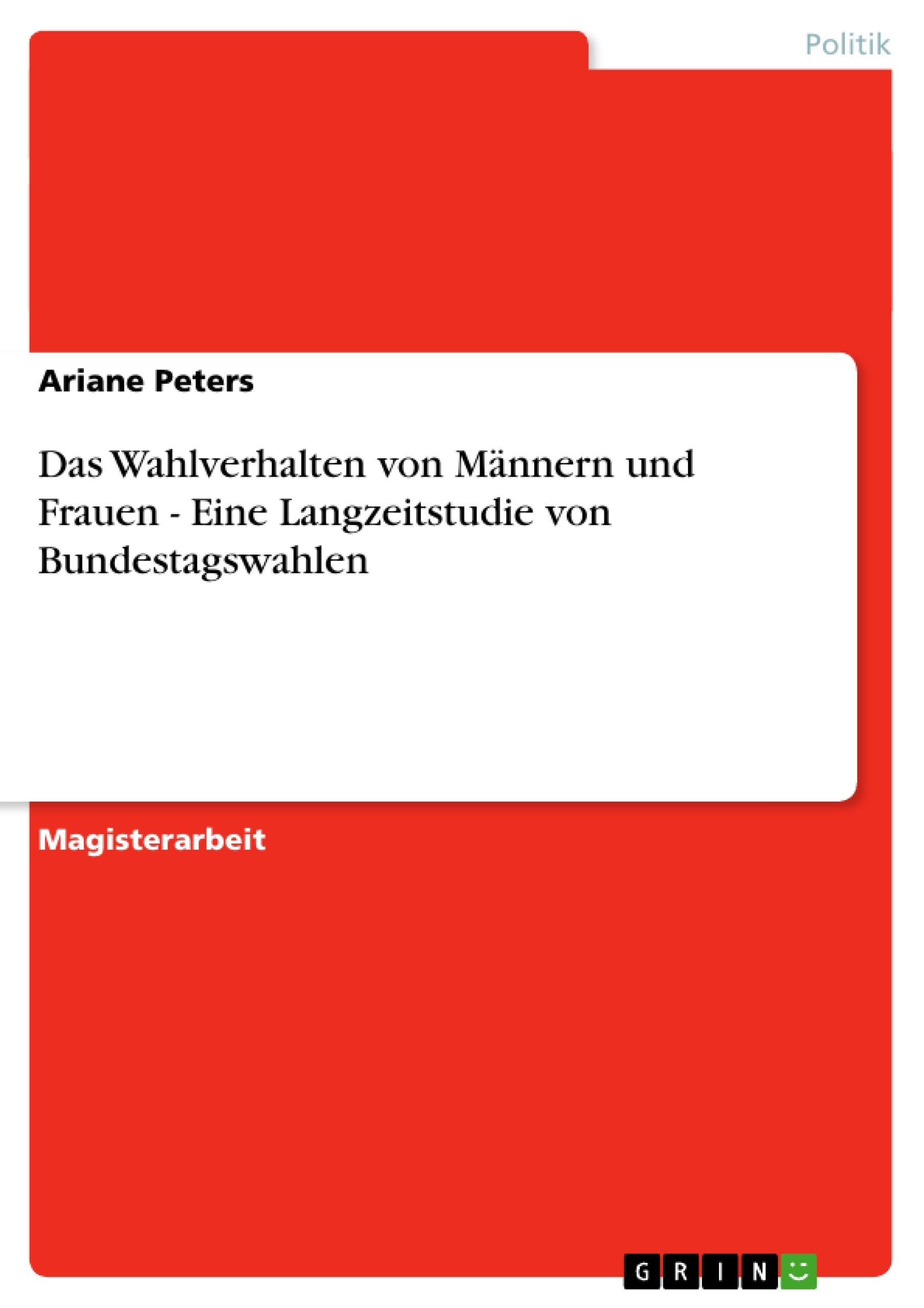Die politische Wahl stellt eine vergleichsweise wenig Engagement erfordernde Legitimation des politischen Systems seitens der Bevölkerung dar. Dennoch wächst der Anteil derjenigen Westeuropäer, die sich ihrer Wahlstimme enthalten. Der Anstieg des Nichtwähleranteils in Westeuropa bietet Anlass zu gezielten Untersuchungen und kritischen Fragen: Befindet sich Westeuropa in einem Stadium der Politikverdrossenheit? Nimmt das Vertrauen der Bürger in das demokratische System an sich ab? Welche Bedeutung wird politischen Institutionen wie dem Parlament in westeuropäischen Demokratien noch beigemessen? Ist die abnehmende Wahlbeteiligung Ausdruck einer allgemeinen Zufriedenheit mit der Funktionsweise des politischen Systems oder das Anzeichen für eine gestörte Beziehung zwischen Wählern und Gewählten?
Zur Beantwortung der vorliegenden Fragen werde ich in folgenden Schritten vorgehen: Im theoretischen Teil dieser Arbeit gilt es zunächst die Begriffe Politikverdrossenheit und Nichtwähler zu definieren. Anschließend werde ich die damit in Verbindung stehende Krisen- und Normalisierungsthese näher erläutern. Nach einer kurzen Analyse der Wahlbeteiligungsentwicklung in elf westeuropäischen Ländern, wird im empirischen Teil dieser Arbeit untersucht, ob Westeuropa sich in einem Stadium der Politikverdrossenheit befindet und welche “Objekte“ den Unmut der Bürger auf sich ziehen. Auf Grundlage des European Value Survey von 1999 werden dabei sowohl die Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede zwischen Wählern und Nichtwählern aufgezeigt. Mit den empirisch dargelegten Befunden zum Verhältnis von Demokratie und Nichtwahl, werde ich belegen, dass in Westeuropa von Demokratieverdrossenheit nichts zu verspüren ist und auch keine generelle Politikverdrossenheit vorherrscht, sondern der Unmut der Bürger sich in erster Linie auf Parteien und Politikern bezieht. Zum Ende dieser Arbeit wird es eine kurze Zusammenfassung geben, mit dem Ziel weitere Perspektiven für die zukünftige Forschung aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Theoretischer Teil
- 1. Das Michigan Modell
- 1.1. Die Bestandteile des Michigan-Modells
- 1.1.1. Die Parteibindung
- 1.1.2. Die Kandidatenorientierung
- 1.1.3. Die Issueorientierung
- 1.2. Die Zusammenhänge zwischen den drei Faktoren und der Wahlentscheidung
- 1.1. Die Bestandteile des Michigan-Modells
- 2. Die Anwendung des Michigan-Modells in der deutschen Wahlforschung
- 3. Fragestellung und Formulierung der Hypothesen
- 1. Das Michigan Modell
- III. Empirischer Teil
- 1. Datenbasis und Operationalisierung der Thesen
- 1.1. Datenbasis
- 1.2. Operationalisierung der Thesen
- 2. Historischer Überblick: Entwicklungen im Wahlverhalten von Frauen und Männern im Zeitraum von 1953-1987
- 2.1. Entwicklung der Wahlbeteiligung
- 2.2. Zweitstimmen nach Geschlecht und Partei (1953-1987)
- 2.3. Zusammenfassung
- 3. Entwicklung im Wahlverhalten von Männer und Frauen seit 1990
- 3.1. Wahlbeteiligung und Zweitstimmenvergabe nach Geschlecht
- 3.1.1. Westdeutschland
- 3.1.2. Ostdeutschland
- 3.1.3. Zusammenfassung
- 3.2. Die Existenz und Intensität der Parteibindung
- 3.2.1. Westdeutschland
- 3.2.2. Ostdeutschland
- 3.3. Zusammenhang zwischen Parteibindung und Parteiwahl
- 3.3.1. Westdeutschland
- 3.3.2. Ostdeutschland
- 3.3.3. Zusammenfassung
- 3.4. Beurteilung der Kanzlerkandidaten
- 3.4.1. Westdeutschland
- 3.4.2. Ostdeutschland
- 3.5. Sachthemen und die Problemlösungskompetenz der Parteien
- 3.5.1. Sachthemen
- 3.5.2. Problemlösungskompetenz der Parteien
- 3.5.3. Zusammenfassung
- 4. Der Einfluss der Parteibindung, Kandidaten- und Issueorientierung auf die Wahlentscheidung
- 4.1. Bundestagswahl 1990
- 4.1.1. Westdeutschland
- 4.1.2. Ostdeutschland
- 4.1.3. Die Zusammenhänge zwischen Wahlentscheidung, Kandidaten- und Issueorientierung bei Kontrolle der Parteibindung
- 4.2. Bundestagswahl 1994
- 4.2.1. Westdeutschland
- 4.2.2. Ostdeutschland
- 4.2.3. Die Zusammenhänge zwischen Wahlentscheidung, Kandidaten- und Issueorientierung bei Kontrolle der Parteibindung
- 4.3. Bundestagswahl 1998
- 4.3.1. Westdeutschland
- 4.3.2. Ostdeutschland
- 4.3.3. Die Zusammenhänge zwischen Wahlentscheidung, Kandidaten- und Issueorientierung bei Kontrolle der Parteibindung
- 4.4. Bundestagswahl 2002
- 4.4.1. Westdeutschland
- 4.4.2. Ostdeutschland
- 4.4.3. Die Zusammenhänge zwischen Wahlentscheidung, Kandidaten- und Issueorientierung bei Kontrolle der Parteibindung
- 4.5. Zusammenfassung
- 4.1. Bundestagswahl 1990
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Wahlverhalten von Männern und Frauen in Deutschland auf Basis des Michigan-Modells. Die Analyse umfasst Langzeitdaten von Bundestagswahlen und fokussiert auf die Veränderungen im Wahlverhalten im Kontext der deutschen Wiedervereinigung. Das Ziel ist es, die Faktoren, die die Wahlentscheidung von Männern und Frauen beeinflussen, zu identifizieren und Unterschiede im Wahlverhalten zwischen den Geschlechtern zu beleuchten.
- Das Michigan-Modell als theoretischer Rahmen für die Analyse des Wahlverhaltens
- Entwicklungen im Wahlverhalten von Männern und Frauen seit 1953
- Der Einfluss von Parteibindung, Kandidatenorientierung und Issueorientierung auf die Wahlentscheidung
- Geschlechtsspezifische Unterschiede im Wahlverhalten in West- und Ostdeutschland
- Die Rolle der deutschen Wiedervereinigung im Kontext des Wahlverhaltens von Frauen und Männern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Fragestellung der Arbeit ein und erläutert die Relevanz des Themas. Der theoretische Teil stellt das Michigan-Modell vor, das die wichtigsten Determinanten von Wahlentscheidungen beschreibt. Im empirischen Teil werden die Datenbasis und die Operationalisierung der verwendeten Konzepte vorgestellt. Es erfolgt eine Analyse der Entwicklung des Wahlverhaltens von Frauen und Männern im Zeitraum von 1953 bis 1987 und seit 1990. Der Einfluss von Parteibindung, Kandidatenorientierung und Issueorientierung auf die Wahlentscheidung wird anhand von Daten verschiedener Bundestagswahlen untersucht. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf geschlechtsspezifische Unterschiede gelegt.
Schlüsselwörter
Wahlverhalten, Michigan-Modell, Parteibindung, Kandidatenorientierung, Issueorientierung, Geschlecht, Bundestagswahlen, Wiedervereinigung, Westdeutschland, Ostdeutschland, Langzeitstudie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Michigan-Modell in der Wahlforschung?
Es ist ein theoretischer Rahmen, der die Wahlentscheidung durch drei Faktoren erklärt: Parteibindung, Kandidatenorientierung und Issueorientierung (Sachthemen).
Gibt es signifikante Unterschiede im Wahlverhalten von Männern und Frauen?
Die Langzeitstudie zeigt Unterschiede in der Wahlbeteiligung und der Parteienpräferenz, die sich über die Jahrzehnte jedoch teilweise angeglichen haben.
Wie beeinflusste die Wiedervereinigung das Wahlverhalten?
Die Studie untersucht getrennt West- und Ostdeutschland, da sich die Parteibindungen und politischen Prioritäten in den neuen Bundesländern anders entwickelten.
Was versteht man unter Politikverdrossenheit?
Der Begriff beschreibt den Unmut der Bürger gegenüber Parteien und Politikern, ohne notwendigerweise das demokratische System als Ganzes abzulehnen.
Welche Rolle spielt die Sachthemenorientierung (Issueorientierung)?
Sie beschreibt, wie stark sich Wähler bei ihrer Entscheidung von aktuellen politischen Problemen und der Problemlösungskompetenz der Parteien leiten lassen.
- 3.1. Wahlbeteiligung und Zweitstimmenvergabe nach Geschlecht
- 1. Datenbasis und Operationalisierung der Thesen
- Quote paper
- Ariane Peters (Author), 2005, Das Wahlverhalten von Männern und Frauen - Eine Langzeitstudie von Bundestagswahlen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48259