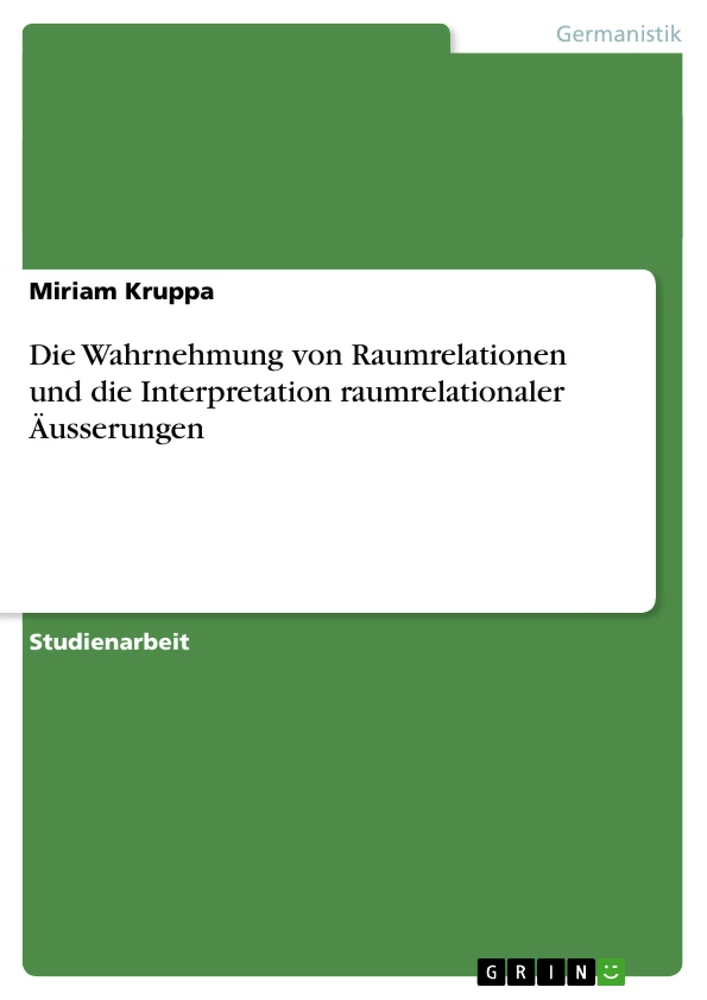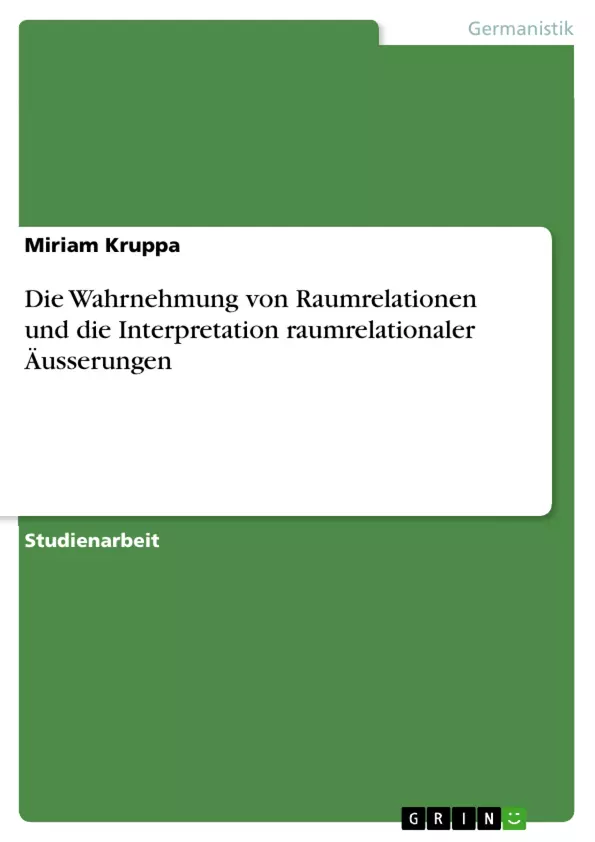Einleitung
Wenn man die Gegenstände in Abb.1 betrachtet und die räumlichen Relationen der Objekte Auto und Ball aus der Betrachterperspektive (Strichmännchen) mit den Präpositionen vor/hinter bestimmten sollte, so gibt es dafür verschiedene Möglichkeiten. Der Betrachter kann sagen:
a) Der Ball ist vor dem Auto.
Das bedeutet, dass der Ball sich zwischen ihm und dem Auto befindet. Er nimmt die Relationen von Ball und Auto aus seiner eigenen, egozentrischen bzw. deiktischen Perspektive wahr.
Der Betrachter kann aber auch sagen:
b) Der Ball ist hinter dem Auto.
Damit schreibt der Betrachter dem Auto eine objekteigene Rückseite zu, an deren horizontalen Verlängerung sich der Ball befindet, eben an der Rückseite des Objekts. Er betrachtet die Relation des Balls zum Auto aus der Perspektive des Autos. Aus der Betrachterperspektive (Strichmännchen) kann der Ball sowohl vor dem Auto (egozentrische Perspektive) oder hinter dem Auto liegen (kanonische Perspektive). Das Beispiel zeigt, dass Situationen existieren, in denen die selben Raumrelationen von Objekten einmal mit Objekt a steht vor b und genauso gut mit Objekt a steht hinter b angezeigt werden können. Probleme in Kommunikationssituationen gibt es dann, wenn der Sprecher eine Perspektive annimmt bzw. sprachlich ausdrückt, die der Hörer anders interpretiert. Man sollte davon ausgehen, dass Sprache so angelegt ist, dass solche Missverständnisse erst gar nicht auftreten. Die folgende Arbeit soll aufzeigen, dass das nicht der Fall ist. Vielmehr ist es so, dass Kommunikationsteilnehmern oft nicht bewusst ist, dass überhaupt verschiedene Perspektivmöglichkeiten existieren, die in Konflikt miteinander geraten können; dieser Konflikt wird oft nicht sprachlich markiert. Versuche von Joachim Grabowski haben dieses Problem behandelt; eine Auswahl dieser Versuche werde ich im dritten Kapitel erläutern.
Um das Problem der unterschiedlichen Auffassung von Raumrelationen beschreiben zu können, ist zunächst ein Überblick über die Determinanten der menschlichen Raumauffassung sinnvoll. Worin bestehen diese Determinanten? Wir beschreiben Raumrelationen immer, in dem wir zwei Objekte zueinander in Relation setzten. Der Ball liegt vor dem Auto, der Baum steht hinter dem Haus.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- PRINZIPIEN DER RAUMAUFFASSUNG
- FAKTOREN DER RELATUM-WAHL
- AUFFASSUNG RÄUMLICHER RELATIONEN
- ORIGO-INSTANZIERUNG
- DAS INTRINSISCHE BEZUGSSYSTEM
- DAS EXTRINSISCHE BEZUGSSYSTEM
- DAS DEIKTISCHE BEZUGSSYSTEM
- ORIGO-INSTANZIERUNG IM KONFLIKTFALL
- ORIGO-WAHL UND SPRACHLICHER AUSDRUCK
- MARKIERUNG DER ORIGO-WAHL
- INTERPRETATION VON RAUMRELATIONEN
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der menschlichen Raumwahrnehmung und dem sprachlichen Ausdruck räumlicher Relationen. Sie untersucht, wie wir Objekte im Raum zueinander in Beziehung setzen, welche Faktoren bei der Wahl eines Referenzobjekts (Relatum) eine Rolle spielen und wie die verschiedenen Perspektiven, die wir einnehmen können, in Sprache ausgedrückt werden.
- Determinanten der menschlichen Raumauffassung
- Faktoren der Relatum-Wahl
- Verschiedene Bezugssysteme für die Beschreibung von Raumrelationen
- Sprachlicher Ausdruck von Raumrelationen durch Präpositionen
- Interpretation von Raumrelationen durch den Hörer
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Problem der unterschiedlichen Auffassung von Raumrelationen anhand eines Beispiels vor und erläutert die Notwendigkeit, die verschiedenen Perspektivmöglichkeiten zu untersuchen.
- Kapitel 1: Prinzipien der Raumauffassung: Dieses Kapitel untersucht die Faktoren, die bei der Wahl eines Referenzobjekts (Relatum) für die Beschreibung von Raumrelationen eine Rolle spielen. Es werden die Kriterien von Grabowski und Talmy vorgestellt, die sich auf die Beweglichkeit, Größe und geometrische Komplexität von Objekten beziehen.
- Kapitel 2: Origo-Instanzierung: In diesem Kapitel werden die verschiedenen Bezugssysteme für die Beschreibung von Raumrelationen vorgestellt, die von der Beschaffenheit der Objekte und der Perspektive des Betrachters abhängen.
- Kapitel 3: Origo-Wahl und sprachlicher Ausdruck: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, wie die Wahl der Perspektive (egozentrisch/kanonisch) in der Kommunikationssituation beeinflusst wird und wie sie sprachlich ausgedrückt wird.
Schlüsselwörter
Raumwahrnehmung, Raumrelationen, Relatum, Bezugssystem, Origo, egozentrische Perspektive, kanonische Perspektive, Präpositionen, Sprachlicher Ausdruck, Interpretation, Kommunikationssituation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen egozentrischer und deiktischer Perspektive?
Bei der egozentrischen Perspektive beschreibt der Sprecher die Lage eines Objekts aus seiner eigenen Sicht (z.B. „vor mir“), während die deiktische Perspektive den Betrachterstandpunkt einbezieht.
Was versteht man unter einem „Relatum“ in der Raumwahrnehmung?
Das Relatum ist das Referenzobjekt, zu dem ein anderes Objekt in Beziehung gesetzt wird (z.B. das Auto im Satz „Der Ball liegt vor dem Auto“).
Warum kommt es bei Raumangaben oft zu Missverständnissen?
Missverständnisse entstehen, wenn Sprecher und Hörer unterschiedliche Bezugssysteme (z.B. Objektperspektive vs. Betrachterperspektive) verwenden, ohne dies sprachlich zu markieren.
Welche Rolle spielt die Origo-Instanzierung?
Die Origo ist der Nullpunkt des Koordinatensystems, von dem aus Raumrelationen definiert werden. Ihre Wahl entscheidet über die Interpretation von Begriffen wie „vor“ oder „hinter“.
Welche Faktoren beeinflussen die Wahl eines Referenzobjekts?
Faktoren wie Größe, Unbeweglichkeit und geometrische Einfachheit eines Objekts machen es zu einem bevorzugten Relatum für die Raumbeschreibung.
- Citation du texte
- Miriam Kruppa (Auteur), 2002, Die Wahrnehmung von Raumrelationen und die Interpretation raumrelationaler Äusserungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4831