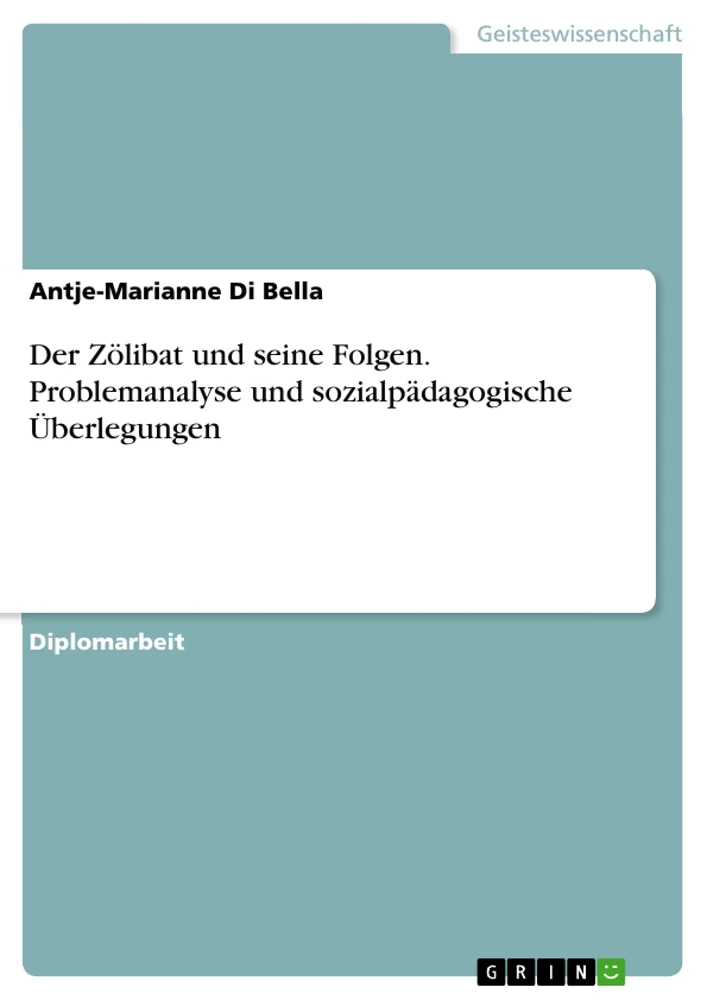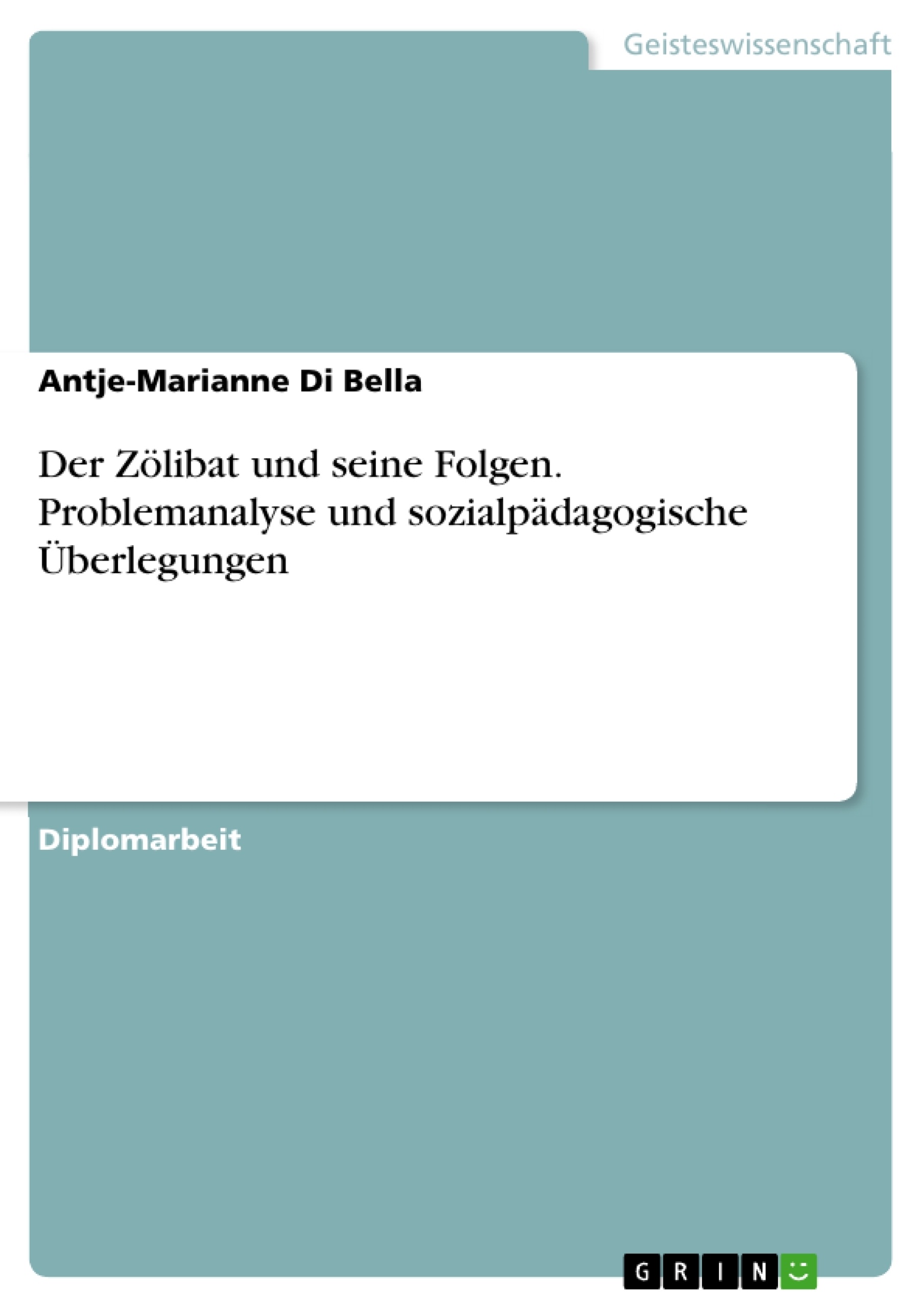"Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil haben rund 100.000 Priester ihr Amt aufgegeben. Allein in Deutschland dürften es schätzungsweise 10000 sein. Offizielle Zahlen liegen nicht vor. Der Rückgang der Priesteramtskandidaten, bei erheblichem Zuwachs von Laientheologen und die erschreckende Zahl von Priestern, die ihre Laiisierung und Dispens vom Zölibat beantragt haben, hängen zweifellos mit der Zölibatsverpflichtung der katholischen Priester zusammen. Andererseits ist die Tatsache, dass durch die Abschaffung des priesterlichen Zölibats der katholischen Kirche etwas Unersetzliches verloren ginge, eine Mahnung zu sehr behutsamen Überlegungen.
"Die katholische Kirche soll also entweder den Zölibat aufgeben oder in Anbetracht der erschreckenden hohen Zahlen von Laisierungsgesuchen, eine wesentlich tragfähigere Grundlage für die Entscheidung zum Zölibat und für ein zeugnishaftes Leben schaffen." (Aussage von Weihbischof Josef Maria Reuß + 1985)
Diese Forderung scheint ungehört verhallt.
Mit der vorliegenden Publikation habe ich mich bemüht, den Wandel von der jesuanischen Freiwilligkeit ehelosen Lebens in die rechtliche Form des gesetzlich aufoktroyierten Zwangszölibates aufzuzeigen. Der historische Wandel zur kirchenrechtlichen Zementierung wird dargelegt.
Wenn die Liebe in ein Priesterleben 'einbricht', steht 'Mutter Kirche' nicht als Helferin bereit, sondern eine Schar von Psychologen und Psychotherapeuten. Anträge auf Laiisierung bleiben unbearbeitet liegen. Priester unter 40 Jahren haben durchweg keine Chance, 'erhört' zu werden.
Die katholische Kirche pflegt ihre Doppelmoral.
Priester, die sich aufrichtig zu ihren Frauen (und Kindern) bekennen, fliegen aus dem Amt. Jedoch der prominente Religionswissenschaftler und katholische Priester Raimon Panikkar durfte mit offizieller Genehmigung des Vatikans heiraten, ohne sein Priesteramt aufgeben zu müssen. Diese Logik verstehe, wer will.
Die empirischen Untersuchungen in meiner Arbeit zeigen verheerende Auswirkungen des zwangsverordneten Zölibates."
(Vgl. Bernd Marz in Antje Di Bella: Die Priesterkirche, das Zölibatsgesetz und Jesu Nachfolge- Eine Provokation-, Publik-Forum-Verlag, Oberursel, 1998, S. 4.)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Problemerhebung
- ERSTER TEIL: THEOLOGISCHER TEIL
- I. Darstellung der geschichtlichen, ideellen und theologischen Hintergründe des Zölibats, Darstellung und Hinterfragung des katholischen Kirchenrechts in bezug auf die Zölibatsgesetzgebung, Zusammenfassung und Analyse
- 1. Definition des Zölibats
- 2. Der Konzilstext
- 3. Die Geschichte des Zölibats
- 3.1. Die Entstehung des Klerus
- 3.2. Das Mittelalter
- 3.3. Die Reformationszeit
- 3.4. Die Neuzeit
- 3.5. Die heutige Zeit
- 3.5.1. Die Spaltung zwischen Klerus und Laien
- 3.5.2. Die jüngsten Ereignisse in Pressemeldungen
- 4. Zölibat und Recht
- 4.1. Das katholische Kirchengesetz
- 4.2. Die wichtigsten für den Zölibat relevanten Gesetze des Codex Iuris Canonici von 1983
- 4.2.1. Das Konkubinat
- 4.2.2. Dispens
- 4.2.3. Unterhaltsanspruch
- 4.2.4. Nothilfe
- 4.3. Aspekte der Fortentwicklung bzw. der Veränderung
- 5. Theologische Analyse: Theorien kirchengeschichtlicher Hintergründe des katholischen Glaubensgefüges mit Folgerung auf den Zölibat
- 5.1. Vom Verständnis der Heiligkeit und Reinheit
- 5.2. Die kirchengeschichtlichen Hintergründe des früh- und altkatholischen Glaubensgefüges
- 5.3. Geschichtliche Zusammenfassung; abschließende theologische Erkenntnisse bzgl. des Priesteramtes und der möglichen Aufhebung des Pflichtzölibats
- II. Aktuelle Ansichten und theologische Erklärungen über den Zölibat
- 1. Glaube in unserer Zeit
- 2. Die heute am häufigsten angewandten theologischen Argumente
- III. Der Zölibat aus der Sicht anderer Wissenschaften
- 1. Zölibat und theologische Ethik
- 2. Der Zölibat in den Humanwissenschaften
- 3. Der Zölibat in der Sozialwissenschaft
- ZWEITER TEIL: PROBLEMANALYTISCHER TEIL
- I. Problemdarstellung und Analyse bezüglich der Priester
- II. Problemdarstellung und Analyse der mit Priestern liierten Frauen
- III. Empirische Forschungsergebnisse über die Thematik
- DRITTER TEIL: SOZIALPÄDAGOGISCHER TEIL
- I. Sozialpädagogische Überlegungen, Darstellung der Hilfsinitiativen und deren Tätigkeiten und Ziele, Aufzeigen weiterer Möglichkeiten und Erstellung eines Konzeptes
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zölibat in der katholischen Kirche aus theologischer, problem-analytischer und sozialpädagogischer Perspektive. Ziel ist es, die geschichtlichen, theologischen und gesellschaftlichen Hintergründe des Zölibats zu beleuchten und die damit verbundenen Probleme für Priester und betroffene Frauen zu analysieren. Darüber hinaus werden mögliche Lösungsansätze und Hilfestellungen aufgezeigt.
- Geschichtliche Entwicklung des Zölibats
- Theologische Begründung und Kritik des Zölibats
- Probleme des Zölibats für Priester
- Auswirkungen des Zölibats auf Frauen
- Sozialpädagogische Hilfsmöglichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Problemerhebung: Die Einleitung skizziert die Problematik des Zölibats in der katholischen Kirche und benennt die Forschungsfragen der Arbeit. Sie legt den Fokus auf die Auswirkungen des Zölibats auf Priester und die mit ihnen liierten Frauen, sowie auf die Notwendigkeit sozialpädagogischer Interventionen.
I. Darstellung der geschichtlichen, ideellen und theologischen Hintergründe des Zölibats, Darstellung und Hinterfragung des katholischen Kirchenrechts in bezug auf die Zölibatsgesetzgebung, Zusammenfassung und Analyse: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung der Geschichte des Zölibats, beginnend mit der Entstehung des Klerus bis zur heutigen Zeit. Es analysiert den Konzilstext, das katholische Kirchenrecht und die relevanten Gesetze des Codex Iuris Canonici, um die theologischen und rechtlichen Grundlagen des Zölibats zu beleuchten. Besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung des Verständnisses von Heiligkeit und Reinheit im Kontext des Zölibats und der daraus resultierenden Herausforderungen.
II. Aktuelle Ansichten und theologische Erklärungen über den Zölibat: Dieses Kapitel untersucht die gegenwärtigen theologischen Argumente für und gegen den Zölibat. Es analysiert die häufigsten Argumente, die sowohl für die Beibehaltung als auch für die Aufhebung des Pflichtzölibats vorgebracht werden, und setzt diese in den Kontext des heutigen Glaubensverständnisses. Der Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit verschiedenen theologischen Perspektiven und ihrer jeweiligen Begründung.
III. Der Zölibat aus der Sicht anderer Wissenschaften: Dieses Kapitel erweitert die Perspektive auf den Zölibat, indem es ihn aus der Sicht der theologischen Ethik, der Psychologie und der Sozialwissenschaft beleuchtet. Es werden psychoanalytische, sozialpsychologische und sozialethologische Aspekte des Zölibats erörtert und in Beziehung zum Thema gesetzt. Es analysiert unter anderem die Auswirkungen von Enthaltsamkeit, Angst und sozialen Sanktionen auf die betroffenen Personen.
I. Problemdarstellung und Analyse bezüglich der Priester: Dieses Kapitel analysiert die Problematik des Zölibats aus der Perspektive der Priester. Es untersucht die Motive für die Berufswahl, die Diskrepanz zwischen Ideal und Wirklichkeit sowie die Herausforderungen, die durch Liebesbeziehungen entstehen. Anhand autobiografischer Berichte werden die individuellen Erfahrungen und Probleme der Priester detailliert dargestellt.
II. Problemdarstellung und Analyse der mit Priestern liierten Frauen: Dieser Abschnitt beleuchtet die Erfahrungen von Frauen, die mit Priestern liiert sind. Es werden verschiedene Arten von Beziehungen (heimliche, legitimierte etc.) und die damit verbundenen Probleme und Herausforderungen analysiert. Besonders die Situation der Kinder von Priestern wird thematisiert.
III. Empirische Forschungsergebnisse über die Thematik: Dieses Kapitel präsentiert empirische Forschungsergebnisse zum Thema Zölibat. Es werden Daten einer Studie der Deutschen Bischofskonferenz aus dem Jahr 1973 herangezogen, um die Auswirkungen des Zölibats auf die psychische Gesundheit von Priestern und die sozialen Konsequenzen aufzuzeigen. Die Ergebnisse werden im Kontext von neurotischer Idealbildung, Schuldgefühlen und sozialen Sanktionen interpretiert.
I. Sozialpädagogische Überlegungen, Darstellung der Hilfsinitiativen und deren Tätigkeiten und Ziele, Aufzeigen weiterer Möglichkeiten und Erstellung eines Konzeptes: Dieses Kapitel beschreibt sozialpädagogische Ansätze zur Unterstützung von Priestern und betroffenen Frauen. Es stellt bestehende Initiativen vor und entwickelt ein Konzept für ein Beratungsprojekt, das auf den individuellen Bedürfnissen der Betroffenen aufbaut. Der Fokus liegt auf der Förderung von Identitätsbildung und der Bewältigung der Herausforderungen, die durch den Zölibat entstehen.
Schlüsselwörter
Zölibat, Katholische Kirche, Priester, Frauen, Theologie, Kirchenrecht, Geschichte, Psychologie, Sozialwissenschaft, Sozialpädagogik, Identität, Beziehungen, Problematik, Hilfsangebote.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Zölibat in der Katholischen Kirche
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Zölibat in der katholischen Kirche aus theologischer, problem-analytischer und sozialpädagogischer Perspektive. Sie beleuchtet die geschichtlichen, theologischen und gesellschaftlichen Hintergründe des Zölibats und analysiert die damit verbundenen Probleme für Priester und betroffene Frauen. Darüber hinaus werden mögliche Lösungsansätze und Hilfestellungen aufgezeigt.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die geschichtliche Entwicklung des Zölibats, seine theologische Begründung und Kritik, die Probleme des Zölibats für Priester, die Auswirkungen auf Frauen, sowie sozialpädagogische Hilfsmöglichkeiten. Sie analysiert das katholische Kirchenrecht und relevante Gesetze des Codex Iuris Canonici und bezieht verschiedene wissenschaftliche Perspektiven (Theologische Ethik, Humanwissenschaften, Sozialwissenschaften) mit ein.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Ein theologischer Teil, der die geschichtlichen, ideellen und theologischen Hintergründe des Zölibats darstellt und analysiert; ein problem-analytischer Teil, der die Probleme für Priester und mit ihnen liierte Frauen beleuchtet und empirische Forschungsergebnisse einbezieht; und ein sozialpädagogischer Teil, der sozialpädagogische Überlegungen, Hilfsinitiativen und ein Konzept für ein Beratungsprojekt vorstellt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung mit Problemerhebung, drei Hauptteile (Theologischer, Problem-analytischer, Sozialpädagogischer Teil) mit jeweils mehreren Unterkapiteln, die die verschiedenen Aspekte des Zölibats detailliert untersuchen, sowie ein abschließendes Kapitel. Die Kapitel befassen sich unter anderem mit der Definition des Zölibats, der Geschichte des Klerus, dem Konzilstext, dem katholischen Kirchenrecht, aktuellen theologischen Ansichten, dem Zölibat aus der Sicht anderer Wissenschaften, empirischen Forschungsergebnissen und sozialpädagogischen Hilfsmöglichkeiten.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis des Zölibats in der katholischen Kirche zu vermitteln, die damit verbundenen Probleme aufzuzeigen und Lösungsansätze zu diskutieren. Die Arbeit möchte einen Beitrag zur Diskussion über den Zölibat leisten und Hilfestellungen für betroffene Personen anbieten.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf den Codex Iuris Canonici von 1983, Konzilstexte, theologische Literatur, Ergebnisse empirischer Forschung (z.B. Studie der Deutschen Bischofskonferenz), und relevante Beiträge aus anderen Wissenschaften (z.B. theologische Ethik, Psychologie, Sozialwissenschaften).
Wer sind die Zielgruppen dieser Arbeit?
Die Arbeit richtet sich an Theologen, Sozialwissenschaftler, Sozialpädagogen, sowie an alle, die sich mit dem Thema Zölibat in der katholischen Kirche auseinandersetzen möchten, einschließlich betroffener Priester und Frauen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Zölibat, Katholische Kirche, Priester, Frauen, Theologie, Kirchenrecht, Geschichte, Psychologie, Sozialwissenschaft, Sozialpädagogik, Identität, Beziehungen, Problematik, Hilfsangebote.
- Quote paper
- Dipl.Soz.päd. Antje-Marianne Di Bella (Author), 1995, Der Zölibat und seine Folgen. Problemanalyse und sozialpädagogische Überlegungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48398