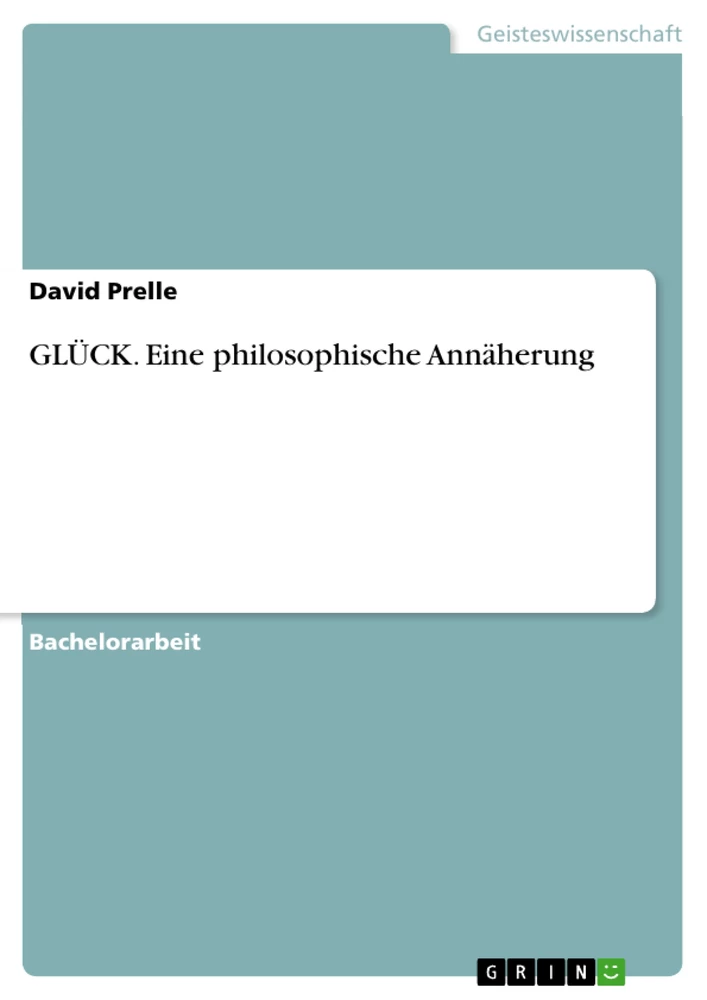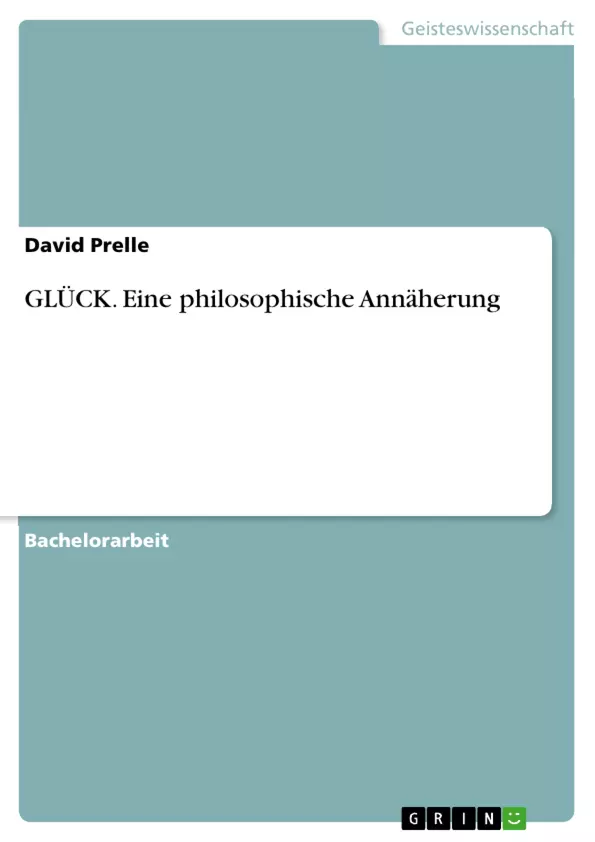Als Einführung in die Annäherung an das Glück steht die Frage: „Was ist Glück?“ – Kurz wird die sich über Jahrtausende streckende Glücksphilosophie umrissen. Als Wegweiser auf der Wanderung durch die philosophische Welt des Glücks sollen die aus dem Journalismus zu Zeiten vor Clickbait-Artikeln nicht wegzudenkenden sechs – von manchen um ein zusätzliches erweitertes – Ws dienen: Diese sechs, beziehungsweise sieben Ws sind Abkürzungen für die relevantesten Fragen, die eine Nachricht meist schon in dem sogenannten Lead, dem Anfang eines Artikels, beantwortet: Wer? – Was? – Wo? – Wann? – Wie? – Warum? – (Woher?)
Dabei werden von Aristoteles, Epikur und Augustinus bis hin zu Schopenhauer und zeitgenössischen Glücksphilosophen wie Mihály Csíkszentmihályi viele große Namen der Philosophie behandelt und sowohl ihre Wege zum Glück, als auch der diesen zugrundeliegende Glücksbegriff beschrieben, verglichen und kontextualisiert.
Systematisch werden so unter anderem die Fragen beantwortet, was unter "Glück" zu verstehen sei und welche Facetten das Glück hat.
Das Werk stellt somit eine ideale Einführung in eine philosophische Betrachtung des Glücks dar und kann aufgrund der Literaturangaben gut als Startpunkt für eine persönliche, tiefergehende Beschäftigung mit dem Thema dienen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist Glück? Oder: Die Problematik eines Glücksbegriffes
- 3. Wie ist Glück? Oder: Die Facetten des Glücks
- 3.1 Episodisches Glück
- 3.2 Periodisches Glück
- 4. Wann ist Glück? Oder: Die Deutungshoheit der Glückszuschreibung
- 5. Warum ist Glück? Oder: Voraussetzungen und Hindernisse des Glücks
- 6. Wo ist Glück? Oder: Wo beginnt das Glück?
- 7. Was ist Glück? Oder: Eine Zusammenfassung
- 8. Wer ist glücklich? Oder: Die Konkretisierung auf das Leben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, den allgegenwärtigen, aber dennoch diffusen Begriff des Glücks aus philosophischer Perspektive zu beleuchten. Sie untersucht die verschiedenen Facetten des Glücks, hinterfragt die Zuschreibung von Glück und erörtert die Voraussetzungen und Hindernisse für dessen Erleben.
- Definition und Problematik des Glücksbegriffs
- Die verschiedenen Arten und Formen des Glücks (episodisch, periodisch)
- Subjektive vs. objektive Zuschreibung von Glück
- Voraussetzungen und Hindernisse für das Glück
- Konkretisierung des Glücks im individuellen Leben
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit dem bekannten Zitat Augustinus' „beatos nos esse volumus“ (Wir alle wollen glückselig sein) und führt in die Thematik ein. Sie stellt die Frage nach dem Glück als eine der großen, über Generationen hinweg diskutierten Fragen der Menschheit dar und kündigt eine philosophische Annäherung an den Begriff des Glücks an, wobei die sieben Ws des Journalismus als Leitfragen dienen.
2. Was ist Glück? Oder: Die Problematik eines Glücksbegriffes: Dieses Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Definition des Glücksbegriffs. Es wird die jahrtausendelange Geschichte der Glücksphilosophie angerissen, und es werden vorläufige Eingrenzungen des Begriffs vorgenommen, um den nachfolgenden Untersuchungen einen Rahmen zu geben. Es werden die zentralen Fragen nach der Relevanz des Glücks und den Herausforderungen bei seiner Erforschung aufgeworfen.
3. Wie ist Glück? Oder: Die Facetten des Glücks: Dieses Kapitel unterscheidet zwischen episodischem und periodischem Glück. Episodisches Glück beschreibt kurze, intensive Glücksmomente, während periodisches Glück länger andauernde Phasen des Glücks bezeichnet. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der verschiedenen Ausprägungen des Glücks und ihrer Charakteristika. Es werden Beispiele für beide Arten von Glück gegeben und deren Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. Die Unterscheidung dient als Grundlage für das weitere Verständnis der Komplexität des Glücksbegriffs.
4. Wann ist Glück? Oder: Die Deutungshoheit der Glückszuschreibung: Das Kapitel diskutiert die Frage, wann man sich glücklich nennen darf und wer die Autorität zur Feststellung eines Glückszustandes hat. Es werden Argumente für sowohl subjektive als auch objektive Maßstäbe zur Glückszuschreibung präsentiert. Imre Kertész' Roman „Roman eines Schicksalslosen“ dient als Beispiel für die subjektive Perspektive auf Glück. Die Diskussion beleuchtet die komplexe Interaktion zwischen individueller Erfahrung und externer Bewertung des Glücks.
5. Warum ist Glück? Oder: Voraussetzungen und Hindernisse des Glücks: Dieses Kapitel untersucht die Voraussetzungen und Hindernisse für das Glück. Es wird hinterfragt, ob sich diese überhaupt definieren lassen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Faktoren, die das Erleben von Glück beeinflussen, und deren jeweilige Bedeutung. Die Diskussion dient als Brücke zu den folgenden Kapiteln, die sich mit der Lokalisierung und der individuellen Konkretisierung des Glücks befassen.
6. Wo ist Glück? Oder: Wo beginnt das Glück?: Dieses Kapitel behandelt die Frage nach dem Ort und dem Ursprung des Glücks. Es wird untersucht, ob Glück an einen bestimmten Ort oder eine Situation gebunden ist, oder ob es eher ein innerer Zustand ist, der unabhängig von äußeren Umständen existiert. Es wird ein tiefere Untersuchung in die verschiedenen Aspekte von Glück stattfinden, die mit seiner Lokalisierung im Leben eines Individuums zusammenhängen.
7. Was ist Glück? Oder: Eine Zusammenfassung: Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Punkte der vorherigen Kapitel zusammen. Es bietet einen Überblick über die unterschiedlichen Perspektiven und Interpretationen des Glücksbegriffs und integriert die Erkenntnisse der vorangegangenen Analysen. Die Kapitelzusammenfassung dient dazu, die Ergebnisse der Arbeit zu kontextualisieren und die Bedeutung der Ergebnisse im Ganzen zu unterstreichen.
Schlüsselwörter
Glück, Glücksphilosophie, Glücksbegriff, episodisches Glück, periodisches Glück, Glückszuschreibung, Subjektivität, Objektivität, Voraussetzungen des Glücks, Hindernisse des Glücks, Lebensqualität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Philosophische Annäherung an den Glücksbegriff
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Begriff des Glücks aus philosophischer Perspektive. Sie beleuchtet dessen verschiedene Facetten, hinterfragt die Zuschreibung von Glück und erörtert Voraussetzungen und Hindernisse für dessen Erleben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Die Problematik eines Glücksbegriffes, Die Facetten des Glücks (inkl. episodisches und periodisches Glück), Die Deutungshoheit der Glückszuschreibung, Voraussetzungen und Hindernisse des Glücks, Wo beginnt das Glück?, Eine Zusammenfassung und Die Konkretisierung auf das Leben.
Was wird unter episodischem und periodischem Glück verstanden?
Episodisches Glück beschreibt kurze, intensive Glücksmomente, während periodisches Glück länger andauernde Phasen des Glücks bezeichnet. Die Arbeit analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Formen.
Wie wird die Frage der Glückszuschreibung behandelt?
Die Arbeit diskutiert, wann man sich glücklich nennen darf und wer die Autorität zur Feststellung eines Glückszustandes hat. Sie präsentiert Argumente für subjektive und objektive Maßstäbe und beleuchtet die Interaktion zwischen individueller Erfahrung und externer Bewertung.
Welche Voraussetzungen und Hindernisse für Glück werden untersucht?
Das Kapitel "Voraussetzungen und Hindernisse des Glücks" analysiert die Faktoren, die das Erleben von Glück beeinflussen, und deren Bedeutung. Es wird hinterfragt, ob diese Faktoren überhaupt definierbar sind.
Wo wird nach dem Ursprung des Glücks gesucht?
Das Kapitel "Wo ist Glück?" untersucht, ob Glück an einen bestimmten Ort oder eine Situation gebunden ist oder ob es ein innerer Zustand ist, unabhängig von äußeren Umständen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Glück, Glücksphilosophie, Glücksbegriff, episodisches Glück, periodisches Glück, Glückszuschreibung, Subjektivität, Objektivität, Voraussetzungen des Glücks, Hindernisse des Glücks, Lebensqualität.
Welche Zitate oder Beispiele werden verwendet?
Die Einleitung beginnt mit dem Zitat Augustinus' „beatos nos esse volumus“. Im Kapitel zur Glückszuschreibung wird Imre Kertész' Roman „Roman eines Schicksalslosen“ als Beispiel herangezogen.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine philosophische Annäherung an den Glücksbegriff, wobei die sieben Ws des Journalismus (Was, Wer, Wann, Wo, Warum, Wie, Welche) als Leitfragen dienen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Die Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich für philosophische Überlegungen zum Thema Glück interessiert. Die Inhalte sind für eine strukturierte und professionelle Themenanalyse bestimmt.
- Quote paper
- David Prelle (Author), 2018, GLÜCK. Eine philosophische Annäherung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/484050