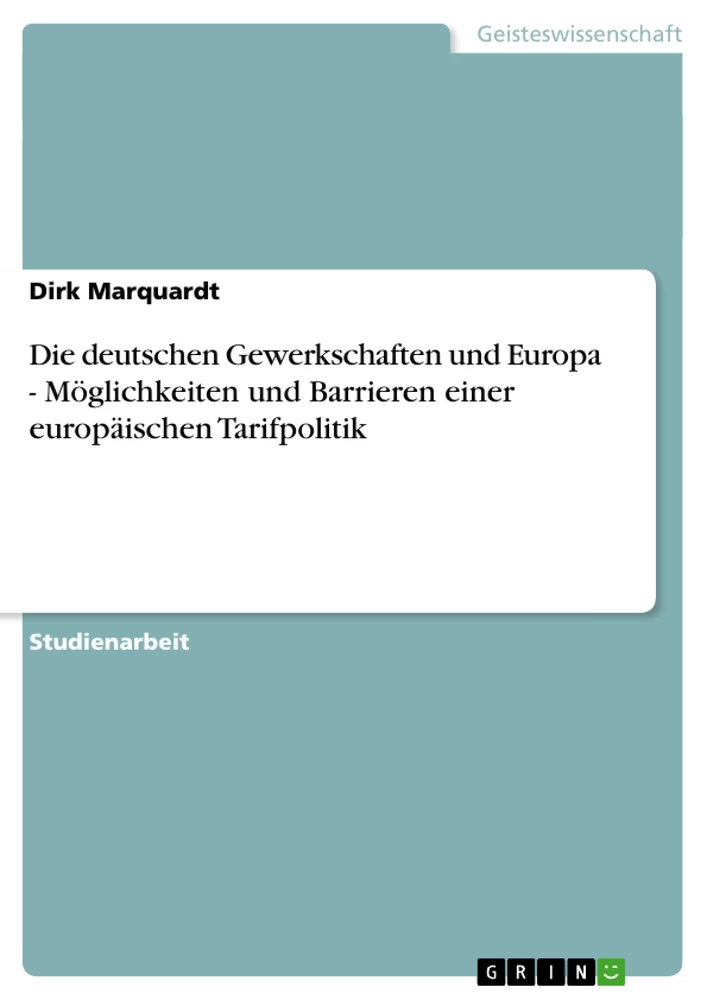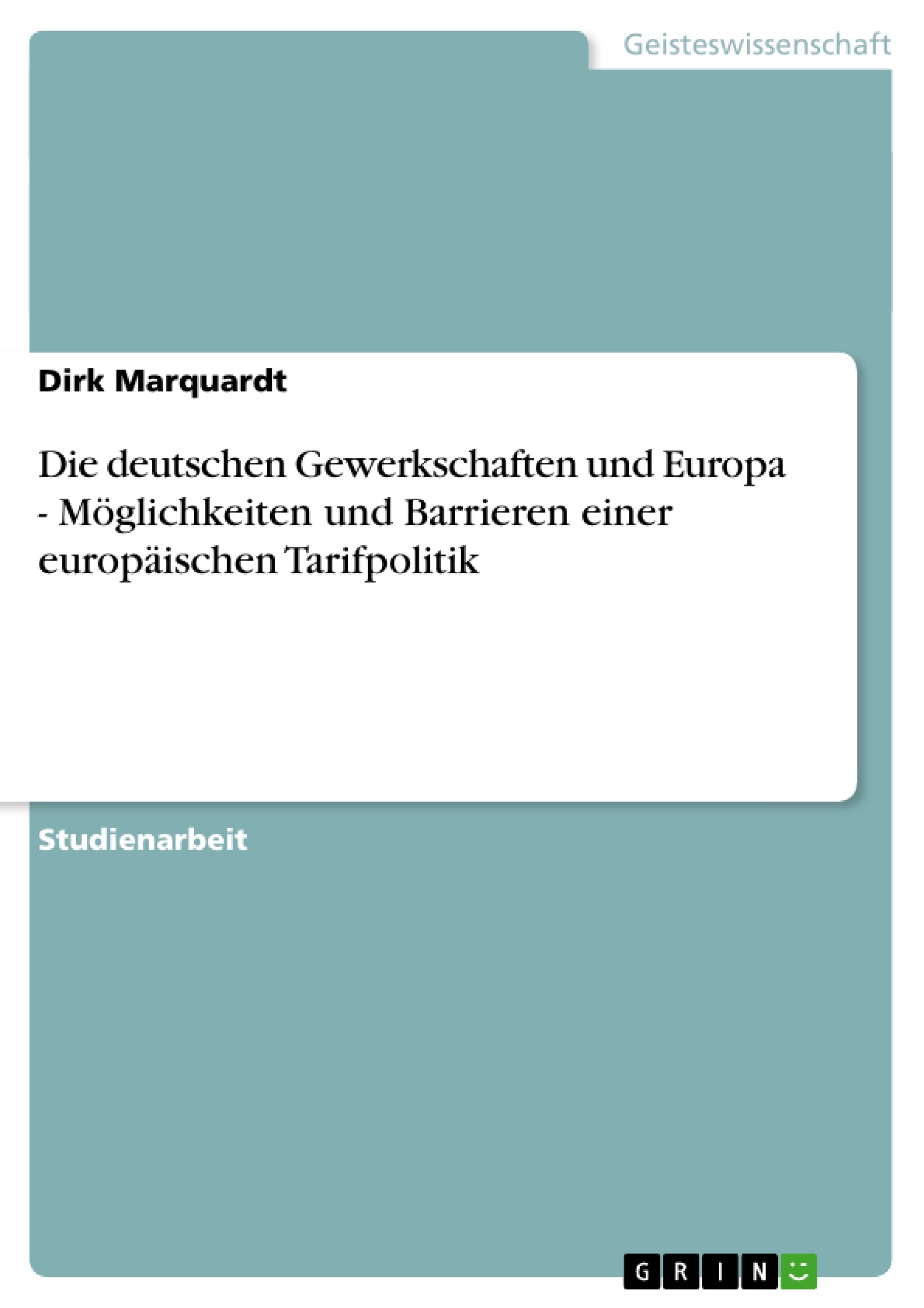Die deutschen Gewerkschaften stehen unter Druck. Schlagworte wie Erosion des Flächentarifvertrags, Mitgliederschwund und Globalisierung stehen für Problemlagen, welche die Legitimationsgrundlage und die Existenz der Gewerkschaften in Deutschland in Frage stellen. Keiner dieser Bereiche ist jedoch vollkommen losgelöst von den anderen Problemlagen, so dass es auf Grund der vielfältigen Verflechtungen und der unklaren Kausalitätslage schwierig ist, geeignete Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Ein Feld, welches Ansatz und Lösung des gewerkschaftlichen Dilemmas verspricht, ist die viel zitierte und geforderte Europäisierung der Tarifpolitik und damit verbunden eine gewerkschaftliche Neuorientierung, die mit bildhaften Phrasen wie „Aufbruch in eine neue Ära“ oder „Vorwärts zu den Wurzeln“ umschrieben werden kann. Es ist jedoch fraglich, ob es gelingt, ein System, das seit über einem Jahrhundert gewachsen ist und sich auch in dieser Zeit sämtliche Spielräume hart erkämpfen musste, durch Neuorientierung auf die Ebene der Europäischen Union zu transformieren, um die Menschen der verschiedenen Länder unter einem gemeinsamen Verbund im Namen europäischer Solidarität zu vereinen. Die vorliegende Arbeit möchte sich daher den Möglichkeiten und den Barrieren europäischer Tarifpolitik annehmen, welche sich den deutschen Gewerkschaften in ihrer Gesamtheit bieten. Die Problemstellung globalisierter Wirtschaftsbeziehungen erstreckt sich zwar nicht nur auf Europa. Dennoch sollen die Ausführungen auf den Kontext der Europäischen Union beschränkt bleiben, da dies der gegenwärtig fortgeschrittenste transnationale Wirtschaftsraum ist und sich eine umfassende Internationalisierung der Tarifverhandlungen wenn überhaupt zunächst auf diesen Raum erstrecken wird. Zudem unterliegt Globalisierung immer der regionalen Wahrnehmung, so dass für Europäer Globalisierung in erster Linie Europäisierung bedeutet (Zimmer 2002: 155). Zunächst sollen in diesem Rahmen die Problemlage und die Situation umschrieben werden, welche die deutschen Gewerkschaften zu einer Auseinandersetzung mit der Integration einer europäischen Gewerkschaftspolitik drängt. Im Anschluss daran folgt eine Darstellung und Bewertung der verschiedenen tarifpolitischen Ansätze auf europäischer Ebene, um auf dieser Grundlage in einem Fazit und kurzem Ausblick, eine Einschätzung möglicher Entwicklungstendenzen und damit verbunden zukünftiger Erfolgaussichten einer kollektiven europäischen Tarifpolitik geben zu können.
Inhaltsverzeichnis
- ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
- EINLEITUNG
- WOZU EUROPA? GRÜNDE FÜR EINE EUROPÄISIERUNG DER GEWERKSCHAFTEN
- INTERNATIONALISIERUNG DER AKTEURE INDUSTRIELLER BEZIEHUNGEN
- DIE EUROPÄISCHE UNION UND DER EURO
- NATIONALE TARIFPOLITIK IN EINEM UNGLEICHEN EUROPA
- ANSÄTZE ZUR EUROPÄISIERUNG DER TARIFPOLITIK
- INTERSEKTORALE ANSÄTZE AUF DER MAKROEBENE
- Akteure der Makroebene: EGB und UNICE
- Sozialer Dialog
- SEKTORALE ANSÄTZE AUF DER MESOEBENE
- Der Koordinierungsansatz des Europäischen Metallgewerkschaftsbundes
- Die Initiative für eine grenzüberschreitende Tarifpartnerschaft der IG-Metall
- UNTERNEHMENS- UND KONZERNBEZOGENE ANSÄTZE AUF DER MIKROEBENE - DER EUROPÄISCHE BETRIEBSRAT
- FAZIT
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Barrieren europäischer Tarifpolitik für deutsche Gewerkschaften im Kontext der Globalisierung. Sie analysiert die Herausforderungen, die durch die Internationalisierung von Unternehmen und Finanzmärkten entstehen, und untersucht, wie deutsche Gewerkschaften mit diesen Herausforderungen auf europäischer Ebene umgehen können.
- Internationalisierung der industriellen Beziehungen
- Die Rolle der Europäischen Union und des Euro
- Verschiedene Ansätze zur Europäisierung der Tarifpolitik
- Die Bedeutung des sozialen Dialogs
- Die Herausforderungen der Globalisierung für die deutschen Gewerkschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel analysiert die Gründe, warum sich deutsche Gewerkschaften mit einer Europäisierung ihrer Politik auseinandersetzen müssen. Es beleuchtet die Internationalisierung der Akteure in industriellen Beziehungen und die Auswirkungen der Globalisierung auf die nationalen Arbeitsbeziehungen.
Das zweite Kapitel betrachtet die verschiedenen Ansätze zur Europäisierung der Tarifpolitik, die auf verschiedenen Ebenen (Makro-, Meso- und Mikroebene) diskutiert werden. Es analysiert die Rolle von Akteuren wie EGB und UNICE, die Bedeutung des sozialen Dialogs und die verschiedenen Initiativen auf sektoraler Ebene, wie die des Europäischen Metallgewerkschaftsbundes und der IG-Metall.
Das dritte Kapitel widmet sich den unternehmens- und konzernbezogenen Ansätzen auf der Mikroebene und analysiert die Rolle des Europäischen Betriebsrats als Instrument der gewerkschaftlichen Interessenvertretung auf europäischer Ebene.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Themen wie Globalisierung, Europäisierung, Tarifpolitik, Gewerkschaften, Industrielle Beziehungen, Sozialer Dialog, Europäischer Betriebsrat, Internationalisierung des Kapitals, Wettbewerb und Standortfaktoren.
Häufig gestellte Fragen
Warum fordern Gewerkschaften eine Europäisierung der Tarifpolitik?
Um auf die Globalisierung, den Euro und die Internationalisierung der Unternehmen zu reagieren und einen "Abwärtswettbewerb" bei Löhnen zu verhindern.
Was ist der "Soziale Dialog" auf EU-Ebene?
Es ist ein intersektoraler Ansatz auf Makroebene, bei dem Akteure wie der EGB (Gewerkschaften) und UNICE (Arbeitgeber) über arbeitsrechtliche Standards verhandeln.
Welche Rolle spielt der Europäische Betriebsrat (EBR)?
Der EBR ist ein Instrument auf Unternehmensebene (Mikroebene), das die Information und Konsultation der Arbeitnehmer in transnationalen Konzernen sichert.
Was sind die Barrieren für eine gemeinsame europäische Tarifpolitik?
Unterschiedliche nationale Tarifsysteme, Sprachbarrieren, rechtliche Hürden und mangelnde europäische Solidarität erschweren die Umsetzung.
Was ist der Koordinierungsansatz des Metallgewerkschaftsbundes?
Es ist ein sektoraler Ansatz auf Mesoebene, der darauf abzielt, nationale Tarifverhandlungen grenzüberschreitend abzustimmen, um Reallohnverluste zu vermeiden.
- Citar trabajo
- Dirk Marquardt (Autor), 2005, Die deutschen Gewerkschaften und Europa - Möglichkeiten und Barrieren einer europäischen Tarifpolitik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48418