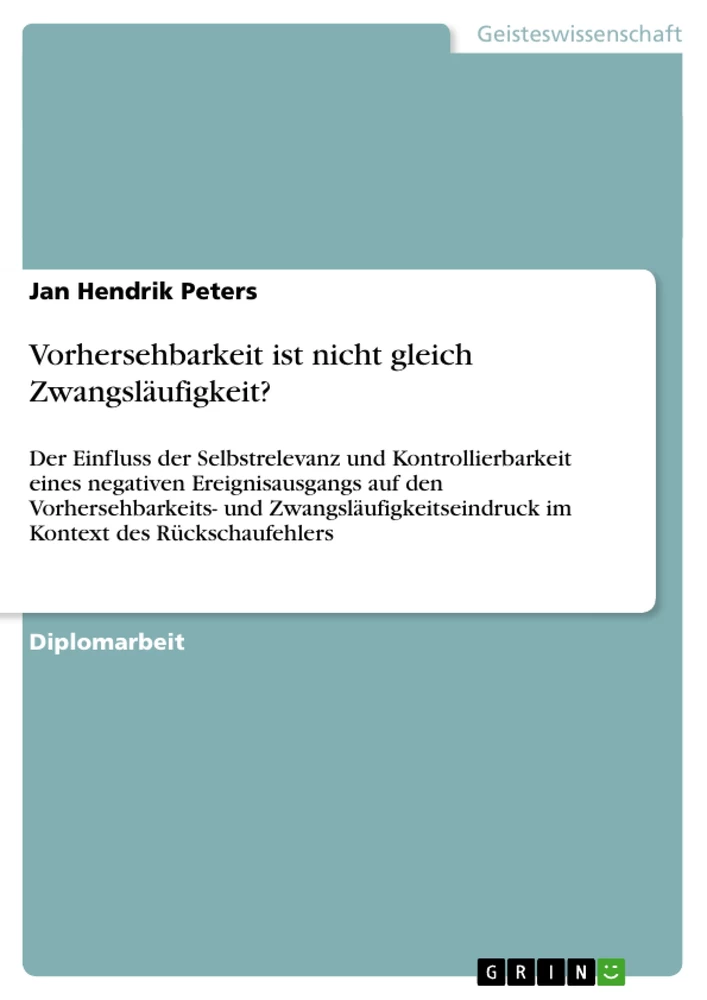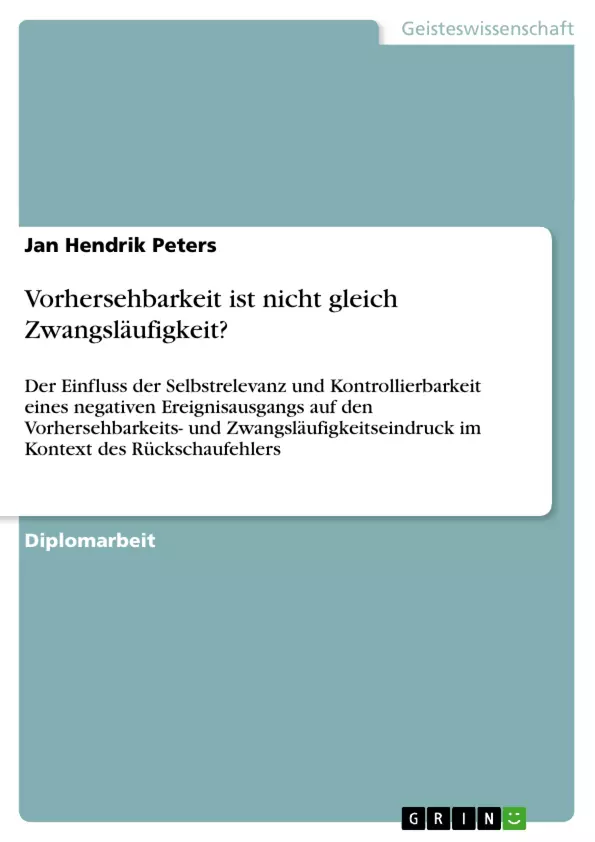In der Literatur finden sich widersprüchliche Befunde zum Rückschaufehler für negative, selbstrelevante Ereignisausgänge: Teilweise wird von einer Erhöhung, teilweise von einer Verringerung des Rückschaufehlers berichtet. Es soll versucht werden, diese Widersprüche aufzulösen, indem zwischen (a) unterschiedlich stark kontrollierbaren Ereignisausgängen und (b) verschiedenen Komponenten des Rückschaufehlers unterschieden wird. Es wird die Annahme überprüft, dass es bei kontrollierbaren Ereignisausgängen selbstwertschützend ist, den Vorhersehbarkeitseindruck für den Ausgang zu reduzieren, um sich von Schuldgefühlen zu entlasten (selbstwertschützender Mechanismus; Mark et al., 2003), während es bei unkontrollierbaren Ereignisausgängen die Enttäuschung lindert, den Zwangsläufigkeitseindruck zu erhöhen (retroaktiver Pessimismus; Tykocinski & Steinberg, 2005). Diese selbstdienlichen Prozesse sollten ausschließlich in selbstrelevanten Situationen auftreten. Daher versetzten sich die Vpn der Experimentalgruppe (n = 90) als Akteure in drei vorgegebene Szenarien hinein und gaben retrospektiv Vorhersehbarkeits- und Zwangsläufigkeitsurteile für deren negative Ausgänge an. Diese Urteile wurden mit zwei Kontrollgruppen (jeweils n = 60) verglichen, für die (a) die Ausgänge keine Selbstrelevanz besaßen bzw. (b) die keine Ausgangsinformationen erhalten hatten. Als weiterer Faktor wurde innerhalb jeder Gruppe die Kontrollierbarkeit (hoch vs. niedrig) des Ausgangs variiert. Trotz recht uneinheitlicher Befunde zu den drei Szenarien konnte gezeigt werden, dass in der Experimentalgruppe bei kontrollierbaren Ausgängen primär die wahrgenommene Vorhersehbarkeit verringert wird. Es wird gefolgert, dass der selbstwertschützende Mechanismus ausschließlich für kontrollierbare Ereignisausgänge sowie spezifisch auf den Vorhersehbarkeitseindruck wirkt. Der retroaktive Pessimismus ließ sich in der erwarteten Form nicht nachweisen.
Inhaltsverzeichnis
- ZUSAMMENFASSUNG
- 1. EINLEITUNG
- 2. THEORETISCHER UND EMPIRISCHER HINTERGRUND
- 2.1 Der Rückschaufehler: Konzept, Untersuchungsparadigmen und Operationalisierung
- 2.2 Der Rückschaufehler: Einheitliches Phänomen oder separate Komponenten?
- 2.2.1 Traditionelle Sichtweise
- 2.2.2 Primärer, sekundärer und tertiärer Rückschaufehler
- 2.2.3 Drei-Komponenten-Ansatz nach Blank
- 2.2.3.1 Entwicklung und Konzeption des Drei-Komponenten-Ansatzes
- 2.2.3.2 Empirische Befunde aus der Literatur
- 2.2.3.3 Empirische Studien der Blank-Gruppe
- 2.3 Erklärungsansätze des Rückschaufehlers
- 2.4 Empirische Befunde und theoretische Überlegungen: Der Einfluss negativer, selbstrelevanter Ausgänge
- 2.4.1 Selbstwertschutz durch Verringerung des Vorhersehbarkeitseindrucks
- 2.4.1.1 Hypothese und Befunde von Mark und Mellor
- 2.4.1.2 Ein früher widersprüchlicher Befund: Die Studie von Walster (1967)
- 2.4.1.3 Alternativerklärung der Befunde von Mark und Mellor: Die Rolle der Involviertheit
- 2.4.1.4 Vermeintliche Bestätigung der Hypothese von Mark und Mellor
- 2.4.1.5 Bestätigung der Hypothese von Mark und Mellor: Orthogonale Manipulation der Valenz und Selbstrelevanz bei Mark et al. (2003)
- 2.4.1.6 Zusammenfassung und Diskussion
- 2.4.2 Retroaktiver Pessimismus: Enttäuschungslinderung durch Erhöhung des Zwangsläufigkeitseindrucks
- 2.4.2.1 Hypothese und Befunde von Tykocinski und Mitarbeiter/innen
- 2.4.2.2 Weitere Befunde und Gegenbefunde zum retroaktiven Pessimismus: Vergewaltigungs-Szenarien
- 2.4.2.3 Zusammenfassung und Diskussion
- 2.4.3 Die Mediatorfunktion der wahrgenommenen Kontrollierbarkeit
- 2.4.3.1 Einschränkung des selbstwertschützenden Mechanismus auf kontrollierbare Ausgänge? Die Diskussion bei Mark et al. (2003)
- 2.4.3.2 Sind Schuldgefühle eine notwendige Voraussetzung für den selbstwertschützenden Mechanismus? Eine Studie von Pezzo (2003)
- 2.4.3.3 Die Rolle der Kontrollierbarkeit beim retroaktiven Pessimismus: Die Studie von Tykocinski und Steinberg (2005)
- 2.4.3.4 Zusammenfassung und Diskussion
- 2.4.4 Explizite Erfassung von Vorhersehbarkeits- und Zwangsläufigkeitseindruck in einer Studie: Ergebnisse der Blank-Gruppe
- 2.4.5 Zusammenfassung und Diskussion
- 2.5 Fragestellung und Hypothesen
- 2.5.1 Einfluss der Selbstrelevanz und Kontrollierbarkeit
- 2.5.2 Einfluss der Ausgangsinformation und Kontrollierbarkeit
- 2.5.3 Dissoziation des Vorhersehbarkeits- und Zwangsläufigkeitseindrucks
- 2.5.4 Weitere Untersuchungszwecke
- 3. METHODE
- 3.1 Überblick
- 3.2 Voruntersuchungen
- 3.2.1 Voruntersuchung 1: Auswahl der Szenarien
- 3.2.2 Voruntersuchung 2: Überprüfung des Einzelitem-Ansatzes
- 3.3 Versuchsplanung
- 3.4 Untersuchungsmaterial
- 3.5 Versuchspersonen
- 3.6 Durchführung
- 4. VORBEREITENDE DATENANALYSE UND AUSWERTUNG
- 4.1 Vorbereitende Datenanalyse
- 4.1.1 Ausreißer-Analyse
- 4.1.2 Skalen-Konstruktion
- 4.1.2.1 Vorüberlegungen
- 4.1.2.2 Gesamt-Skalen-Ansatz
- 4.1.2.3 Ansatz-der-unspezifischen-Items
- 4.1.2.4 Fazit zur Skalenkonstruktion
- 4.1.3 Prüfung auf Normalverteilung
- 4.1.3.1 Gesamt-Skalen-Ansatz
- 4.1.3.2 Ansatz-der-unspezifischen-Items
- 4.1.4 Manipulations-Kontrolle
- 4.2 Auswertung
- 5. ERGEBNISSE
- 5.1 Einfluss der Selbstrelevanz und Kontrollierbarkeit
- 5.1.1 Gesamt-Skalen-Ansatz
- 5.1.1.1 Gesamt-Ergebnisse über alle Szenarien
- 5.1.1.2 Ergebnisse für das eBay-Szenario
- 5.1.1.3 Ergebnisse für das Notebook-Szenario
- 5.1.1.4 Ergebnisse für das Prüfungs-Szenario
- 5.1.2 Ansatz-der-unspezifischen-Items
- 5.1.2.1 Gesamt-Ergebnisse über alle Szenarien
- 5.1.2.2 Ergebnisse für das eBay-Szenario
- 5.1.2.3 Ergebnisse für das Notebook-Szenario
- 5.1.2.4 Ergebnisse für das Prüfungs-Szenario
- 5.1.3 Gegenüberstellung und Zusammenfassung
- 5.2 Einfluss der Ausgangsinformation und der Kontrollierbarkeit
- 5.3 Dissoziation des Vorhersehbarkeits- und Zwangsläufigkeitseindrucks
- 5.3.1 Interaktion der Art der abhängigen Variable mit der Selbstrelevanz
- 5.3.2 Interaktion der Art der abhängigen Variable mit der Ausgangsinformation
- 5.4 Post-hoc-Analysen
- 6. DISKUSSION
- 6.1 Einfluss der Selbstrelevanz und Kontrollierbarkeit
- 6.2 Einfluss der Ausgangsinformation und der Kontrollierbarkeit
- 6.3 Dissoziation des Vorhersehbarkeits- und Zwangsläufigkeitseindrucks
- 6.4 Fazit und Ausblick
- 7. LITERATUR
- ANHANG
- A1. Exkurs: Sprachlich-logische Beziehung von „Vorhersehbarkeit“ und „Zwangsläufigkeit“
- A2. Voruntersuchung 1: Auswahl der Szenarien
- A2.1 Versuchsplanung
- A2.2 Untersuchungsmaterial
- A2.3 Versuchspersonen
- A2.4 Durchführung
- A2.5 Auswertung
- A2.6 Ergebnisse und Diskussion
- A2.6.1 Skalenbildung
- A2.6.2 Szenarienauswahl
- A2.6.3 Unterschiede der ausgewählten Szenarien
- A3. Voruntersuchung 2: Überprüfung des Einzelitem-Ansatzes
- A3.1 Versuchsplanung
- A3.2 Untersuchungsmaterial
- A3.3 Versuchspersonen
- A3.4 Durchführung
- A3.5 Auswertung
- A3.6 Ergebnisse und Diskussion
- A3.6.1 Autounfall-Szenario
- A3.6.2 Münzwurf-Szenario
- A3.7 Implikationen für die Hauptuntersuchung
- A4. Szenarien der Hauptuntersuchung
- A4.1 Szenario 3: eBay
- A4.1.1 Akteur-Perspektive, hohe Kontrollierbarkeit
- A4.1.2 Akteur-Perspektive, niedrige Kontrollierbarkeit
- A4.1.3 Beobachter-Perspektive, hohe Kontrollierbarkeit
- A4.2 Szenario 8: Notebook
- A4.2.1 Akteur-Perspektive, hohe Kontrollierbarkeit
- A4.2.2 Akteur-Perspektive, niedrige Kontrollierbarkeit
- Der Rückschaufehler als kognitiver Bias
- Der Einfluss der Selbstrelevanz auf den Rückschaufehler
- Die Rolle der Kontrollierbarkeit bei der Wahrnehmung von Vorhersehbarkeit und Zwangsläufigkeit
- Empirische Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Selbstrelevanz, Kontrollierbarkeit und dem Rückschaufehler
- Diskussion der Implikationen der Forschungsergebnisse für die Psychologie und die Entscheidungsfindung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Einfluss der Selbstrelevanz und Kontrollierbarkeit eines negativen Ereignisausgangs auf den Vorhersehbarkeits- und Zwangsläufigkeitseindruck im Kontext des Rückschaufehlers. Die Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Rückschaufehlers, einem kognitiven Bias, der dazu führt, dass Menschen die Vorhersehbarkeit von Ereignissen nach deren Eintreten überschätzen.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet den theoretischen und empirischen Hintergrund des Rückschaufehlers. Es werden verschiedene Definitionen und Untersuchungsparadigmen des Phänomens vorgestellt, sowie verschiedene Erklärungsansätze diskutiert. Kapitel 2.4 fokussiert auf den Einfluss negativer, selbstrelevanter Ausgänge auf den Rückschaufehler und beleuchtet verschiedene Hypothesen, darunter den Selbstwertschutz und den retroaktiven Pessimismus. Kapitel 2.5 legt die Fragestellung und Hypothesen der vorliegenden Arbeit fest.
Kapitel 3 beschreibt die Methode der empirischen Untersuchung, inklusive der Voruntersuchungen, Versuchsplanung, Untersuchungsmaterialien, Versuchspersonen und Durchführung.
Kapitel 4 beinhaltet die vorbereitende Datenanalyse und Auswertung, inklusive der Überprüfung auf Ausreißer, Skalenkonstruktion und Normalverteilung. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung, wobei der Einfluss der Selbstrelevanz und Kontrollierbarkeit sowie der Einfluss der Ausgangsinformation und der Kontrollierbarkeit untersucht werden.
Schlüsselwörter
Rückschaufehler, Selbstrelevanz, Kontrollierbarkeit, Vorhersehbarkeit, Zwangsläufigkeit, kognitiver Bias, Selbstwertschutz, retroaktiver Pessimismus, empirische Untersuchung, Entscheidungsfindung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Rückschaufehler (Hindsight Bias)?
Es ist das kognitive Phänomen, bei dem Menschen nach Eintreten eines Ereignisses glauben, sie hätten den Ausgang bereits vorher gewusst oder vorhergesehen.
Was unterscheidet Vorhersehbarkeit von Zwangsläufigkeit?
Vorhersehbarkeit bezieht sich auf das Wissen vor dem Ereignis; Zwangsläufigkeit auf das Gefühl, dass das Ereignis so eintreten musste (Determinismus).
Was ist "retroaktiver Pessimismus"?
Es ist eine Strategie zur Enttäuschungslinderung, bei der man den Zwangsläufigkeitseindruck eines negativen Ausgangs erhöht, um ihn als unvermeidbar zu akzeptieren.
Wie beeinflusst Selbstrelevanz den Rückschaufehler?
Bei selbstrelevanten negativen Ereignissen neigen Menschen dazu, die Vorhersehbarkeit zu reduzieren, um Schuldgefühle zu vermeiden (Selbstwertschutz).
Welche Rolle spielt die Kontrollierbarkeit bei diesem Fehler?
Der selbstwertschützende Mechanismus (Reduktion der Vorhersehbarkeit) wirkt primär bei Ausgängen, die man theoretisch hätte kontrollieren können.
- Quote paper
- Jan Hendrik Peters (Author), 2005, Vorhersehbarkeit ist nicht gleich Zwangsläufigkeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48421