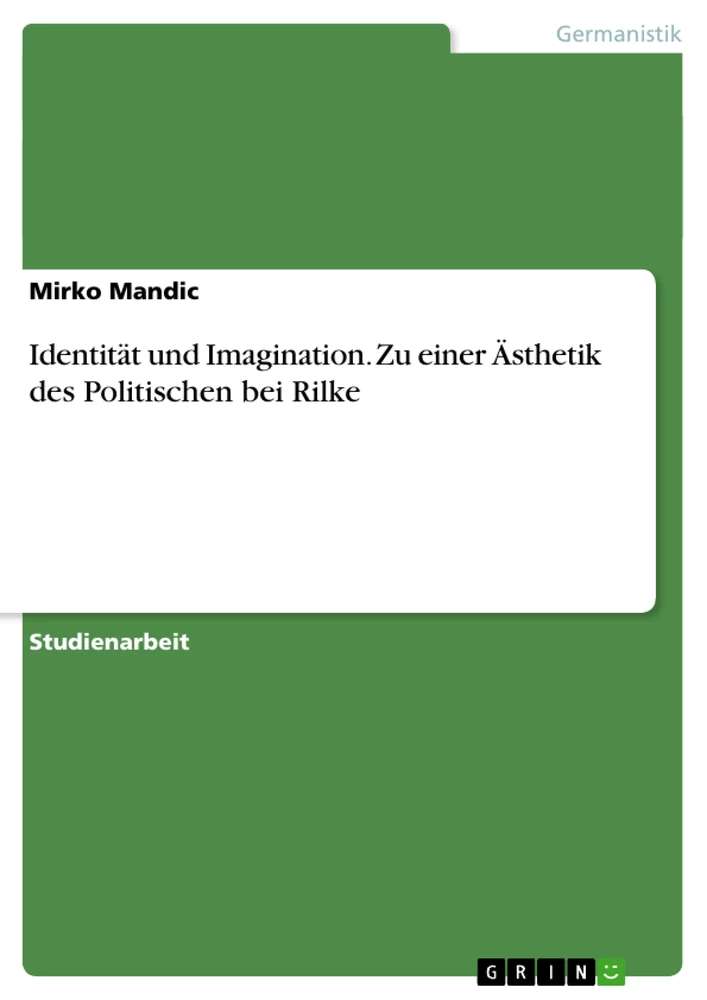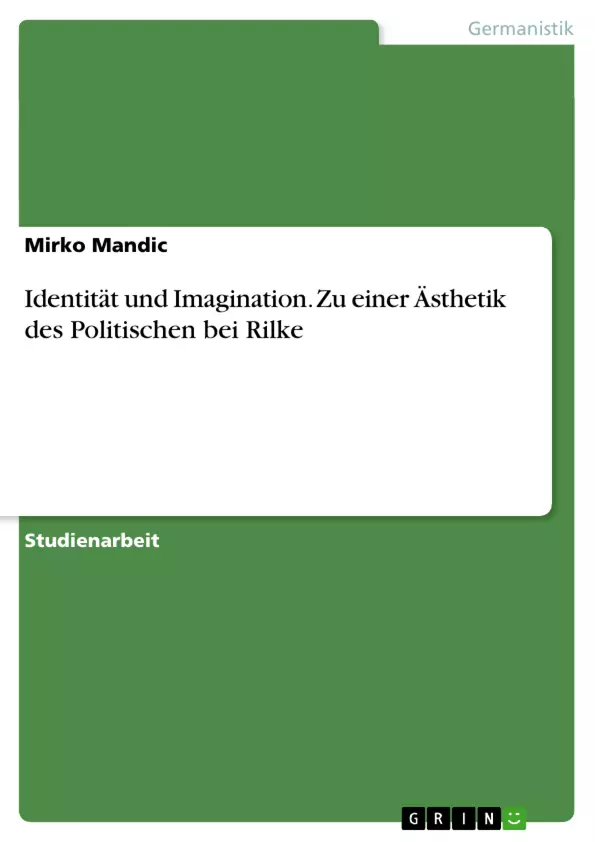Rilkes Verhältnis zum Politischen scheint selbst ein Politikum zu sein. Hatte die Rilke-Forschung dieses Thema lange und gerne umgangen, und sich mit biografischen und zeitgeschichtlichen Hinweisen zufriedengegeben, sah sie sich spätestens in den 70er Jahren zunehmend bedrängt, Rilkes Vereinnahmung durch den Nationalsozialismus zu erklären und damit „das sphärische Bild [des Autors und seines Werks] mit Eklat zu sprengen“. Dies endete dann entweder in der bedingungslosen Ablehnung bestimmter Dichtungen als neokonservativ, jeden Bezug auf das Soziale ablehnend, oder aber in einer vehementen Rechtfertigung von Werk und Autor. Dass dieser Gegenstand keineswegs erschöpft ist, zeigt nicht zuletzt die Kritik, die der 1992 von Joachim Storck herausgegebene Band „Briefe zur Politik“ widerfuhr.
Allen Beiträgen gemeinsam ist die Behandlung des Themas als etwas Peripheres. Demnach wird meist strikt unterschieden zwischen einem poetischen und einem politischen Paradigma. Letzteres bleibt dabei stets randständig, nebensächlich, ersterem untergeordnet. Bezüglich des Nationalsozialismus’ herrscht der Grundtenor der Verlegenheit.
Demgegenüber will diese Arbeit das Politische als eine spezielle Kategorie eines allgemeineren Prinzips begreifen, was m.E. heißt , dass Rilkes Verständnis des Politischen als genuin ästhetisches zu bestimmen ist. Die Frage nach der Konstitution und Beschaffenheit des Politischen wäre dann nicht unabhängig von Rilkes poetischer Produktion und den daraus ableitbaren poetologischen Konsequenzen zu beantworten.
Die Aufgabenstellung muss es also sein, zu fragen, ob und wie in Rilkes Texten dem Charakter des Politischen eine ästhetische (vielleicht sogar poetische) Disposition zugrunde gelegt werden kann. In der Arbeit soll anhand einiger explizit politischer Stellungnahmen Rilkes zunächst versucht werden, die dort entwickelte Gründung und Figuration des Politischen nachzuzeichnen. Es wird dann nach den politischen, gesellschaftlichen (und nicht zuletzt ästhetischen) Prämissen und Konsequenzen zu fragen sein, mit denen ein solcher Entwurf einhergeht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Rilke und die Politik
- Hauptteil: Zur ästhetischen Struktur des Politischen
- Suche nach einer Urform des Sozialen
- Alles oder Nichts: Vom Unsagbaren zum Sagbaren
- Der Status des Signifikanten und die Ermöglichung des Diskurses
- Jacques Derrida: Die supplementäre Metapher
- Ernesto Laclau: Der leere Signifikant
- Rainer Maria Rilke: Das Ding
- Erlebnis und Schicksal: Die Frage nach dem Einzelnen
- Schluss: Rilke und das Politische
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Rilkes Verhältnis zum Politischen und argumentiert, dass dieses als genuin ästhetisch zu verstehen ist. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Konstitution und Beschaffenheit des Politischen in Rilkes Texten nachzuzeichnen und zu analysieren, inwieweit dem Charakter des Politischen eine ästhetische Disposition zugrunde gelegt werden kann.
- Rilkes Verständnis von Politik als ästhetisches Prinzip
- Die Suche nach einer Urform des Sozialen und die Rolle des Politischen in dieser Konstellation
- Die Frage nach dem Verhältnis von sprachlicher und sinnlicher Erfahrung in der Politischen Sphäre
- Die Rolle von Ideen und Metaphern in der Gestaltung des Politischen
- Der Einfluss von Rilkes poetologischen Konzepten auf seine politische Positionierung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Rilke und die Politik
Dieses Kapitel beleuchtet die kontroverse Debatte um Rilkes Verhältnis zur Politik, insbesondere im Kontext des Nationalsozialismus. Es wird die gängige Unterscheidung zwischen einem poetischen und einem politischen Paradigma in der Rilke-Forschung kritisch beleuchtet und die These aufgestellt, dass Rilkes Verständnis des Politischen als genuin ästhetisches betrachtet werden sollte.
Hauptteil: Zur poetischen Struktur des Politischen
Der Hauptteil beginnt mit der Analyse eines Rilke-Fragments aus dem Jahr 1919, in dem der Autor zwei verschiedene Zeitkonzeptionen gegenüberstellt: die „eigentliche Welt-Stunde“ und die „politische Uhr“. Ausgehend von dieser Unterscheidung wird die Frage nach der Einordnung eines politischen Bewusstseins in einen natürlichen Zeithorizont gestellt.
Suche nach einer Urform des Sozialen
Der Autor beleuchtet Rilkes Vorstellung einer metaphysischen Grundlage für politische Gemeinschaften, die sich in einem Brief an Margot Gräfin Sizzo-Noris-Crouy aus dem Jahr 1922 manifestiert. In diesem Brief artikuliert Rilke politische Bewusstseinsbildung als nationale Wesenshaftigkeit, die auf bestimmte originäre Muster metaphysischer Beschaffenheit zurückzuführen ist. Die Konstitution des Politischen zielt demnach auf die Erfüllung eines übersinnlich Vorgegebenen ab, wobei jede Abweichung vom Ideell Vorhandenen nicht das Gegebene erschüttert, sondern dessen Geltung bestätigt.
Alles oder Nichts: Vom Unsagbaren zum Sagbaren
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Frage, wie ein solches metaphysisches Fundament, das als „unbegreiflich“ und „verschwiegen“ beschrieben wird, semantisch zugänglich gemacht werden kann. Der Autor verweist auf die Schwierigkeit, die Schwelle des Politischen als Idee sprachlich zu fassen, und untersucht, wie Rilke das Unbegreifliche des Politischen in einem „Ding“ manifestiert.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Themen Politische Ästhetik, Rilkes Poetologie, Urform des Sozialen, Metaphern und Signifikanten, Erlebnis und Schicksal, Nationales Bewusstsein, politisches Bewusstsein, und die Frage nach dem Verhältnis zwischen sprachlicher und sinnlicher Erfahrung in der politischen Sphäre.
Häufig gestellte Fragen
Wie verstand Rainer Maria Rilke das Politische?
Rilke begriff das Politische als eine genuin ästhetische Kategorie, die eng mit seiner poetischen Produktion verknüpft war.
Was meinte Rilke mit der „politischen Uhr“?
Rilke kontrastierte die „politische Uhr“ mit der „eigentlichen Welt-Stunde“, um ein künstliches politisches Bewusstsein von einem natürlichen Zeithorizont abzugrenzen.
Welchen Bezug hatte Rilke zum Nationalsozialismus?
Die Forschung diskutiert kontrovers über Rilkes Vereinnahmung durch den Nationalsozialismus und seine Suche nach einer metaphysischen Urform des Sozialen.
Was ist das „Ding“ in Rilkes politischer Ästhetik?
Das „Ding“ dient als Manifestation des Unbegreiflichen und hilft, metaphysische Fundamente semantisch zugänglich zu machen.
Wie hängen Identität und Imagination bei Rilke zusammen?
Imagination ist das Mittel, um politische Identität als nationale Wesenshaftigkeit auf Basis metaphysischer Muster zu konstituieren.
- Arbeit zitieren
- Mirko Mandic (Autor:in), 2002, Identität und Imagination. Zu einer Ästhetik des Politischen bei Rilke, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48428