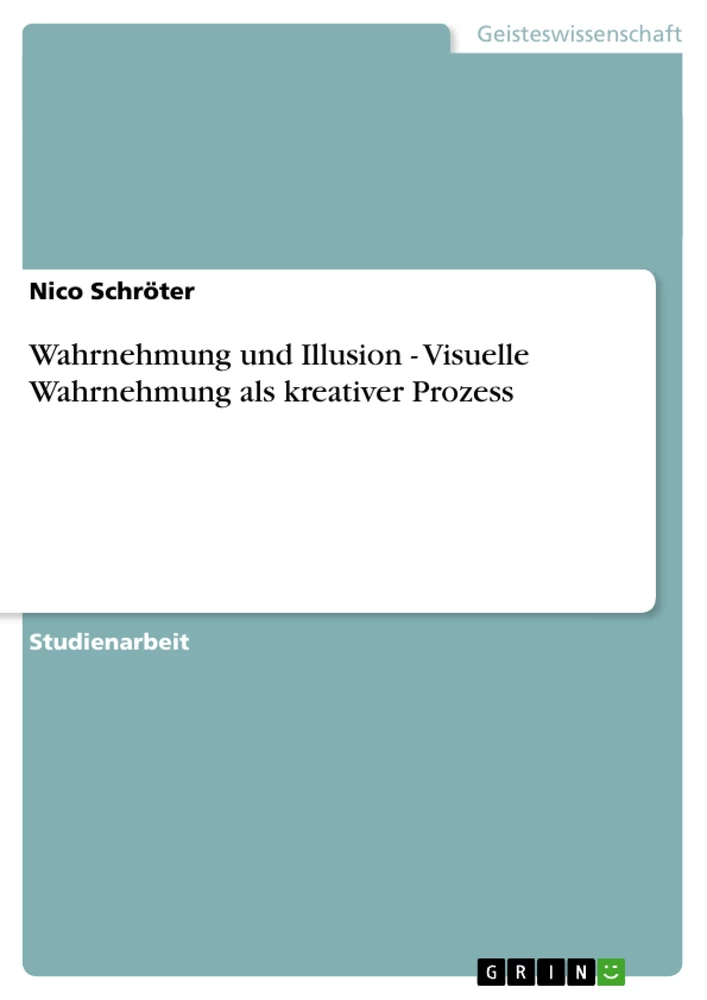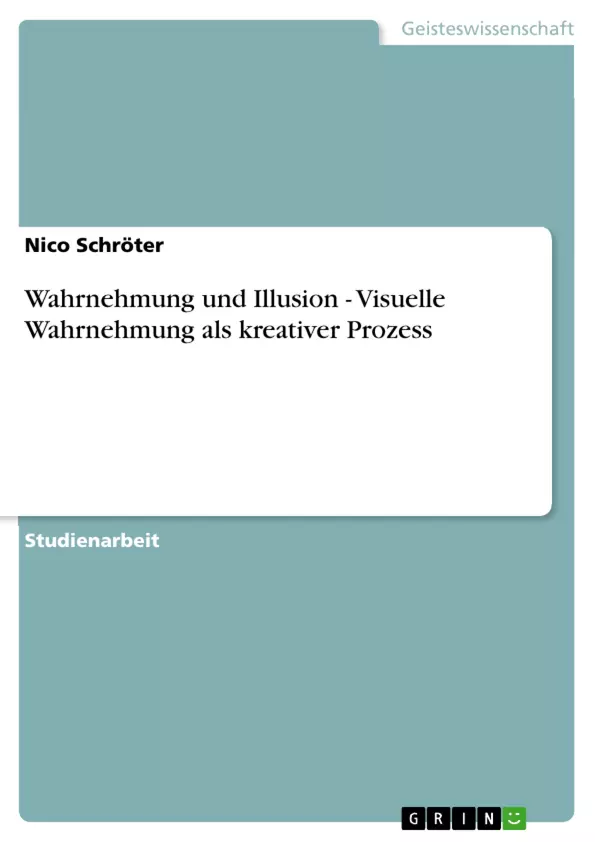Als Arbeitsgrundlage für diese Hausarbeit diente uns der Text von G. Schlosser „Wenn der Schein trügt“ aus dem Buch „Illusion und Simulation“.
Die Wahrnehmung des Menschen wirft grundlegende Fragen auf: „Wie werden die bioelektrischen Signale vom Nervensystem verarbeitet und interpretiert, so dass Wahrnehmungen entstehen?“.
Thema dieser Hausarbeit ist es, zu erklären, dass visuelle Wahrnehmung kein Abbild der Umgebung im Kopf erzeugt, also nicht zur Repräsentation der Umgebung führt, sondern als ein kreativer konstruktiver Prozess aufgefasst werden kann. Dabei können optische Täuschungen entstehen. Auch bei alltäglichen Dingen werden wir immer wieder in die Irre geleitet. Urteile über die von uns erfahrbare Welt erweisen sich oft im Nachhinein als falsch, obwohl wir meinten, sie seien wahr. Wir stellen fest, dass wir uns getäuscht haben und bewerten daraufhin unsere Erfahrungswelt neu. Das heißt also, dass wir in unserer Erfahrungswelt zwischen Wirklichem und Nicht-Wirklichem unterscheiden. Wie verhält sich nun aber die „Welt an sich“ zur Welt unseres Wahrnehmens und Denkens? Wir können nicht unsere eigene Wahrnehmungsebene verlassen und unsere Umwelt von außerhalb des eigenen Körpers betrachten. Somit können wir sie nicht mit der „Welt an sich“ vergleichen, vielmehr werden wir sie niemals erfahren können.
Die Erklärung des Sehvorganges hat zu allen Zeiten die bedeutendsten Wissenschaftler, wie Physiker, Mediziner, Philosophen und Psychologen, in gleichem Maße angezogen. Dabei waren die Ansichten über die Entstehung der Wahrnehmung im Laufe der Jahrhunderte erheblichen Änderungen unterworfen. Demokrit und andere Naturphilosophen des griechischen Altertums haben die Auffassung vertreten, dass die Seheindrücke durch Strahlen hervorgerufen werden, die von den Objekten der Außenwelt ausgehen und ins Auge gelangen. Die Pythagoräer hingegen vermuteten im Augeninneren eine Strahlungsquelle, die die Objekte der Außenwelt abtastet. Sie glaubten im Augenleuchten vieler Tiere einen Beweis dafür zu haben.
Ein Aufblühen der Wissenschaft erfolgte durch Erkenntnisse der Physiker I. Newton, P. Mariotte sowie A. Fresnel und Ch. Huygens. Insbesondere die Erkenntnisse der vergangenen zwei Jahrzehnte im Bereich der Neurologie und Psychiatrie führten zu neuen Ansätzen über die Verarbeitung visueller Informationen durch unser Gehirn.
Inhaltsverzeichnis
- Detektorenkonzept
- Einleitung
- Das visuelle System
- Visuelle Wahrnehmung als konstruktiver Prozess
- Gestaltprinzipien der Wahrnehmungspsychologie
- Fazit
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der visuellen Wahrnehmung des Menschen und untersucht, wie diese durch den kreativen und konstruktiven Prozess des visuellen Systems entsteht. Dabei wird die Rolle von optischen Täuschungen und die Unterscheidung zwischen Wirklichem und Nicht-Wirklichem in unserer Erfahrungswelt beleuchtet.
- Visuelle Wahrnehmung als konstruktiver Prozess
- Optische Täuschungen und ihre Entstehung
- Die Unterscheidung zwischen Wirklichem und Nicht-Wirklichem
- Die Rolle des visuellen Systems bei der Verarbeitung von Informationen
- Die Geschichte der Erforschung des Sehvorgangs
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel stellt die grundlegenden Fragen zur visuellen Wahrnehmung und führt das Thema der Hausarbeit ein, die visuelle Wahrnehmung als einen konstruktiven Prozess zu erklären. Außerdem wird die Unterscheidung zwischen Wirklichem und Nicht-Wirklichem in der Erfahrungswelt thematisiert.
- Das visuelle System: Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau und die Funktionsweise des menschlichen Auges. Es beleuchtet die Rolle des dioptrischen Apparats, der Linse, der Retina und der Photorezeptoren bei der Verarbeitung von Lichtinformationen.
Schlüsselwörter
Visuelle Wahrnehmung, konstruktiver Prozess, optische Täuschungen, Wirkliches und Nicht-Wirkliches, dioptrischer Apparat, Linse, Retina, Photorezeptoren, Stäbchen, Zapfen, Sehen, Helligkeit, Farbe.
Häufig gestellte Fragen
Ist visuelle Wahrnehmung ein bloßes Abbild der Realität?
Nein, visuelle Wahrnehmung wird heute als ein kreativer und konstruktiver Prozess verstanden. Das Gehirn erzeugt kein 1:1-Abbild der Umgebung, sondern interpretiert bioelektrische Signale des Nervensystems.
Wie entstehen optische Täuschungen?
Optische Täuschungen entstehen, wenn der konstruktive Prozess des Gehirns bei der Interpretation von Sehinformationen in die Irre geleitet wird, was zu einer Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und physikalischer Realität führt.
Welche Rolle spielt die Retina beim Sehen?
Die Retina (Netzhaut) enthält Photorezeptoren (Stäbchen und Zapfen), die Lichtreize in elektrische Impulse umwandeln, welche dann über den Sehnerv an das Gehirn weitergeleitet werden.
Was ist der Unterschied zwischen Stäbchen und Zapfen?
Stäbchen sind für das Sehen bei geringer Helligkeit (Dämmerungssehen) verantwortlich, während Zapfen für das Farbsehen und die Sehschärfe bei gutem Licht zuständig sind.
Was sind Gestaltprinzipien in der Wahrnehmungspsychologie?
Gestaltprinzipien beschreiben Regeln, nach denen unser Gehirn einzelne visuelle Elemente zu sinnvollen Einheiten oder "Gestalten" zusammenfügt, um die Umwelt zu strukturieren.
- Citar trabajo
- Nico Schröter (Autor), 2002, Wahrnehmung und Illusion - Visuelle Wahrnehmung als kreativer Prozess, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4851