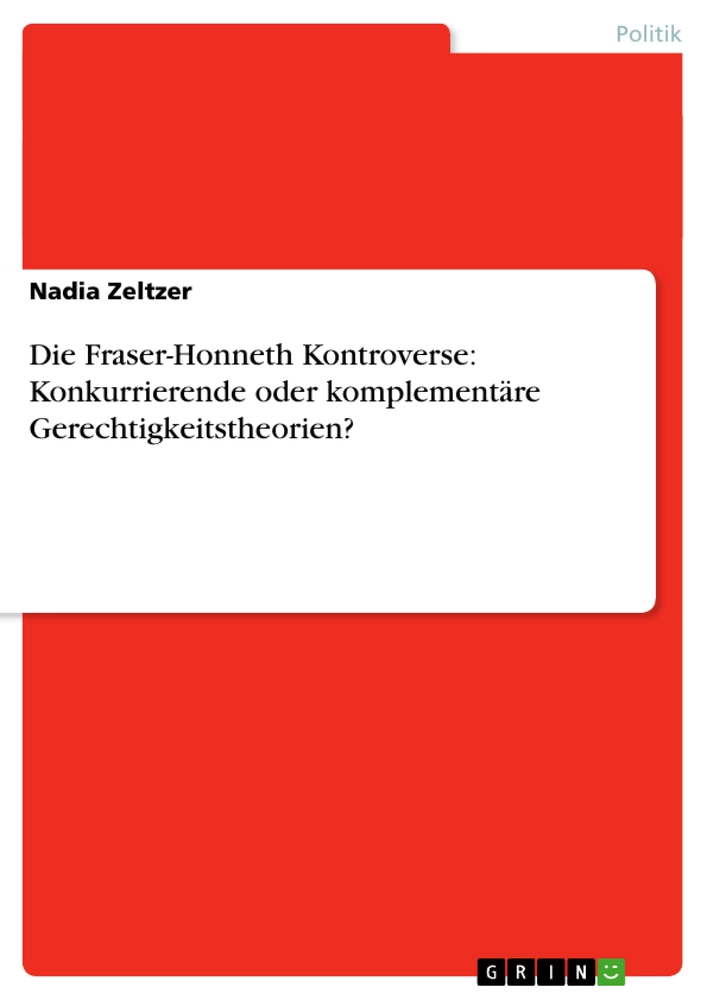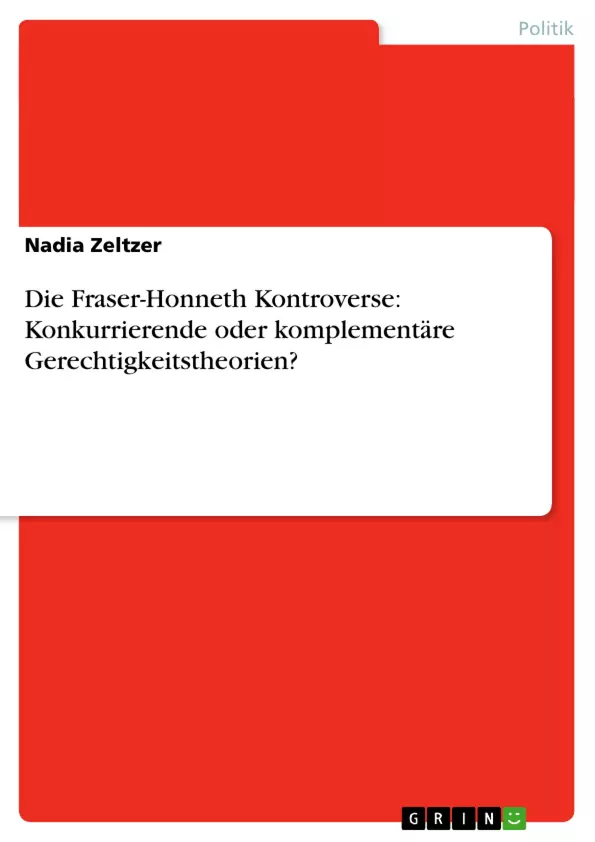Nancy Fraser und Axel Honneth stellen in der Monographie Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische Kontroverse,zwei verschiedene
Gerechtigkeitstheorien vor. Obwohl die Autoren die Unvereinbarkeit der beiden Konzepte untermalen, werde ich in diesem Aufsatz zeigen, dass diese Theorien auch als komplementäre Theorien verstanden werden können. Nachdem ich die Züge des „Statusmodells der Anerkennung“ Frasers und der Theorie der Möglichkeit der Entwicklung einer „intakten Identität“ Honneths kurz skizziert habe, werde ich ihre jeweilige Gültigkeit empirisch am Modell der „Zwei-Verdiener-Familie“, im Rahmen des europäische-verbindlichen-Gender-Mainstreaming, überprüfen. Anhand dieser Ergebnisse werde ich zeigen, warum keines der Gerechtigkeitsmodelle die vollständige Dimension der geschlechtlichen Ungerechtigkeit erfasst. Darüber hinaus werde ich zeigen, wie sich die Gerechtigkeitstheorien Frasers und Honneths vereinbaren lassen.
I. Die Fraser-Honneth Kontroverse
1. Darstellung der Theorie der Gerechtigkeit Nancy Frasers Nancy Fraser kritisiert in ihrem Aufsatz: „Soziale Gerechtigkeit im Zeitalter der Identitätspolitik, Umverteilung, Anerkennung und Beteiligung“, die „verkürzte Gerechtigkeit“. Ihrer Auffassung nach, leiden benachteiligte Gruppierungen sowohl unter ökonomischer Benachteiligung wie auch unter mangelnder Anerkennung, und es sind dies die primären Arten der Ungerechtigkeit des gleichen Ursprungs. Die ökonomische Umverteilung hat einen Klassencharakter, die kulturelle Anerkennung der Differenz hingegen einen Statuscharakter.
Die demokratische androzentrische Gesellschaft, Produkt der Moralphilosophie der Aufklärung, versteht Anerkennung als Angelegenheit der „Selbstverwirklichung“, als kulturell und historisch geprägt und nicht als Angelegenheit des universellen verbindlichen Rechts. Durch institutionalisierte kulturelle Wertmuster werden benachteiligte Gruppierungen aufgrund mangelnder Anerkennung, daran gehindert, gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren.
Inhaltsverzeichnis
- Die Fraser-Honneth Kontroverse
- Darstellung der Gerechtigkeitstheorie Nancy Frasers
- Darstellung der Gerechtigkeitstheorie Axel Honneths
- Das Ende der Klassengesellschaft?
- Umverteilung als Anerkennung von Individualisierungsforderungen?
- Das europäische Gender-Mainstreaming und das „Zwei-Verdiener-Modell“
- Das deutsche Attachment am „bread-winner-model“
- Nicht-reformistische Reformen und Einbeziehung der Dimension Anerkennung
- Das „Zwei-Verdiener-Modell“ als kleinstes Übels
- Das schwedische Beispiel und die Notwendigkeit der Einbeziehung der Dimension „Anerkennung“
- Ergänzungsfähigkeit beider Gerechtigkeitstheorien
- Kommentar zur Gerechtigkeitstheorie Axel Honneths
- Kommentar zur Gerechtigkeitstheorie Nancy Frasers
- Komplementäre Beziehungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz untersucht die Kontroverse zwischen Nancy Frasers und Axel Honneths Gerechtigkeitstheorien, die in ihrer Monographie „Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische Kontroverse“ dargelegt werden. Im Zentrum steht die Frage, ob diese Theorien konkurrierend oder komplementär sind. Die Analyse konzentriert sich auf das empirische Beispiel des „Zwei-Verdiener-Modells“ und dessen Auswirkungen auf die geschlechtliche Ungerechtigkeit. Ziel des Aufsatzes ist es, zu zeigen, dass die Theorien von Fraser und Honneth, trotz ihrer unterschiedlichen Schwerpunkte, als komplementär verstanden werden können, um die Komplexität der geschlechtlichen Ungerechtigkeit adäquat zu erfassen.
- Die Kontroverse zwischen Nancy Frasers und Axel Honneths Gerechtigkeitstheorien
- Die empirische Analyse des „Zwei-Verdiener-Modells“ im Kontext des europäischen Gender-Mainstreaming
- Die Frage der Anerkennung von Individualisierungsforderungen im Rahmen der Umverteilung
- Die komplementäre Beziehung zwischen den Theorien von Fraser und Honneth
- Die Relevanz der Einbeziehung der Dimension „Anerkennung“ für die Bekämpfung der geschlechtlichen Ungerechtigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Theorien von Nancy Fraser und Axel Honneth vor. Frasers „Statusmodell der Anerkennung“ betont die Bedeutung von Anerkennung in der Überwindung von Ungerechtigkeit, während Honneths Theorie der „intakten Identitätsbildung“ die Notwendigkeit von Anerkennung für die Selbstverwirklichung im Vordergrund stellt. Das zweite Kapitel untersucht die aktuelle Phase des Postfordismus und die Verschiebung des Schwerpunktes von der Umverteilung hin zur Anerkennung. In diesem Zusammenhang wird die Relevanz der Klassengesellschaftstheorie diskutiert. Das dritte Kapitel beleuchtet das „Zwei-Verdiener-Modell“ und seine Auswirkungen auf die geschlechtliche Ungerechtigkeit im europäischen Kontext. Hierbei werden die Unterschiede zwischen den deutschen und schwedischen Modellen hervorgehoben. Das vierte Kapitel argumentiert, dass die Theorien von Fraser und Honneth nicht als konkurrierend, sondern als komplementär verstanden werden sollten, um die vollständige Dimension der geschlechtlichen Ungerechtigkeit zu erfassen. Es werden Reformvorschläge präsentiert, die die Dimension „Anerkennung“ in die politische Praxis integrieren.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieses Aufsatzes sind: Gerechtigkeit, Umverteilung, Anerkennung, Gender, „Zwei-Verdiener-Modell“, Fraser, Honneth, Postfordismus, Klassengesellschaft, Identitätspolitik, Gender-Mainstreaming.
- Arbeit zitieren
- Nadia Zeltzer (Autor:in), 2004, Die Fraser-Honneth Kontroverse: Konkurrierende oder komplementäre Gerechtigkeitstheorien?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48560