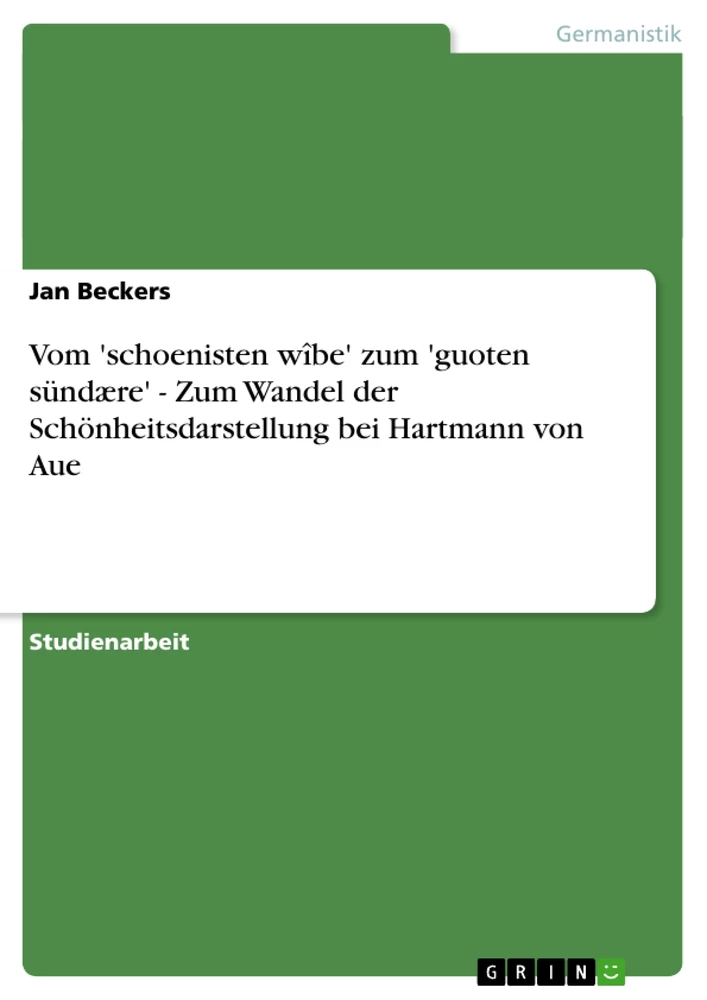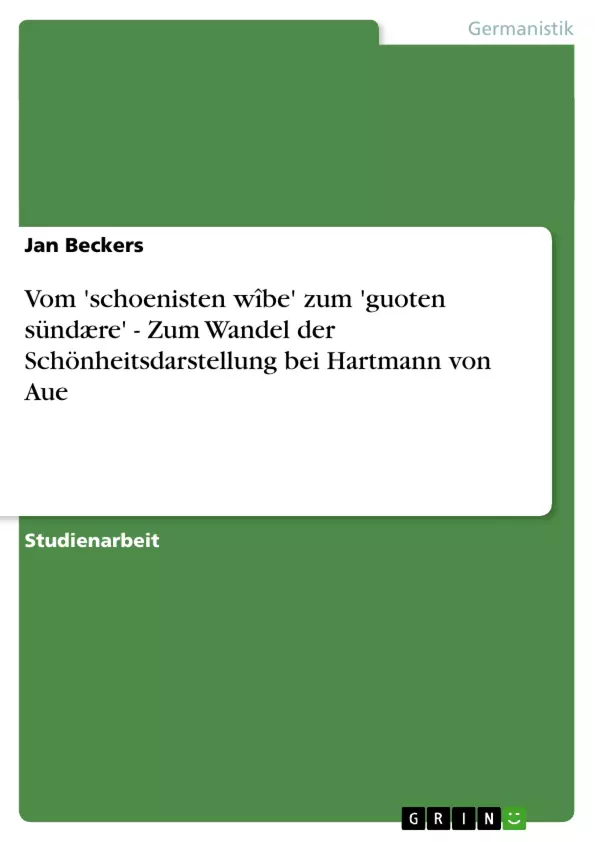Zum Wandel der Schönheitsdarstellung bei Hartmann von Aue
1. Einleitung:
Als einer der ersten deutschen Autoren übertrug Hartmann von Aue gegen Ende des 12. Jahrhunderts einen französischen Artusroman und schuf so eine eigene Tradition in Deutschland. Dreh und Angelpunkt des neu entstandenen höfischen Romans ist der Artushof, von dem aus sich die Ritter auf aventiure begeben, um Ehre für sich selber und den gesamten Hof des König Artus zu erringen. Ein Merkmal dieser neuen höfischen Literatur ist es, unter vielen anderen Merkmalen, dass ihre Protagonisten immer äußerlich schön und gleichzeitig innerlich gut sind. Diese Übereinstimmung von Schönheit und Güte verblüfft zunächst, sie ist keineswegs eine genuine Erfindung der mittelalterlichen Dichter, vielmehr muss man sich zunächst die Her-kunft der Schönheitslehre des Mittelalters vor Augen führen. Die Schönheitslehre ist kategorial anders definiert, als zum Beispiel moderne Ästhetiken. Auf diese Andersartigkeit geht das erste Kapitel der Arbeit ein, im Besonderen auf die Schönheitslehre des Thomas von Aquin. Er leitet die Schönheit aus der Seinslehre ab und definiert somit das Schöne als das eigentliche Prinzip der Schöpfung.
Bei der Beschäftigung mit der Schönheitslehre des Thomas von Aquin ist allerdings zu beachten, dass Thomas nicht etwa ein Lehrer, oder Vorläufer der höfischen Dichter war, vielmehr erschienen seine Traktate erst nach den zahlreichen höfischen Romanen. Man kann also nicht die Schönheitskategorien Thomas´ als Muster über den eigentlichen Text legen, vielmehr kann man die Lehre als eine Kompilation gängiger Schönheitsideale des Mittelalters (bzw. höfischer Literatur) sehen. Die Beschäftigung mit Thomas von Aquin soll am Anfang dieser Arbeit die Kategorien aufzeigen, die im Mittelalter für das Schöne galten und die als allgemein gültige Merkmale auch den Dichtern des Mittelalters bewusst waren. Die einzelnen Kategorien zur Beschreibung von Schönheit müssen sich dann jeweils am Text zeigen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung:
- Die Schönheitslehre im Mittelalter:
- Schönheit als Kongruenz von innerem Wesen und äußerem Zeichen:
- Die Kriterien des Thomas von Aquin im „Erec“:
- Das Kriterium der integritas/perfectio:
- Das Kriterium der proportio/consonantia:
- Das Kriterium der claritas:
- Die Bildprogramme der descriptio:
- Das lange Lied von Troja:
- Tispe und Piramus:
- Die vier Elemente:
- Zusammenfassung zur Idealität der Schönheit im „Erec“:
- Schönheit in der christlichen Demut:
- Der hässlich/schöne Büßer Gregorius
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Wandel der Schönheitsdarstellung bei Hartmann von Aue, insbesondere im Vergleich zwischen seinem Artusroman „Erec“ und dem Legendenroman „Gregorius“. Ziel ist es, die Entwicklung des Schönheitsideals von der idealisierten Schönheit des höfischen Romans zum Konzept der inneren Schönheit im christlichen Kontext aufzuzeigen.
- Die Schönheitslehre des Mittelalters und ihre Abgrenzung zu modernen Ästhetiken
- Die Verbindung von innerer Güte und äußerer Schönheit in der höfischen Literatur
- Die Bedeutung der descriptio und ihrer Bildprogramme im „Erec“
- Das Konzept der christlichen Demut und die Darstellung von Schönheit im „Gregorius“
- Der Wandel des Schönheitsideals bei Hartmann von Aue
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt den Leser in die Thematik des Wandels der Schönheitsdarstellung bei Hartmann von Aue ein und skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit.
- Die Schönheitslehre im Mittelalter: Dieses Kapitel behandelt die philosophischen Grundlagen der mittelalterlichen Schönheitslehre, insbesondere die Ideen von Platon, Augustinus und Thomas von Aquin. Es wird die These vertreten, dass Schönheit als eine Seinskategorie verstanden wurde und mit innerer Güte in Verbindung stand.
- Schönheit als Kongruenz von innerem Wesen und äußerem Zeichen: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Schönheit im „Erec“ Hartmanns von Aue, wobei die descriptio von Enites Pferd als Schlüsselszenen dienen.
- Schönheit in der christlichen Demut: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Legendenroman „Gregorius“ und der Darstellung des büßenden Gregorius als Beispiel für eine alternative Form der Schönheit, die die innere Schönheit der Seele über die äußere Hässlichkeit stellt.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Schönheit, Mittelalter, Hartmann von Aue, „Erec“, „Gregorius“, höfische Literatur, Schönheitslehre, Thomas von Aquin, descriptio, Bildprogramm, christliche Demut, innerer und äußerer Wert.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Schönheit und Güte im Mittelalter zusammen?
In der höfischen Literatur galt das Ideal der „Kalokagathie“: Äußere Schönheit war ein direktes Zeichen für ein innerlich gutes Wesen und moralische Integrität.
Was ist die Schönheitslehre des Thomas von Aquin?
Er definierte Schönheit durch drei Kriterien: Integritas (Vollkommenheit), Proportio (Ebenmaß) und Claritas (Glanz/Klarheit).
Wie wandelt sich das Schönheitsideal im „Gregorius“?
Im Gegensatz zum ritterlichen „Erec“ zeigt der „Gregorius“ eine christliche Perspektive: Der büßende Gregorius kann äußerlich hässlich, aber durch seine Demut innerlich schön sein.
Was bedeutet „Descriptio“ in der mittelalterlichen Dichtung?
Die Descriptio ist eine ausführliche rhetorische Beschreibung von Personen oder Gegenständen, die dazu dient, deren idealen Status zu untermauern.
Welche Rolle spielt die christliche Demut für die Ästhetik?
Sie bricht die zwangsläufige Kopplung von äußerer Pracht und Wertigkeit auf und rückt die Seelenreinheit in den Fokus der Darstellung.
- Arbeit zitieren
- Jan Beckers (Autor:in), 2005, Vom 'schoenisten wîbe' zum 'guoten sündære' - Zum Wandel der Schönheitsdarstellung bei Hartmann von Aue, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48706