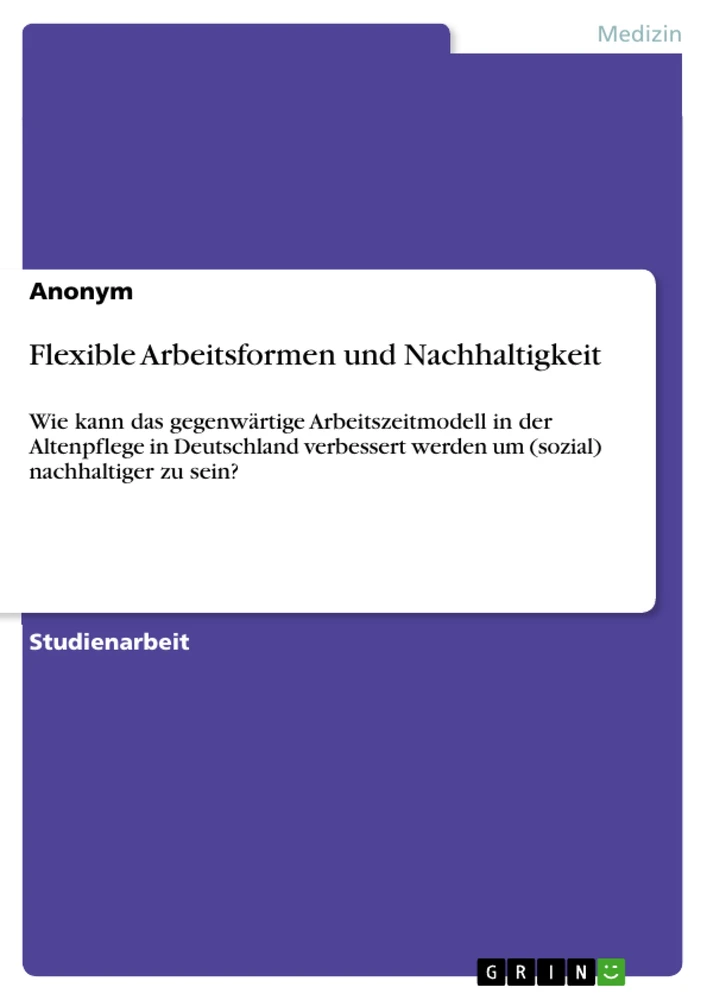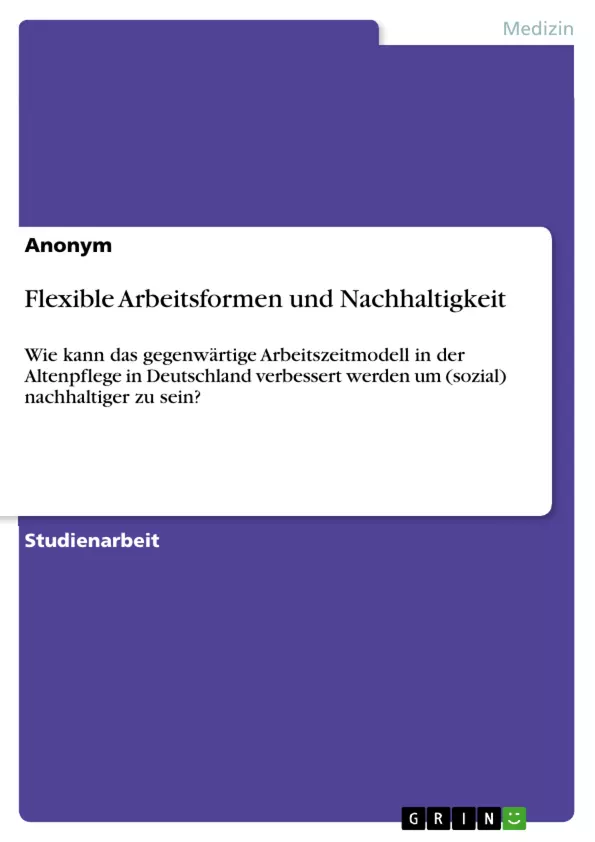Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung, sowie des steigenden Bedarfs an Altenpflegekräften durch den demografischen Wandel in Deutschland, gewinnt es immer mehr an Wichtigkeit sich mit dem Thema soziale Nachhaltigkeit in der Altenpflege zu befassen.
Die Marktverschiebung hin zu privaten Investmentinteressen führt zu einer Ausreizung der Belastbarkeit der sozialen und ökonomischen Systeme in unserer Gesellschaft. Die soziale Nachhaltigkeit ist im ursprünglichen Gedanken der Nächstenliebe, aus welcher auch die Kranken- und Altenpflege hervorging, vorhanden und somit stark mit dem gesellschaftlichen Nutzen des Pflegebedürftigen, zu seiner Umwelt, verbunden.
Aus der ökonomisch nachhaltigen Sichtweise, ist der gesellschaftliche Nutzen für die folgenden Generationen mit inbegriffen, wobei eine starke Korrelation zur kurzfristigen Bereicherung des Einzelnen vermutet werden kann.
Dadurch ergeben sich in unserem Fall folgende Akteure (Die Mitarbeiter, die Gesellschaft (dazu zählen auch die Bewohner und ihre Angehörigen), die politischen Akteure und die Unternehmung bzw. die Träger), welche jeweils unterschiedliche Interessen verfolgen.
Da der Schwerpunkt unserer Forschungsarbeit die Mitarbeiterinteressen und die gesellschaftlichen Interessen beleuchtet, werden im Folgenden die Trägerinteressen und politischen Interessen dargelegt.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 0 – Einleitung
- 0.1 Ausgangslage, Problemstellung und Zielsetzung
- 0.2 Abgrenzung des Themas
- 0.3 Methodisches Vorgehen
- Kapitel 1 – Begriffsbestimmungen und Grundlagen (These)
- 1.1 Pflege
- 1.2 Pflegekraft im Altenheim
- a. Betreuung im Altenheim
- b. Leasing in der Pflege
- c. Zahlen und Fakten
- 1.3 Arbeitsqualität
- 1.4 Pflegequalität
- 1.5 Nachhaltigkeit
- 1.6 Ökonomische Nachhaltigkeit
- 1.7 Soziale Nachhaltigkeit
- Kapitel 2 – Wie hat sich der Pflegebereich verändert? Wie sieht die Altenpflege gegenwärtig aus?
- 2.1 Abspaltung/Etablierung der Pflege im Altenheim
- 2.2 Einführung und Auswirkungen des Pflegeversicherungsgesetzes
- a. Rahmenverträge
- b. DRG - Ökonomische Nachhaltigkeit einer Einrichtung
- 2.3 Aufteilung der Interessengruppen aufgrund der Marktverteilung
- a. Trägerinteresse
- b. Politisch-rechtliches Interesse
- 2.4 Zwischenfazit
- Kapitel 3 - Wie gestaltet sich das gegenwärtige Modell im Hinblick auf seine soziale Nachhaltigkeit? Bestehen Gründe dieses Modell zu verbessern?
- 3.1 Derzeitiges Modell
- 3.2 Vorteile und Problemherde beim gegenwärtigen Arbeitszeitmodell
- Kapitel 4 - Welche Möglichkeiten der Verbesserung gibt es und wie sollte dies etabliert werden?
- 4.1 Neue Qualität der Arbeit
- 4.2 7/7- Modell als Alternative
- 4.3 Etablierung eines neuen Arbeitszeitmodelles am Beispiel von 7/7
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob und wie das aktuelle Arbeitszeitmodell in der Altenpflege in Deutschland verbessert werden kann, um die soziale Nachhaltigkeit zu steigern. Sie untersucht die Herausforderungen, die sich aus dem demografischen Wandel und dem Fachkräftemangel für die Altenpflege ergeben und analysiert die Auswirkungen des derzeitigen Arbeitszeitmodells auf die Arbeitsqualität, Pflegequalität und die Work-Life-Balance der Pflegekräfte.
- Soziale Nachhaltigkeit in der Altenpflege
- Verbesserung des Arbeitszeitmodells
- Einfluss von Arbeitszeitmodellen auf Arbeitsqualität und Pflegequalität
- Ökonomische Nachhaltigkeit von Pflegeeinrichtungen
- Work-Life-Balance der Pflegekräfte
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 0 - Einleitung
Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und beschreibt die aktuelle Situation in der Altenpflege in Deutschland. Es beleuchtet die Problematik des Fachkräftemangels und die Auswirkungen auf die Arbeitsbelastung der Pflegekräfte. Die Arbeit untersucht, inwiefern das bestehende Arbeitszeitmodell einen Verbesserungsbedarf aufweist und welche Auswirkungen Veränderungen auf die soziale Nachhaltigkeit haben könnten.
Kapitel 1 - Begriffsbestimmungen und Grundlagen (These)
Dieses Kapitel definiert die wichtigsten Begriffe, die im Kontext der Forschungsarbeit relevant sind. Es behandelt die Begriffe "Pflege", "Pflegekraft", "Arbeitsqualität", "Pflegequalität" und "Nachhaltigkeit" im Detail.
Kapitel 2 - Wie hat sich der Pflegebereich verändert? Wie sieht die Altenpflege gegenwärtig aus?
Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Pflegebereichs und die aktuelle Situation in der Altenpflege. Es thematisiert die Einführung des Pflegeversicherungsgesetzes, die Auswirkungen auf die Marktverteilung und die Interessen der verschiedenen Akteure im System.
Kapitel 3 - Wie gestaltet sich das gegenwärtige Modell im Hinblick auf seine soziale Nachhaltigkeit? Bestehen Gründe dieses Modell zu verbessern?
Dieses Kapitel untersucht das aktuelle Arbeitszeitmodell in der Altenpflege und analysiert seine Vor- und Nachteile hinsichtlich der sozialen Nachhaltigkeit.
Kapitel 4 - Welche Möglichkeiten der Verbesserung gibt es und wie sollte dies etabliert werden?
Dieses Kapitel stellt verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung des Arbeitszeitmodells vor und analysiert deren Auswirkungen auf die soziale Nachhaltigkeit.
Schlüsselwörter
Diese Forschungsarbeit fokussiert auf die Bereiche der sozialen Nachhaltigkeit in der Altenpflege, Arbeitszeitmodelle, Arbeitsqualität, Pflegequalität, Work-Life-Balance und Ökonomische Nachhaltigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet soziale Nachhaltigkeit im Kontext der Altenpflege?
Soziale Nachhaltigkeit bezieht sich auf Arbeitsbedingungen, die die Gesundheit und Motivation der Pflegekräfte langfristig erhalten, eine gute Work-Life-Balance ermöglichen und gleichzeitig eine hohe Pflegequalität für die Bewohner sichern.
Warum ist das aktuelle Arbeitszeitmodell in der Pflege problematisch?
Hohe Arbeitsbelastung, Schichtdienst und Fachkräftemangel führen oft zu einer Überreizung der Belastbarkeit, was negative Auswirkungen auf die Arbeitsqualität und die Gesundheit der Mitarbeiter hat.
Was ist das 7/7-Modell als Alternative in der Pflege?
Das 7/7-Modell ist ein alternatives Arbeitszeitmodell, bei dem Pflegekräfte sieben Tage arbeiten und anschließend sieben Tage frei haben, um eine bessere Erholung und Planbarkeit zu ermöglichen.
Welchen Einfluss hat das Pflegeversicherungsgesetz auf die Heime?
Das Gesetz hat den Wettbewerb und den ökonomischen Druck auf die Träger erhöht, was oft zu einem Spannungsfeld zwischen ökonomischer Effizienz und sozialer Nachhaltigkeit führt.
Wie korrelieren Arbeitsqualität und Pflegequalität?
Die Arbeit zeigt auf, dass eine höhere Arbeitsqualität und zufriedene Mitarbeiter direkt zu einer besseren Versorgung und höheren Lebensqualität der pflegebedürftigen Menschen beitragen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2017, Flexible Arbeitsformen und Nachhaltigkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/488805