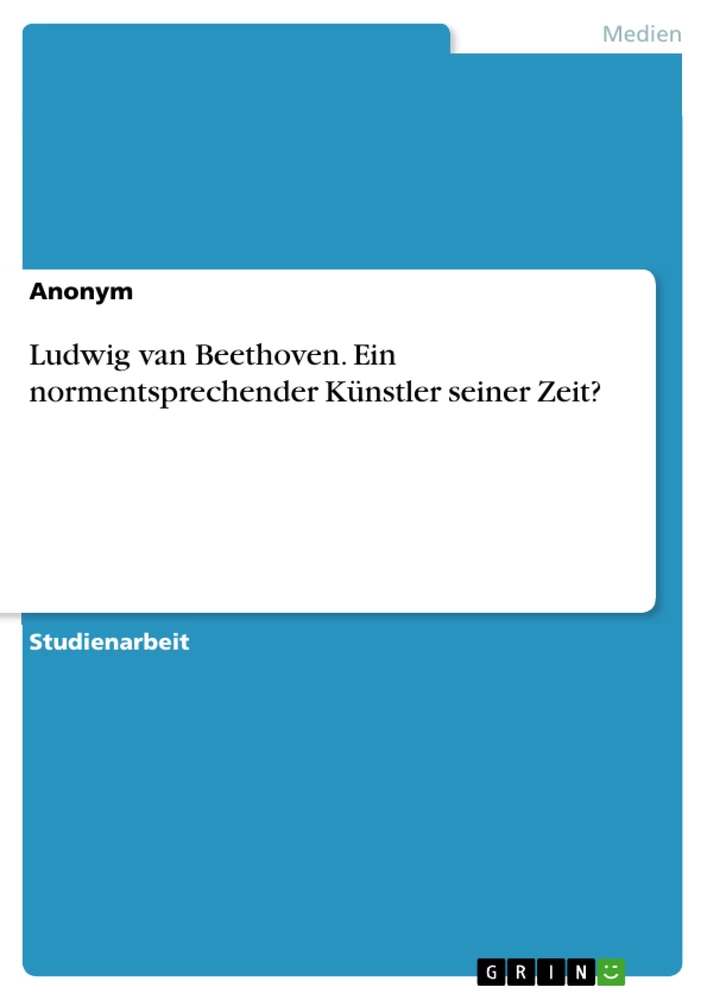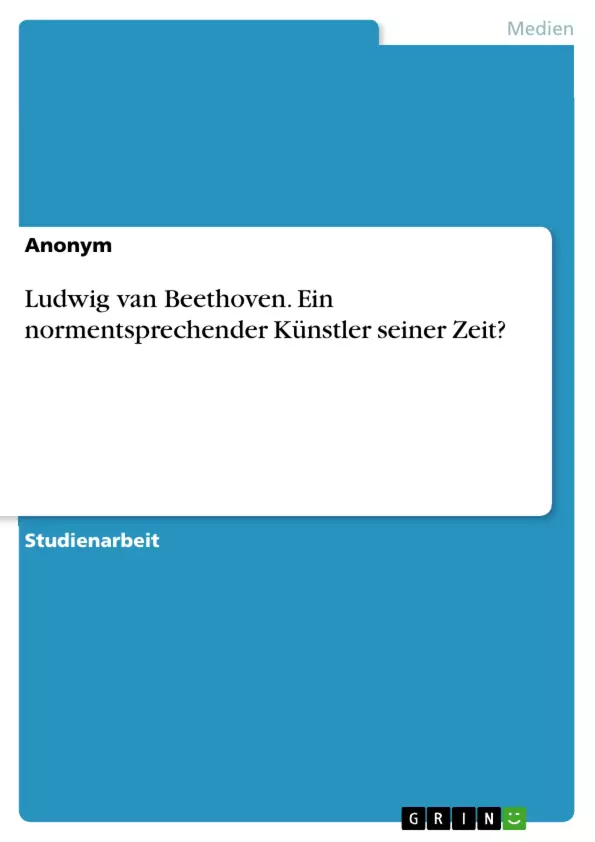Ludwig van Beethoven zählt neben Mozart und Haydn zu den drei bedeutendsten Komponisten seiner Zeit. Ob in der Schule oder im Gespräch über Musik, Beethoven wird meist als beispielhafter Musiker der Wiener Klassik dargestellt. Weshalb er als Exempel der damaligen Zeit immer wieder aufgegriffen wird und als Modell seiner Zeit gilt, soll in dieser Arbeit herausgearbeitet werden.
Dieser Arbeit wird eine Definition des Begriffs „Norm“ vorangestellt, die ausschlaggebend für den Verlauf ist.
Zu Beginn dieser Arbeit steht eine kurze Biographie Ludwig van Beethovens, die den Künstler und sein Leben resümieren soll. Bewusst wird die Biographie wenig umfangreich verfasst sein, da sie nur einen groben Einblick in sein Leben und Schaffen bieten soll. Dies ist der Ausgangspunkt, um seine Gedanken und Charaktereigenschaften herzuleiten. Hauptaugenmerk wird in diesem Kapitel auf seiner Erkrankung der Schwerhörigkeit liegen, die sein Handeln stark beeinflusst hat.
Im Anschluss daran wird die „Eroica“ als beispielhaftes heroisches Werk seiner Zeit vorgestellt. Die Auswahl der Dritten Sinfonie ist dadurch begründet, dass zu dieser Zeit seine Taubheit stark fortgeschritten war und sich Ludwig van Beethoven in einer Lebenskrise befand. Außerdem gilt sie als Exempel der heroischen Musik.
Abgeschlossen wird diese Arbeit, indem der Frage nachgegangen wird, ob Beethoven ein Komponist war, der aus der Norm ausgebrochen ist oder doch als ein normentsprechender Künstler seiner Zeit gelten kann, wie es heute gelehrt wird. Hierbei wird Bezug genommen auf die vorangestellte Definition der „Norm“, Beethoven als Person und sein erfolgreiches, beispielhaftes Werk „Eroica“, die Dritte Sinfonie.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Versuch einer Begriffsdefinition zu „Norm“
- 3.0 Biographie Beethovens
- 3.1 Persönlichkeit Beethovens
- 4.0 Eroica, Die Dritte Sinfonie
- 4.1 Zehn absolute Neuerungen der Eroica
- 5.0 Anerkennung und Ablehnung
- 6.0 Beethoven als normentsprechender Künstler oder ein Ausbrecher aus der Norm
- 7.0 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit soll die Frage klären, ob Ludwig van Beethoven, ein bedeutender Komponist der Wiener Klassik, als normentsprechender Künstler seiner Zeit betrachtet werden kann. Dazu wird der Begriff „Norm“ definiert und die Biographie Beethovens beleuchtet, wobei seine Schwerhörigkeit besondere Aufmerksamkeit erhält. Die „Eroica“, Beethovens Dritte Sinfonie, wird als Beispiel für seine heroische Musik präsentiert.
- Definition des Begriffs „Norm“
- Biographie Ludwig van Beethovens
- Beethovens Schwerhörigkeit und deren Einfluss auf sein Schaffen
- Die „Eroica“ als Beispiel für Beethovens heroische Musik
- Bewertung Beethovens als normentsprechender Künstler
Zusammenfassung der Kapitel
1.0 Einleitung
Die Einleitung stellt Ludwig van Beethoven als einen der wichtigsten Komponisten seiner Zeit vor und erläutert die Zielsetzung der Arbeit: die Frage, ob Beethoven ein normentsprechender Künstler seiner Zeit war, zu untersuchen.
2.0 Versuch einer Begriffsdefinition zu „Norm“
Dieses Kapitel definiert den Begriff „Norm“ anhand verschiedener Quellen, darunter der Duden, Brockhaus und wissenschaftliche Werke von Opp und Bayreuther. Es werden verschiedene Perspektiven auf den Normbegriff beleuchtet, insbesondere im Kontext der musikalischen Norm.
3.0 Biographie Beethovens
Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über Beethovens Leben und Karriere, mit besonderem Fokus auf seine Schwerhörigkeit und deren Auswirkungen auf sein Leben und seine Musik.
4.0 Eroica, Die Dritte Sinfonie
Dieses Kapitel stellt Beethovens „Eroica“ als Beispiel für ein heroisches Werk vor und hebt die Bedeutung der Sinfonie für Beethovens Schaffen in der Zeit seiner fortschreitenden Taubheit hervor.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Konzept der „Norm“ im Kontext der Musikgeschichte, insbesondere im Hinblick auf die Persönlichkeit und das Werk Ludwig van Beethovens. Zentrale Themen sind die Biographie Beethovens, seine Schwerhörigkeit, die „Eroica“ als Beispiel für heroische Musik und die Frage, ob Beethoven ein normentsprechender Künstler seiner Zeit war.
Häufig gestellte Fragen
Gilt Ludwig van Beethoven als typischer Vertreter der Wiener Klassik?
Beethoven wird oft als Modell der Wiener Klassik gelehrt, doch die Arbeit untersucht, ob er durch seine Neuerungen nicht vielmehr aus den bestehenden musikalischen Normen ausgebrochen ist.
Welchen Einfluss hatte Beethovens Schwerhörigkeit auf sein Werk?
Seine fortschreitende Taubheit führte zu Lebenskrisen, beeinflusste aber auch seinen künstlerischen Ausdruck, was sich besonders in seinen heroischen Werken widerspiegelt.
Warum wird die „Eroica“ (3. Sinfonie) in der Arbeit analysiert?
Die „Eroica“ gilt als Exempel für Beethovens heroische Musik und enthält zahlreiche absolute Neuerungen, die die damaligen musikalischen Konventionen sprengten.
Was bedeutet der Begriff „Norm“ im Kontext dieser Musikstudie?
Die Norm bezieht sich auf die gesellschaftlichen und musikalischen Erwartungen und Standards der Zeit, an denen Beethovens Schaffen gemessen wird.
Welche Rolle spielt die Anerkennung Beethovens durch seine Zeitgenossen?
Die Arbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen der Ablehnung seiner Neuerungen durch Zeitgenossen und seiner heutigen Position als unangefochtenes Genie.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Ludwig van Beethoven. Ein normentsprechender Künstler seiner Zeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/489102